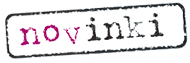novinki: Sehen Sie sich als ukrainischer oder russischer Schriftsteller?
Vladimir Rafeenko: Ich verstehe mich als ukrainischer Schriftsteller, auch wenn Russisch meine Muttersprache ist. Im Übrigen habe ich meinen letzten Roman auf Ukrainisch geschrieben. Er ist gerade im Czernowitzer Verlag „Meridian“ erschienen: „Mondegrin. Pisni pro smert’ i ljubov“ („Verhörer. Lieder über den Tod und die Liebe“). Aber eigentlich denke ich nicht, dass die Sprache hierbei eine zentrale Rolle spielt. Die Region, in der ich geboren und aufgewachsen bin, ist zwar russischsprachig, aber sie gehört eben zur Ukraine, egal wie sie vom europäischen Standpunkt aus gesehen wird. Ukrainisch war die Muttersprache meiner Großmütter. Das Lesen lernte ich auf Russisch und Ukrainisch praktisch gleichzeitig. Bei meiner Familie wurden am Festtagstisch Lieder auf Ukrainisch, Russisch und Belarussisch gesungen. Und die ukrainische Identität war mir niemals fremd.
n.: Sie wurden auch als „Donezker Schriftsteller“ bezeichnet. Können Sie sich damit identifizieren?
V.R.: Zeitgleich zu der Veröffentlichung meines ersten Romans („Demon Dekarta“) wurde ich von dem russischen Verlag „Ėksmo“ als „Donezker Schriftsteller“ bezeichnet. Eigentlich ist das ziemlich lustig und komisch zugleich. Wenn wir uns kulturologische, schöpferische Aspekte des Phänomens Literatur vergegenwärtigen, dann ist es Unsinn, einen Autor über ein Territorium, also eine geographische Größe, zu definieren.
Auf der anderen Seite ist der Roman „Demon Dekarta“ eine Publikation aus Vorkriegszeiten, als der nahende Krieg bereits in der Luft lag. Die Tatsache, dass ich vom Verlag als Donezker Schriftsteller bezeichnet wurde, implizierte die unterschwellige Konnotation, dass Donezk nicht Teil der Ukraine sei. So scheint es mir zumindest.
n.: Also sind Sie ein ukrainischer, aber kein Donezker Schriftsteller…
V.R.: Ich bin in Donezk geboren und leugne meine Stadt nicht. Es ist schwierig, wie soll ich Ihnen das erklären… Nehmen wir an, ich hätte in den letzten Jahren in einem kleinen Dorf einige Dutzend Kilometer von Kiew entfernt gewohnt und dort meinen letzten Roman geschrieben. Und würde noch weitere schreiben, wenn ich weiter hier leben würde. Bin ich dann ein Schriftsteller dieses Dorfes? Und wenn ich, zum Beispiel, nach Spanien auswandere und in Madrid schreibe? Wie soll uns diese Definition weiterhelfen? Das ist doch lächerlich.
Es ist doch offensichtlich, dass der Versuch, mich als Donezker Schriftsteller zu sehen, nichts mit literaturwissenschaftlichen Interessen zu tun hat. Das ist ein Versuch anderer Art. Er ist der politischen Situation, die für uns alle heute in unterschiedlicher Weise aktuell ist, geschuldet. Aber man muss doch verstehen, dass es Wichtigeres gibt als den Geburtstort eines Schriftstellers; es sind andere Dinge, die einen Autor ausmachen.
n.: Wenn Sie die regionale oder territoriale Zuordnung des literarischen Schaffens von Schriftsteller_innen ablehnen, warum akzeptieren Sie dann die Bezeichnung „ukrainischer Schriftsteller“ – ist das etwa keine Anbindung an ein Territorium?
V.R.: Das ist es ja: Ukrainisch ist die Zuschreibung zu einer Kultur, einer Volksgeschichte und einem Land, zu einem lebendigen und selbstständigen kulturellen Organismus, der nicht angezweifelt werden kann. Donezk und der Donbass sind keine Region mit einer eigenen Identität. Es gibt kein „Donezker Volk“, es gibt nicht die „Donezker Kultur“, diese Kategorie kann es nicht geben. Diese Stadt und diese Region waren schon immer Teil der Ukraine. Eine sehr spezielle Region, die ihre Vor- und Nachteile hat. Die Stadt gab und gibt es. Aber glauben Sie mir, sie ist nur Teil von etwas viel Größerem. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Und überhaupt sind die Versuche sehr komisch, mich und meinen Schaffensprozess in einen geographischen Kontext einzuordnen.
Außerdem: Kultur ist nicht nur das, was dich passiv ausmacht, sondern auch das, was du als aktiver Teilnehmer des kulturellen Prozesses auswählst und mitgestaltest.
n.: Welche literarische Tradition galt Ihnen am Anfang Ihres Schaffensprozesses als Orientierung und welche heute?
V.R.: Es fällt mir schwer mich in eine konkrete literarische Tradition einzureihen. Aber zweifellos ist es so, dass Nikolaj Gogol’ und Hans Christian Andersen mich als Schriftsteller hervorgebracht haben. Als erster trat Andersen in mein Leben. Er ist der Begründer des Kunstmärchens in Europa und damit der erste, der mythologische und volkstümliche Konzepte aus einer vollkommen eigenen, neuartigen Perspektive einbrachte. In Orientierung an Andersen würde ich meine eigene Schreibweise dem magischen Realismus zuordnen oder vielleicht sogar von einem „Anderson-Realismus“ sprechen. In meinen Romanen gibt es immer zwei Kontexte, die nicht getrennt bestehen, aber auch keine Einheit bilden. Einer ist in der profanen Realität verwurzelt, der andere in der magischen, dem unterschwellig Mythischen des Geschehens. Diese Mischung beruht auf meiner tiefsten Überzeugung, dass es unmöglich ist, unsere Realität allein von einem positivistischen Standpunkt aus zu verstehen.
Aber auch ohne Gogol’ und Anton Čechov wäre meine literarische Laufbahn nicht denkbar… Und im Großen und Ganzen komme ich auch ohne Faulkner nicht aus, denn der Roman The Sound and the Fury hat mich sehr stark geprägt. Und da sind noch meine geliebten Herman Melville und Penn Warren, sowie Goethe, den ich liebe, und Shakespeare, dessen Tragödien ich fast auswendig kenne. Ich kann sagen, dass mein literarischer Ursprung die Art von Literatur ist, die die Realität nicht auf soziale Aspekte, d.h. eine Subjekt-Objekt-Beziehung, reduziert. Unter den neueren russischen Schriftstellern sind mir Saša Sokolov und Venedikt Erofeev am nächsten. Was die deutsche literarische Tradition betrifft, faszinierte mich in meiner Studienzeit der Roman “Das Parfüm” von Patrick Süskind.
n.: Als ukrainischer Schriftsteller haben Sie keine ukrainischen Autor_innen genannt, die Ihre literarische Entwicklung beeinflusst haben. Gibt es unter den Ukrainer_innen jemanden?
V.R.: Warum? Ist Gogol’ Ihrer Meinung nach denn kein ukrainischer Schriftsteller? Ich halte Gogol’ für einen ukrainischen Schriftsteller, schon allein deshalb, weil es im russischen Literaturkontext nichts dergleichen gibt. Wodurch zeichnet Gogol’ sich aus? Die ganze Poetik Gogol’s basiert auf einer Metaphysik, die dem russischen Literaturkontext, welcher ganz auf das Soziale orientiert war, unzugänglich ist. Gogol’ ist v.a. insofern ein ukrainischer Schriftsteller, als für ihn die soziale Dimension im Vergleich zur metaphysischen Dimension der Existenz des Menschen vollkommen zweitrangig ist.
Was zeitgenössische ukrainische Autoren betrifft, sollten Sie wissen: ich liebe Andruchovič und Žadan. Aber ich war schon erwachsen, als ihre Texte erschienen. In dieser Hinsicht sind sie natürlich nicht zum literarischen Maßstab für mich geworden, der mich formte, aber unzweifelhaft haben ihre Texte mir weitergeholfen. Als ich ihre Romane bereits als erwachsener Mensch las, verstand ich, dass ich in dieser Welt nicht allein bin, wie es mir manchmal schien.
n.: Ausländische Autor_innen haben Sie in russischer Übersetzung gelesen. Kann eine Übersetzung das Original ersetzen?
V.R.: Die Werke ausländischer Autoren habe ich in ihrer Übersetzung ins Russische gelesen. Ich habe beispielsweise etliche Übersetzungen des „Hamlet“ von Shakespeare gelesen und sie miteinander verglichen. Ich denke, dass sogar in der besten Übersetzung eine bestimmte sprachliche und semantische Schicht bleibt, die nicht adäquat zu übersetzen ist. Wie sehr ein professioneller Übersetzer auch um genaueste Entsprechung und vollständige Übertragung des Originaltextes in die Zielsprache bemüht ist, eine ‚Kopie‘ anzufertigen, ist letztlich unmöglich. Dennoch gibt es in jedem künstlerischen Werk eine bestimmte Struktur, die in der Übersetzung nicht zerstört wird und durch gute, professionelle Arbeit adäquat übertragen werden kann. Wäre dem nicht so, würden wir „König Ödipus“ weder lesen noch verstehen können. Ungeachtet der Übersetzung und unseres zeitlichen Abstandes von den Schaffensbedingungen der Tragödie von Sophokles, finden wir in ihr etwas für uns Existenzielles, etwas, mit dem wir uns identifizieren. Und das bedeutet, dass eine bestimmte Struktur, unabhängig von kulturellen und anderen Kontexten, über Epochen hinweg erhalten bleibt.
n.: Sind ÜbersetzerInnen aus Ihrer Sicht ebenbürtige AutorInnen?
V.R.: Man sagt, dass die Übersetzerin Rita Rajt-Kovaleva Jerome David Salinger ‚hervorgebracht‘ hat. Das Problem ist, dass es heutzutage viele Übersetzer gibt, die schlecht übersetzen. Eine schlechte Übersetzung kann einem für immer den Wunsch verderben, einen guten zeitgenössischen Autor zu lesen, der einem im Original unzugänglich ist. Vollkommene Freiheit, hier verstanden als Willkür des Übersetzers im Umgang mit dem Originaltext, stößt mich ab. Selbstverständlich kann eine Übersetzung angemessen sein; sie ist es dann, wenn die künstlerische Konstruktion, die Struktur des Originals, bedeutungstragende Schlüsselmomente sowie die syntaktischen Strukturen beibehalten werden. Denkt man diesen Gedanken weiter, so wird klar: Ein guter Übersetzer schafft keinen neuen Text, er fängt nicht an zu phantasieren. Eine gute Übersetzung erkennt man daran, dass der Übersetzer Hinzufügungen vermeidet und Handlung, Energetik und Bedeutung des Originaltextes beibehält.
n.: Kommen wir nochmal auf die Frage des Nationalen zurück. Was ist nationale Zugehörigkeit?
V.R.: Nationale Zugehörigkeit wird durch die Sprache bestimmt, in der die Person „mit ihrem Gewissen“ spricht. In diesem Sinne ist sie dem Menschen sozusagen von Geburt gegeben. Wir suchen uns weder den Ort noch die Zeit unserer Geburt aus. Das Gewissen hat keine gegenständliche Grundlage in der Welt – es ist keine Sache. Wenn ich sage, dass ich gewissenhaft handle, dann geschieht dies nicht aus einem bestimmten Grund. Wenn ich in das Gebiet der Ontologie, der Zwiesprache mit dem Gewissen, eintrete, und also an den Ursprung des wirklichen Denkens komme, verwandelt sich die Sprache in ihrer Naturgegebenheit notwendigerweise in eine Symbolsprache, die universell ist. Tod, Güte, Ehre, Ewigkeit, Barmherzigkeit, Verständnis usw. – dies sind für uns alle universelle Symbole. Die Sprache des Schweigens, die Sprache des Seins – das ist die Sprache, die einen tatsächlich als Menschen ausmacht. Das ist die Sprache, in der jeder von uns zu sich und zu Gott spricht.
Für alle diese Werte und Kategorien gibt es nationale Entsprechungen, doch mir ist wichtig, hier zu betonen, dass mich mit jedem Menschen auf dieser Erde die Fähigkeit, gewissenhaft und aus der Persönlichkeit heraus zu handeln, vereint. Alles, was uns voneinander unterscheidet, hat in erster Linie mit nationalen, territorialen und anderen Besonderheiten zu tun. Daraus folgt, dass jeder von uns in jedem Moment seines Lebens klar verstehen muss, was seine innere Stimme als Individuum, das aus einem territorial und kulturell begrenzten Chronotopos heranwächst, ausmacht, und was uns aus dem Raum jener unbekannten Heimat, von der wir durch unser Hier und Jetzt abgeschieden sind, eigen ist.
Wenn sich so eine Frage in dir herausbildet, beginnt die Zeit der bewussten Herausbildung der eigenen nationalen und kulturellen Identität im Sinne einer freien Wahl als Resultat persönlicher Erfahrung.
n.: Ihren letzten Roman haben Sie auf Ukrainisch geschrieben. Warum sind Sie zur ukrainischen Sprache gewechselt?
V.R.: Ich las immer in beiden Sprachen, sprach aber ausschließlich Russisch, denn in meinem alltäglichen Donezker Umkreis sprach keiner Ukrainisch. Als die russländische Aggression mich zwang, nach Kiew zu gehen, ist mir plötzlich bewusst geworden, dass ich Ukrainisch lesen, aber weder sprechen noch schreiben kann. Und ich entschloss mich dies zu ändern. Dafür gab es mindestens zwei Gründe.
Der erste ist die Situation, die im Frühling 2014 entstanden ist. Es kamen Menschen in meine Stadt, die ankündigten, dass ich aus meinem Land gerettet werden müsste. Nun ist es aber so, dass ich 45 Jahre in meiner Stadt gelebt habe und niemals vor jemandem beschützt werden musste. Mir verbot niemand jemals, meine Muttersprache zu sprechen; ich habe in keiner Situation jemals Sprachdiskriminierung erfahren (wie übrigens auch nicht die letzten vier Jahren, in denen ich bei Kiew wohnte). Es ist eher andersherum: In unserer Region musste die ukrainische Sprache immer unterstützt und verteidigt werden. Dass die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine geschützt werden musste, ist eine Lüge, gegen die man sich wehren muss. Ich habe dies als persönliche Herausforderung angesehen. Außerdem schämte ich mich, als professioneller Philologe das Ukrainische nicht auch aktiv zu beherrschen. Und so entschloss ich mich die Situation so zu verbessern, wie ich es für richtig erachtete und wie ich es konnte. Im Laufe der letzten Jahre habe ich intensiv die Sprache gelernt und in diesem Jahr einen Roman auf Ukrainisch geschrieben. Das heißt natürlich nicht, dass ich gar nicht mehr auf Russisch schreiben werde, um auf diese Weise meine psychologischen Traumata oder irgendwas dergleichen zu begleichen. Es ist dumm, auf die russische Sprache zu verzichten, nur weil es die Sprache des Angreifers ist. Es ist das Letzte, die Sprache für den Kampf einzusetzen. Es scheint mir, dass ein denkender Mensch prinzipiell nur mit sich selbst kämpfen und nur sich selbst gegenüber Vorwürfe erheben und etwas verändern kann. Deshalb habe ich einen Roman auf Ukrainisch geschrieben. Als Schriftsteller und als Mensch habe ich während der Arbeit an diesem Text sehr viel dazugewonnen. Zugleich habe ich auf eine mir als Autor eigene Weise meine bürgerlichen und politischen Überzeugungen kundgetan.
n.: Wie wollen Sie nun weiter mit der russischen Sprache verfahren? Russischsprachige Dichter aus der Ukraine wie Alexander Kabanov und Boris Chersonskij haben zuletzt immer wieder darüber nachgedacht, dass die russische Sprache nun zur „Sprache des Feindes“ geworden ist und somit einer Legitimierung bedarf…
V.R.: Wenn es mir gelingt, möchte ich abwechselnd einen Roman auf Ukrainisch, einen auf Russisch verfassen. Die russische Sprache werde ich nicht aufgeben, warum denn? „Sprache des Feindes“? Das ist totaler Blödsinn. Das ist die Sprache, in der meine Mutter mit mir gesprochen hat, es ist nicht die Sprache des Feindes, sondern die Sprache meiner Mutter. Wer aufgrund der aktuellen politischen Situation auf welche Weise traumatisiert ist – das steht auf einem anderen Blatt.
All das ist natürlich überhaupt nicht einfach. Sowohl Kabanov als auch Chersonskij sind große Dichter; selbstverständlich müssen sie darauf reagieren, was passiert. Im Übrigen, wie mir scheint, differieren ihre Reaktionen auf die Sprachenfrage in wesentlichen Punkten. Während Chersonskij versucht, auch ukrainische Gedichte neben russischen zu schreiben, beschäftigt sich Kabanov verstärkt mit Interferenzen und arbeitet an einer translingualen Poetik. Was prinzipielle Dinge betrifft, so muss man verstehen, dass im Lauf dieser letzten (Kriegs)Jahre ein dramatischer nationaler Formierungsprozess im Gange ist. Was bedeutet denn Nation? Nationale Zugehörigkeit? Dasselbe wie das Gewissen. Es geht um die politische Nation! Sie ist kein Gegenstand; man kann sie nicht anfassen. Ich muss mich entscheiden sie anzunehmen (oder eben nicht) kraft meines eigenen Willens.
Das zu tun ist nicht leicht, es erfordert Anstrengung, Reflexion, Bewusstseinsbildung. Bis zum Krieg war ich, ehrlich gesagt, ein absolut apolitischer, ein „häuslicher“ Mensch. Und wenn nicht das wäre, was in der Ostukraine und auf der Krim derzeit vonstattengeht, würde ich in Donezk sitzen und bis zu meinem Tode irgendwelche Texte schreiben. Und würde womöglich nie ein paar Zeilen auf Ukrainisch schreiben. Aber der Krieg trat in mein Haus ein. Und um wenigstens ein wenig Respekt vor mir selbst zu wahren, war ich gezwungen, eine klare Entscheidung zu treffen, glauben Sie mir, es war eine sehr leidvolle Entscheidung. Und nach dem Prinzip des „Gamburgskij sčet“ (dt. „Hamburger Rechnung“: eine von einem Hamburger Ringkampfbrauch abgeleitete, Anfang des 20. Jh.s international bekannte Metapher für „Spiel ohne Betrug“, Viktor Šklovskij verewigte sie 1928 in seinem gleichnamigen Prosaband, Anm. d. Red.) ist die Frage, ob ich ein ukrainischsprachiger, russischsprachiger oder bilingualer Schriftsteller bin, irrelevant. All diese Fragen sind zweitrangig. Das wichtigste ist tatsächlich, wie ehrlich und produktiv du arbeiten kannst, in welcher Sprache auch immer du schreibst.
n.: Warum wird in Ihrem Roman Donezk als „Stadt Z“ bezeichnet?
V.R.: Der Buchstabe Z ist verbunden mit der Kategorie „0“. Und in dieser Hinsicht ist es vor allem mit dem System Descartes’ verbunden, in dem die „0“ der Referenzpunkt ist. Und in diesem Sinne ist „Zero“ einerseits das Merkmal der Null als Ort der Leere, andererseits als Ausgangspunkt für die potentielle Ausbreitung des Descart’schen Universums. Das ist das, was nicht existiert, aber ohne das auch nichts beginnen kann. Die Stadt Z in „Dolgota dnej“ soll eine Fortführung des Stadtmotivs aus „Demon Dekarta“ sein. Diese beiden Romane können sozusagen als Dilogie verstanden werden.
Im „Demon Dekarta“ gibt es eine deutliche Vorahnung des künftigen Krieges, wobei er drei Jahre vor dessen Beginn geschrieben wurde. Zu dieser Zeit hat man mir Vorwürfe gemacht und gesagt „Was für einen Blödsinn du da schreibst!“. Aber mir schien, dass in dem Roman etwas sehr zutreffend festgehalten wurde. Im Herbst und Winter 2014 verstand ich, dass es Zeit war, den zweiten Teil dieser Dilogie zu verfassen. In diesen Büchern gab es verschiedene Figuren, aber ohne „Descartes’ Dämon“ kann man nicht verstehen, wie das passierte, was passierte. Denn etwas, das das friedliche Leben bestimmte, ging bereits vor dem Krieg in der Stadt Z in die Brüche.
In meinem neuesten, ukrainischsprachigen Roman habe ich die Geschichte der Stadt Z weitergeschrieben. Wie in den beiden früheren Romanen ist „Z“ nur eine andere Bezeichnung für die Stadt Donezk und gibt in diesem Sinne kein Rätsel auf. Ein Teil der Romanereignisse spielt sich genau dort ab, ein großer Teil jedoch in Kiew. Aber trotzdem kann man diese Romane nicht als „Trilogie“ bezeichnen, schon allein deswegen, weil niemand eine Trilogie herausgeben würde, von der zwei Romane auf Russisch und einer auf Ukrainisch geschrieben sind. Als Trilogie könnte man sie nur in der Übersetzung in eine Fremdsprache herausgeben.
n.: Da Sie bereits den Beginn des Krieges erahnt haben, können Sie eine Vermutung aufstellen, wann der Krieg endet?
V.R.: Da von der Ukraine in diesem Fall nichts abhängt, werde ich keine Anstrengung machen über Politik zu sprechen und das Ende des Krieges im Donbass zu prognostizieren. Alles hängt von Russland und seinem politischen Willen ab. Ich denke, Europa könnte in dieser Sache eine wesentliche Veränderung bewirken, wenn es wöllte; aber Europa will sich (noch) nicht klar auf eine Seite stellen und die Position der Ukraine stärken, ganz bewusst, wobei es sehr gut weiß, wie man eine Veränderung bewirken könnte. Ich habe in dieser Hinsicht nur negative Gefühle. Ich bin kein Prophet, aber mir scheint, dass wir gerade erst am Anfang stehen; die ganze Geschichte hat noch nicht begonnen. Ich bin da ziemlich pessimistisch.
Danke für das Gespräch, Vladimir!