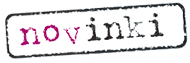novinki: Die Hauptfigur des Romans, Mordkhe Markus, ist ein eher skeptischer Mensch. Um ihn herum wirbelt das Revolutionsgeschehen von 1917, in seinem Inneren aber scheint Stille zu herrschen. Wie würden Sie die Hauptfigur des Romans beschreiben?
Lothar Quinkenstein: Es ist eine vielschichtige Figur. Schon sein Name legt das nahe. Sein Vorname ist Mordkhe – Mordechai – der Nachname ist Markus. Im Zuge der Assimilation legten sich viele Juden, die Mordechai hießen, den Vornamen Markus zu, um ihrem Namen sozusagen einen „neutraleren“ Klang zu verleihen – ein Zugeständnis an die Mehrheitsgesellschaft. Der Vater von Ludwik Zamenhof wäre hier zu nennen, Mordechai (Markus) Zamenhof, oder der in Lemberg geborene Rabbiner und Schriftsteller Mordechai (Markus) Ehrenpreis.
In der Figur Mordkhe Markus bündeln sich also Traditionsverbundenheit – was wir nicht primär mit religiöser Praxis gleichsetzen, sondern in breiterer Perspektive verstehen sollten, als Ausdruck einer Geistesgeschichte – und Aspekte der Assimilation. Die Figur trägt diese beiden Gedankenwelten in sich, und das Interessante dabei ist, dass die beiden Welten nicht nach dem Muster eines Entweder-oder dargestellt werden, sondern im Sinne eines Sowohl-als-auch. Das schlägt sich auch insgesamt im Konzept des Romans nieder. Wesentlich scheint mir hier vor allem zu sein, dass durch dieses Konzept Erweiterungen geschaffen und damit auch Inhalte miteinander verbunden werden können, die vielleicht auf den ersten Blick weit auseinander zu liegen scheinen. Die Horizonte werden weit. Damit steht der Roman im Kontext eines ganzen Kosmos an Erfahrungen und Debatten.
n.: Was ist das für eine Welt, in der die Hauptfigur Mordkhe Markus lebt?
L.Q.: Der Ort bleibt namenlos, er heißt „die revolutionäre Stadt“ und wird damit universal. Wir haben es mit einer Stadt in Ostmitteleuropa zu tun, die selbstverständlich stark von jüdischer Kultur geprägt ist, und die dann in das Revolutionsgeschehen hineingezogen wird.
Hier sollten wir uns vor Augen führen, wie die jüdische Kultur in diesen Landschaften beschaffen war: transnational und mehrsprachig. Claudio Magris sprach vom „mitteleuropäischen Humanismus“, und alle Assoziationen, die diese Wendung aufruft, lese ich als gedankliche Grundierung auf jeder Seite des Romans Montag mit. Und gerade das Jiddische ist Ausdruck dieses „mitteleuropäischen Humanismus“. Wenn man es aus der heutigen Perspektive fassen möchte – eine Kultur, die par excellence europäisch ist.
n.: Mordhke Markus lebt zurückgezogen in seinem Dachkämmerlein. Ein ruhiger Mensch, der ausgiebig grübelt – über die Welt da draußen, über die Menschen in ihr und über sich selbst. Zwar sympathisiert er mit der kommunistischen Idee, seine Weltanschauung erlaubt es ihm aber nicht, das gesamte Parteiprogramm anzunehmen. Wie positioniert er sich zu dem, was sich vor seinen Augen auf der Straße abspielt?
L.Q.: Mordkhe Markus ist mit komplexen und komplizierten Fragen beschäftigt, die er mit dem Geschehen auf der Straße in Verbindung bringt. Und der Leser steht mit ihm am Fenster der Dachstube, sieht die Welt durch die Augen des bescheiden lebenden Hebräischlehrers, der sich in Schwindel erregende Höhen der Reflexion begibt. Die Revolution wird dabei zum Brennglas, das die ganze Problematik in Vergrößerung zeigt. Die Hoffnungen auf Veränderung – insbesondere auf Gleichberechtigung und Akzeptanz der jüdischen Bevölkerung innerhalb der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung – waren sehr, sehr groß.
Ende des 19. Jahrhunderts kam in den jüdischen Lebenswelten Ostmitteleuropas einiges in Bewegung, und die Suche nach Identitätsmustern, vor allem nach Auswegen aus einer bedrückenden Lage, äußerte sich in vielfältiger Form. Die einen sahen in der Assimilation die größte Gefahr und wollten sich mit der Orthodoxie gegen die „Verlockungen“ der Moderne wappnen. Andere hielten den Antisemitismus für die größere Bedrohung und sahen in der Assimilation die einzig mögliche Reaktion darauf. Die Zionisten hielten den jüdischen Nationalstaat für die einzige akzeptable Lösung. Ein wiederum anderes Konzept vertrat der Bund – der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund in Litauen, Polen und Russland –, der 1897 in Vilnius (jiddisch: Vilne) gegründet wurde, ein Jahr nach Kulbaks Geburt. Die Bundisten waren Gegner des Zionismus, sie plädierten dafür, dort zu bleiben, wo man lebte. Sie wollten eine im säkularen Sinne verstandene jüdische Kultur pflegen, für die wiederum das Jiddische das vorrangige Identitätsmerkmal sein sollte, außerdem waren Bildung und soziale Gerechtigkeit ein großes Anliegen.Und nun, als die Revolution ausbricht, stellt sich die Frage: „Wo steht der Bund?“ – diese Frage wird im Roman übrigens nicht beantwortet. Der Bundist, der offenbar orientierungslos durch die „revolutionäre Stadt“ läuft, scheint mir ein Sinnbild für das Auseinanderklaffen von Idee und Wirklichkeit zu sein. Denn was Mordkhe Markus von seinem skeptisch-distanzierten Beobachterposten aus sieht, ist eine nicht enden wollende Abfolge von Eruptionen der Gewalt.
n.: Mit dem Blick auf die Straße eröffnet sich immer nur ein Ausschnitt, mit dem Blick in die Bücher das große Ganze? Mordkhe Markus widmet seine Freizeit fast ausschließlich – und das mit Leidenschaft – der Lektüre von Büchern. Immer präsent: das Buch Hiob.
L.Q.: Die Beschäftigung mit Lektüren, über den Büchern sitzen, nächtelang – das hat in der jüdischen Tradition eine starke ethische Komponente, denn das ist die eigentliche Aufgabe: sich mit der Schrift, der Thora, und den Kommentaren dazu, dem Talmud, auseinanderzusetzen und dadurch die eigene ethische Haltung zu vervollkommnen. Diese Form einer lebenslangen Lektüre, eines lebenslangen Lernens ist harte Arbeit, vor allem auch Arbeit an der eigenen Person. Und jemand, der ständig das Buch Hiob aufgeschlagen auf dem Tisch liegen hat, beschäftigt sich mit den drängendsten aller Fragen – nämlich den Deutungsmöglichkeiten, die versuchen, im Leiden einen Sinn zu entziffern.
n.: Bereits als Jugendlicher ist Mordkhe Markus den „Armenleuten“ durch die Stadt gefolgt. Immer montags, an dem Tag, an dem sie allwöchentlich von Haus zu Haus ziehen und betteln. Jetzt folgt er den „Armenleuten“ immer noch, mit seinen Blicken, von seinem Fensterchen aus. Er blickt hinunter auf die Straße und findet die „pure Armut“ erhaben. Wie ist das zu verstehen?
L.Q.: Das Bild von den „Armenleuten“ in ihrer erhabenen Tätigkeit führt uns zur Mystik. Es ist die Überzeugung, dass Profanes und Sakrales nicht voneinander getrennt werden können, weil alles ein Teil der Schöpfung ist. Auch in den einfachsten Handlungen und Tätigkeiten spiegelt sich das Wunder der Erschaffung der Welt. „Einer ging zu einem Zaddik“, so heißt es in den chassidischen Überlieferungen, „um zu sehen, wie er sich das Schuhband knüpft.“
n.: Arbeiter, Schneider, Hirten … Automobile und Reiter, allesamt vereint zu einer Masse, die mit brodelnder Stimmung geladen die Straßen der Stadt säumt. Die einen, leer und erschöpft, gehorchen still. Die anderen erklären schnell ihre revolutionären Haltungen. Mordkhe Markus sucht zunächst die Stille und versteht plötzlich, dass er den „Armenleuten“ eine Botschaft überbringen muss. Daraufhin wird er der Agitation beschuldigt und inhaftiert. Was genau wird ihm eigentlich vorgeworfen?
L.Q.: Er wird verhaftet, weil er plötzlich als Feind gilt in einer Atmosphäre, in der jeder zum Feind werden kann. Das sagt sehr viel über den Charakter dieses „revolutionären“ Geschehens aus. „Lieber hundert Unschuldige töten, als einen Feind der Revolution davonkommen lassen“ – das ist ein Satz von Lenin. Der Terror war von Anfang an Programm, und hinzufügen sollten wir an dieser Stelle, dass es der Oktober 1917 gewesen ist, der die politischen Errungenschaften des Februar 1917 zunichtegemacht hat. Kulbak selbst ist 1937 Opfer des stalinistischen Terrors geworden, damals wurde die gesamte Redaktion der jiddischen Literaturzeitschrift Shtern in Minsk verhaftet, alle wurden nach einem Schauprozess hingerichtet.
n.: Während seiner Haft erlebt Mordkke Markus unterschiedliche Gemütszustände. Trauer wechselt mit eigentümlichen Momenten der Freude, letztlich verfällt er in eine Art Trancezustand und erkennt etwas Wesentliches: „Es existiert gar nichts. Ihr Batlonim, o ihr, die ihr so lang gewartet habt!!!“ Was ist es, was er hier erkennt – und welche Rolle spielen die Batlonim dabei?
L.Q.: Hier setzt sich Kulbak mit dem Herzstück jüdischen Denkens auseinander, der messianischen Idee. Mordkhe Markus distanziert sich nicht nur vom Revolutionsgeschehen, er distanziert sich auch von der messianischen Idee des Judentums. Am Ende bleibt das Nichts, aber nicht im Sinne einer Resignation, sondern im Sinne einer – ich glaube, so dürfen wir es nennen – mystischen Einsicht in das Rätsel der Existenz, die vor allem von jeglicher dogmatischen Lehrmeinung Abstand nehmen möchte. Dass der Schöpfer die Welt „über dem Nichts aufgehängt“ hat – diese Erkenntnis findet sich gerade im Buch Hiob (26,7).
Mit seiner Kritik richtet sich Mordkhe Markus an die Batlonim, also an Männer, die keinem Broterwerb nachgehen, weil sie ihr ganzes Leben dem Studium widmen. Aus orthodoxer Sicht gebührt ihnen großer Respekt, denn mit ihrem Lernen und Studieren wollen sie die Welt für die Ankunft des Messias vorbereiten. Diese ganze Anstrengung wird jetzt radikal in Frage gestellt – das ist ein ungeheuer subversiver Akt.
Zugleich verweist Kulbak auf die 36 Gerechten, eine weitere essentielle Idee. Sie durchzieht übrigens Kulbaks gesamtes Werk. In seinem Roman Der Messias vom Stamme Efraim ist sie von Anfang an präsent, außerdem hat er ein Poem darüber geschrieben: „Lamed-Wow“. Die Buchstaben lamed und waw, jiddisch wow, bilden das Wort, das in einer Jesaja-Stelle vom Warten auf den Messias spricht, und der Zahlenwert dieses Wortes ist 36. Aus dieser Stelle bei Jesaja wurde abgeleitet, dass es in jeder Generation 36 Gerechte gebe, die mit ihrem aufrechten und tadellosen Verhalten dafür sorgen, dass die an sich unvollkommene Welt weiter existieren könne. Sie leben unerkannt und sind sich vor allem auch selbst ihrer Rolle nicht bewusst. Verbunden mit der Verborgenheit ist wiederum ein ethischer Anspruch: Niemand, gleich wie er dem ersten Anschein nach wirken mag, darf herablassend behandelt werden, denn ich kann nie wissen, ob ich nicht einem Lamedwownik, einem der 36 Gerechten, begegnet bin. Ein Jahr vor dem Erscheinen von Montag – 1925 – entstand in Polen der Stummfilm Der Lamedwownik, und der Gerechte in dieser Geschichte trägt – das ist interessant – deutliche Züge einer Christusfigur. Etwas Ähnliches sehen wir in Kulbaks Roman! Auch Kulbak synthetisiert die Ideen und formt aus ihnen etwas Neues. Und die Frage, ob Mordkhe Markus nicht ein Lamedwownik sein könnte, drängt sich geradezu auf.
n.: Bleiben wir noch einen Moment bei den Möglichkeiten der Erkenntnis. An einer Stelle wird die Negation als ein Akt beschrieben, der im Nichtstun zur Erkenntnis führt. „rkennen heißt, sich des überkommenen Begriffs MENSCH zu entledigen und Sein zu werden . Sein heißt: Sich selbst in der Welt zu erkennen, und Erkennen heißt: Sich der Realität stellen, aber Kampf ist gerade das Selbstverschließen . Und weil der Verstand ein Mittel des Menschen im Kampf ist, ist er kein Mittel für die Erkenntnis.“
L.Q.: Erkenntnis auf anderen Wegen als auf dem Weg des Verstandes – ich lese das als Plädoyer für eine Denkweise, die nicht den klassischen Gegensätzen folgt. Als Versuch, das Rationale mit dem rational nicht Fassbaren zu verknüpfen. Verstand wiederum als Mittel des Kampfes – eine traurig zutreffende Diagnose geschichtlicher Abläufe. Hier äußert sich scharfe Kritik an einer Deutung der Welt, die sich allein der Aufklärung verschreiben möchte. Der Verstand nicht als Lösung des Problems, sondern – oft genug – gerade als Teil des Problems.
n.: Bis zu seiner Verhaftung lebt Mordhke Markus sehr zurückgezogen. So zurückgezogen, dass sein soziales Netz relativ grob gewebt ist. Selbst sein Vater, so heißt es, hatte ihn bereits vergessen. Lediglich das Fräulein Gnesye gehört zu seinen Vertrauten, seinen Freunden. Ihr offenbart er seine tiefsten Gedanken. Welche sind das?
L.Q.: Eine meiner Lieblingsszenen im Roman ist die Szene im Park: Mordkhe Markus spricht mit dem Fräulein Gnesye über Grundzüge des deutschen Idealismus, woraus eine kleine philosophische Vorlesung wird, und im Eifer der intellektuellen Begeisterung nimmt er nicht mehr wahr, dass Fräulein Gnesye eher Interesse an einer Herzensangelegenheit hätte als an Fichte oder Hegel. In dieser Szene sehen wir, aus wie vielen Quellen Kulbak seine Inspirationen bezog, und diese Vielfalt der Themen schlägt sich auch im Stil nieder. Im Übrigen ist auch der Blick auf die idealistische Philosophie distanziert, für Mordkhe Markus ist sie – salopp gesagt – ein „netter Versuch“, aber nicht hinreichend, die Existenz des Menschen wirklich zu erfassen.
n.: Sie haben auf den Stil des Romans verwiesen. Wie würden Sie ihn beschreiben?
L.Q.: Es gibt Passagen, die einen ausgesprochen lyrischen Ton haben, sehr schön rhythmisiert, mit einer buchstäblich traumhaften Bildlichkeit. Doch folgt dann auch sofort die Brechung: „Die Berge staunten kalt im Mondlicht, ohne den leisesten Windhauch. In der Stille hörte man, wie das müde Licht rann, rann, über die kalten Leichen. Die Felder, die wie heilig in der reinen Stille lagen, träumten.“ Hier gibt es keine „natürliche“ Unschuld mehr. Die Landschaft – die Natur – ist gezeichnet von der Gewalt der Geschichte. In anderen Passagen hat die Sprache expressionistische Züge: „Rattern setzte ein, nah, nah von einem Maschinengewehr: Tak, tak, tak, tak – es klang, als würde man Sand auf ein Blech schütten. Revolver bellten, wie kleine Hunde. Und Maschinengewehre pickten, pickten, klapperten und steppten vorsichtig – es klang vertraut. Wie auf einer Nähmaschine.“ Das sind sehr scharf geschnittene Bilder und Vergleiche. An wiederum anderen Stellen haben wir Anthropomorphisierungen, markante Farbgebungen – die ganze Palette expressionistischer Stilmittel.
n.: Insgesamt wird Mordkhe Markus als eine Persönlichkeit gezeichnet, die zwar in Anbetracht der Ereignisse schwermütig auf die Welt blickt, dabei aber keineswegs unglücklich scheint. Angesprochen auf Selbstmordgedanken, antwortet er: „Nein, tausendmal nein . Ich liebe dieses Leben so sehr und liebe es von ganzem Herzen“. Das erinnert mich vom Ansatz her an Albert Camus …
L.Q.: Ja, da sind wir mitten in den universalen Gedanken. Mir fällt jetzt auch noch das Motto ein, das die Brüder Coen ihrem Film A Serious Man vorangestellt haben – es ist ein Satz von Raschi, einem der bedeutendsten jüdischen Gelehrten des Mittelalters: „Nimm in Einfachheit alles hin, was dir widerfährt.“ Ein Aufruf zu einer Haltung, die nicht zu verwechseln ist mit Gleichgültigkeit. Wir finden dasselbe etwa auch bei Marc Aurel: Egal, ob man dich bespuckt oder lobt, lass dich nicht davon berühren. Mordkhe Markus kommt dieser Haltung sehr nahe, und das entspricht durchaus der Liebe zum Leben.
n.: "Montag." Ein Buch, das vor fast 100 Jahren geschrieben worden ist. Welche Aktualität besitzt es heute? Oder hat es mit unserer Realität heutzutage nichts mehr zu tun?
L.Q.: Alles hat es mit unserer Realität heute zu tun. Alles. Es handelt sich um eine Literatur, die immer noch viel zu wenig bekannt ist. Im Grunde stehen wir noch immer am Beginn der Entdeckung – Wiederentdeckung – der jiddischen Literatur und Kultur. In seiner Rede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises für Literatur bezeichnete Isaac Bashevis Singer das Jiddische als „Sprache der furchtsamen und hoffenden Menschheit“. Melech Rawitsch sprach – mit Blick auf die Lyrik Abraham Sutzkevers – von der „jüdischen Ethik“ als „allgemein menschlicher Ethik“. Beide Äußerungen bestätigen sich an Kulbaks Roman.
Die Autoren dieses Kulturraumes haben großartige synthetische Leistungen vollbracht, und die Selbstverständlichkeit, mit der sie das „westliche Denken“ – wenn wir den Begriff mit aller gebotenen Vorsicht benutzen wollen – in ihr Schaffen einbezogen haben, fand kaum Entsprechungen in umgekehrter Richtung. Der Westen hat sich für den Osten in der Regel weit weniger interessiert. Damit kommen wir abermals zur Frage der Wahrnehmung: Was sehen wir als Zentrum an? Wo sehen wir die Peripherie? Wenn wir etwas lernen wollen über Perspektiven, Hierarchien, Asymmetrien und blinde Flecken der europäischen Kulturgeschichte – die jiddische Literatur ist hervorragend geeignet, einen neuen Blick auf scheinbar bekannte Phänomene zu gewinnen.
Der Verlag edition.fotoTAPETA und die Übersetzerin Sophie Lichtenstein haben sich in dieser Hinsicht große Verdienste erworben. In demselben Verlag ist auch der Zyklus der Berlin-Gedichte erschienen – ebenfalls in der Übersetzung von Sophie Lichtenstein: Childe Harold aus Disna. Wie Kulbak seine persönlichen Erfahrungen in Poesie verwandelt – die Fahrt aus dem weißrussischen Disna in den Westen, die Eindrücke in Berlin der 1920er Jahre – das verursacht Gänsehaut. Was für eine Brillanz, messerscharf – und was für eine Ironie! Vor kurzem ist außerdem Kulbaks Roman Die Selmenianer erschienen, im Verlag Die Andere Bibliothek, und im März 2018 eine Neuauflage von Andrej Jendruschs Übersetzung des Romans Der Messias vom Stamme Efraim. Es gibt also Anlass genug, sich mit diesem herausragenden Autor zu beschäftigen, dessen Werke zu den originellsten und innovativsten der jiddischen Moderne gehören.
Kulbak, Moyshe: Montag. Ein kleiner Roman. Aus dem Jiddischen von Sophie Lichtenstein. Berlin: edition.fotoTAPETA, 2017.
Originaltitel: Montog. Eyn kleyner roman. Warschau: „Kultur-Lige“, gedruckt von „Di Velt“, 1926.
Die Übersetzung basiert auf dem Nachdruck von 1929.
Weitere ins Deutsche übertragene Literatur von Moyshe Kulbak:
Childe Harold aus Disna. Gedichte über Berlin. Aus dem Jiddischen von Sophie Lichtenstein. Berlin: edition.fotoTAPETA, 2017.
Die Selmenianer. Aus dem Jiddischen von Niki Graça und Esther Alexander-Ihme. Berlin: Die Andere Bibliothek, 2017. (Neuübersetzung)
Der Messias vom Stamme Efraim. Aus dem Jiddischen von Andrej Jendrusch. Berlin: Wagenbach, 2018. (Neuauflage)