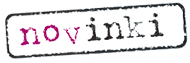Zwei Filme über Frauen in komplizierten Lebenssituationen – beide mit den Frauennamen als Titel – waren in diesem Jahr Preisträger beim FilmFestival Cottbus. So unterschiedlich das Schicksal von „Ajka“ und „Irina“ auch sein mag: Beide sind Gefangene (an) der Peripherie.
An der Peripherie
In Sergej Dvorcevojs neuem Spielfilm Ajka, dem Hauptpreisträgerfilm des FilmFestival Cottbus, kommt die titelgebende Protagonistin – dargestellt von der beeindruckenden Samal Esljamova – wie tausende andere Migrant_innen aus Zentralasien wegen besserer Verdienstmöglichkeiten in die russische Hauptstadt. Rechtlos an den Rand der Gesellschaft gedrängt, verrichtet sie jene Arbeit, die kaum ein anderer machen will. Es ist eine parallele Realität, die an den Rändern Moskaus und selbst im Zentrum im Verborgenen existiert und von den Bewohner_innen der Stadt nicht wahrgenommen wird. Doch Dvorcevoj investiert viel, um in seiner dichten, dokumentarischen Erzählweise das Innenleben dieser Frau physisch erlebbar zu machen. So ist die Kamera den überwiegenden Teil des Films extrem nah an Ajkas Gesicht, um uns ihre Gefühle zu vermitteln – so nah, dass es scheint, als würde sie nirgendwo mehr hinkönnen, gefangen sein. Dieser Effekt wird durch die Verwendung der hektischen, beinahe aufdringlichen Handkamera, die die Protagonistin die ganze Zeit verfolgt, noch verstärkt. Ajka ist eine ewig Gejagte, die sich wider alle physischen und sozialen Umstände im Moskauer Dschungel durchs Leben schlägt.
 Im Langfilmdebüt Irina von Nadežda Koseva wiederum erhielt Schauspielerin Martina Apostolova den Preis für die beste weibliche Hauptdarstellerin. Auch Irina lebt geographisch und psychisch an der Peripherie, in einem kleinen Dorf in Bulgarien. Das Leben ist schwer und um über die Runden zu kommen, klaut sie Essen im Café, in dem sie arbeitet. Regelmäßig füllt sie auch Bier heimlich aus dem Zapfhahn in eine Plastiktüte für ihren arbeitslosen Mann ab, der daheim mit dem Kind wartet. Eines Tages wird Irina jedoch wegen der Diebstähle entlassen und zu allem Überfluss erwischt sie zu Hause ihren Mann mit ihrer Schwester in flagranti. Der Horrortag ist leider noch nicht zu Ende (was auch ein wenig über die doch drastische Dramaturgie des Films erzählt): Kurze Zeit später bricht die illegale Kohlegrube im Garten des Hauses über Irinas Mann zusammen und er verliert beide Beine. Um Geld zu verdienen, ist Irina in der Folge zu allem bereit: die Demütigungen ihres ehemaligen Chefs zu ertragen, als sie ihren alten Job wiederhaben möchte; als Prostituierte zu arbeiten; und schließlich von einer Konkurrentin verprügelt zu werden. Erfolglos in ihren Versuchen ein Einkommen zu erzielen, entscheidet sie sich für eine Leihmutterschaft. Vom Rand der Gesellschaft wird sie plötzlich in deren mittelständisches Zentrum katapultiert und bleibt doch am Rande, denn die Leihmutterschaft ist in Bulgarien illegal und sie damit ohne Rechte.
Im Langfilmdebüt Irina von Nadežda Koseva wiederum erhielt Schauspielerin Martina Apostolova den Preis für die beste weibliche Hauptdarstellerin. Auch Irina lebt geographisch und psychisch an der Peripherie, in einem kleinen Dorf in Bulgarien. Das Leben ist schwer und um über die Runden zu kommen, klaut sie Essen im Café, in dem sie arbeitet. Regelmäßig füllt sie auch Bier heimlich aus dem Zapfhahn in eine Plastiktüte für ihren arbeitslosen Mann ab, der daheim mit dem Kind wartet. Eines Tages wird Irina jedoch wegen der Diebstähle entlassen und zu allem Überfluss erwischt sie zu Hause ihren Mann mit ihrer Schwester in flagranti. Der Horrortag ist leider noch nicht zu Ende (was auch ein wenig über die doch drastische Dramaturgie des Films erzählt): Kurze Zeit später bricht die illegale Kohlegrube im Garten des Hauses über Irinas Mann zusammen und er verliert beide Beine. Um Geld zu verdienen, ist Irina in der Folge zu allem bereit: die Demütigungen ihres ehemaligen Chefs zu ertragen, als sie ihren alten Job wiederhaben möchte; als Prostituierte zu arbeiten; und schließlich von einer Konkurrentin verprügelt zu werden. Erfolglos in ihren Versuchen ein Einkommen zu erzielen, entscheidet sie sich für eine Leihmutterschaft. Vom Rand der Gesellschaft wird sie plötzlich in deren mittelständisches Zentrum katapultiert und bleibt doch am Rande, denn die Leihmutterschaft ist in Bulgarien illegal und sie damit ohne Rechte.
Körper als Kapital
In einer Zeit, in der alles zur Ware geworden ist, wird auch der Körper zu einem Produkt, der emotionslos dem reinen Funktionieren untergeordnet werden muss. Davon erzählen Ajka und Irina auf jeweils eigene Art. So setzt sich Ajka kurz nach der Geburt harter physischer Arbeit aus, um jene unerreichbaren Summen Geld zu verdienen, die sie ihren Kreditgebern schuldet. Irina nutzt aus dem gleichen Grund ihren Körper und gebärt ein Kind. Während Ajka nun ihre Körperfunktionen nach der Geburt zu unterdrücken versucht, das Einschießen der Milch unter Schmerzen erst ausblendet und sich dann leidig am Abpumpen versucht, scheint Irina jeden Kontakt zu ihrem Körper und vor allem zu ihren Gefühlen verloren zu haben. Während Ajka kämpft – auch mit forschen Mitteln – erträgt Irina mit stumpfem Blick scheinbar alles, nur um irgendwie zu überleben.
Beide Filme thematisieren damit explizit und eindringlich, wie der Körper, besonders der weibliche, in der Welt des Kapitals auf sein Funktionieren reduziert wird. In Irina wird er erst zum Objekt der Sozialfürsorge, nachdem er als Gebärinstrument für eine fremde Familie eingesetzt wird. Gleichzeitig ist Irina völlig uninteressiert an Selbstfürsorge und isst mit den zukünftigen Eltern – als eine Art Protest gegen deren Überfürsorge – fette Pommes. Ajka wiederum will ihren körperlichen Zustand nach der Entbindung zunächst völlig ignorieren, sie arbeitet unter Schmerzen, beutet sich aus, wird aber schließlich durch die Blutungen und den Milchstau daran erinnert, dass sie ein Mensch ist.
Hoffnung in einer Gesellschaft ohne Solidarität
Beide Filme zeigen eine Gesellschaft, in der es den Menschen nicht gelingt, Widerstand gegen die Umstände in Form von Solidarität zu leisten. In Irina wie auch in Ajka gibt es keine Schuldigen, denn jede_r ist dazu gezwungen, sich aufgrund der ökonomischen Verhältnisse ausschließlich um sich selbst zu kümmern. So hat, wie Irina und ihr Mann, jede Familie im Dorf eine eigene Kohlegrube, die kein anderer benutzen darf, während in Ajka selbst die mit ihrer Landsmännin in einem Raum und nur durch einen dünnen Vorhang getrennt lebenden Frauen nicht bemerken, dass mit ihr etwas nicht stimmt. In den breiten Straßen Moskaus, jener Peripherie da draußen, geht es ums nackte Überleben.
Beide Filme zeigen das Leben der Frauen aus verschiedenen Perspektiven. Die komplizierte soziale Umgebung der Welt der illegalen Migrant_innen in Moskau wird in Ajka mit Hilfe des inneren Lebens der jungen Frau vermittelt. Dvorcevoj untersucht Ajkas Alltag auf dokumentarische Art, lässt den Film sein eigenes Leben entwickeln. Geprägt von Nahaufnahmen erscheinen viele Szenen improvisiert, wurden jedoch – wie der Regisseur im Gespräch erzählte – während der sechsjährigen Arbeit am Film akribisch inszeniert. Um das Gefühl der Unmittelbarkeit am Leben zu erhalten, überarbeitete Dvorcevoj 80% des Drehbuchs im Verlauf der Dreharbeiten – teilweise noch am Drehtag selbst. Im Gegensatz zu Ajka vermittelt sich in Irina die prekäre Situation weniger über das Gesicht der Protagonistin als vielmehr über die Lebensumstände selbst: in der kärglichen Ausstattung des Hauses, in dem sie lebt oder des Cafés, in dem sie arbeitet, die im krassen Gegensatz zur Stadt-Zweitwohnung der zukünftigen Eltern des Kindes stehen. Auch über Details arbeitet der Film die sozialen Unterschiede heraus: Die Meeresblick-Fototapete an der Wand und die ewigen TV-Reportagen über tolle Urlaubsziele markieren das Auseinanderklaffen von Traum und Wirklichkeit – für die Kleinfamilie werden aufgrund ihrer ökonomischen Situation Ferienorte dieser Art ein fernes Universum bleiben. Auch stilistisch macht sich die Enge bemerkbar: Die Kamera ist nicht sonderlich frei beweglich, oft statisch und zeigt die Welt in Totalen, die auch auf die Totalität dieses prekären Lebens hinweisen. Und auf die Unmöglichkeit, ihm zu entkommen.
Trotz der Tatsache, dass uns beide Filme hoffnungslos erscheinende Lebenssituationen zeigen, sprechen die Regisseur_innen ihren Protagonistinnen am Ende doch ein wenig Mut zu. Irina kehrt nach Hause zurück, beobachtet ihren Mann beim Spielen mit ihrem gemeinsamen Kind und freut sich aufrichtig über ihre Entscheidung zur Rückkehr. Ajka wiederum stillt, nach langer Odyssee und dem sinnlosen Versuch, irgendwie Geld aufzutreiben, ihr aus der Klinik geholtes Kind in einem Treppenhaus. Beinahe sieht es so aus, als wäre sie doch nicht bereit, ihren Kampf gegen die Umstände aufzugeben.
Dvorcevoj, Sergej: Ajka. Russland, 2018, 100 Min.
Koseva, Nadežda: Irina. Bulgarien, 2018, 96 Min.