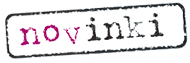Lesung im Literaturhaus in Zürich, Teilnahme bei der Leipziger Buchmesse, auf Tournee durch die Ukraine mit seiner Band "Sobaki v kosmose" (Hunde im Kosmos) und immer präsenter in den deutschsprachigen Medien mit seinem letzten Buch "Die Erfindung des Jazz im Donbass": Der ostukrainische Autor Serhij Zhadan etabliert sich europaweit. novinki hat Zhadan in Zürich spontan auf ein Bier eingeladen, um eine kleine Bestandsaufnahme zu machen.
novinki: Was sollten Ihre Leser über Sie als Autor wissen?
Serhij Zhadan: Ich kann nichts Wichtiges über mich berichten. Auch wenn es banal klingen mag, ist das Wichtigste in den Büchern. Ganz objektiv – ich bin ein Mensch ohne Biografie. Also ist es besser, einfach meine Texte zu lesen.
n.: Ihre Lesungen sind dynamisch, Ihre Auftritte mit der Ska-Band "Sobaki v kosmose" ziehen viele ZuhörerInnen an. Brauchen Sie die Bühne?
S.Zh.: Mich interessiert der Moment des Kontakts mit dem Leser, Zuhörer. Mir ist die Antwortreaktion wichtig und die Möglichkeit zum Dialog. Der Prozess des Auftritts selbst hingegen nicht.
n.: Sie waren früher Literaturwissenschaftler. Welche Autoren waren Ihnen wichtig?
S.Zh.: Ich bin mit den üblichen Klassikern der ukrainischen und russischen Literatur aufgewachsen. In meiner Kindheit galt es als grosser Erfolg, ein Buch von Dumas oder von Cooper zu besorgen. Das ist wahrscheinlich für den europäischen Bürger schwer vorstellbar. Und für die zeitgenössischen jungen Ukrainer wohl auch. Aber wir haben zu unserer Zeit die Bücher noch gejagt. Wahrscheinlich waren die ersten „erwachsenen“ Schriftsteller, die ich selbständig und freiwillig gelesen habe, Ševčenko und Gogol’. Die Beziehung zum Erstgenannten hat nicht so ganz geklappt, aber Gogol’ hat mich wirklich beeinflusst. Und beeinflusst mich immer noch. Als Jugendlicher, also als „ich beschlossen habe, Dichter zu werden“, habe ich für mich die Poesie des beginnenden 20. Jahrhunderts entdeckt – die ukrainische Erschossene Renaissance (Chvyl’ovyj, Svidzins’kyj, Plužnyk), russische Poesie (natürlich Majakovskij und natürlich Chlebnikov). Später habe ich für mich den ukrainischen Futurismus entdeckt.
Manchmal schreiben ukrainische Kritiker über den Einfluss der Beatniks auf mein Schreiben. In Wirklichkeit haben sie mir nie besonders gefallen. Ich mag Bukowski, aber ich habe ihn spät gelesen, erst im „reifen“ Alter. Mir war – wie wahrscheinlich auch den Gleichaltrigen, die in der Poesie der 1990er Jahre debütiert haben – das Beispiel älterer Kollegen wichtig: Die Dichtergeneration der sogenannten 80er. Sie haben uns demonstriert, wie anders die ukrainische Poesie sein kann, wie wenig sie dem ähneln muss, was man uns in der Schule beigebracht hat.
n.: Welche Rolle spielt der ukrainische Futurismus für Sie?
S.Zh.: Der Futurismus ist unzweifelhaft wichtig – als Ideologie und als poetische Schule. Der ukrainische Futurismus ist sehr interessant, vor allem die Figur seines Begründers Mychajl Semenko. Er ist ein äusserst feiner und tiefer Lyriker, experimentell und innovativ. Zudem ein origineller Ideologe. Insgesamt ist der ukrainische Futurismus wahrscheinlich jene Seite unserer Poesie, die am meisten unterschätzt wird. Man mag ihn nicht, man hat Angst vor ihm, man verzichtet auf ihn. Und das, obwohl Semenko von den Dichtern sogar zur Sowjetzeit, als er komplett verboten gewesen ist, für eine Autorität gehalten wurde. Ich hatte das Glück, mich mit dem letzten Schüler von Semenko zu unterhalten. Er hat in uns jungen Dichtern die Fortsetzung dessen gesehen, was seine Kollegen in den 1920er bis 1930er Jahren gemacht haben und brachte uns (teilweise unverdiente) grosse Sympathie entgegen. Im Grunde hat er mir die Charkiver Literatur jener Zeit eröffnet, einen spannenden historischen Abschnitt.
n.: Was brennt Ihnen aktuell unter den Nägeln?
S.Zh.: Mich interessiert vor allem die Realität um mich herum, ihre Grenzen, ihre Möglichkeiten. Darin liegt sicherlich ein Schatten des Realismus, aber ich denke, man sollte eine solche Literatur nicht im Ernst als realistische bezeichnen.Die Probleme liegen in dem Staat, in der Gesellschaft. Der Staat ist totalitär. Die Gesellschaft ist passiv. Mir gefällt es dabei nicht, dass die Bürger nicht das Bedürfnis haben, ihre Rechte einzufordern. Ich versuche darüber zu sprechen, insofern dies möglich ist.
n.: Sind Sie eine Art literarischer Ethnologe der (Ost-)Ukraine?
S.Zh.: Eher Soziologe. Oder einfach Blogger. Ich führe tatsächlich einen wöchentlichen Blog. Dort schreibe ich die irgendwie bedeutsamen Sachen auf, die mit mir oder um mich herum passieren. So entsteht eine Art Tagebuch. Ich habe zwar nicht vor, es irgendwo zu publizieren, aber die Leute lesen es und reagieren darauf.
n.: Sie haben in Zürich Ihr neues Buch gemeinsam mit Jurko Prochasko präsentiert. Prochasko steht eher für die anachronistisch anmutende Sehnsucht der (West-)Ukraine nach mitteleuropäischer Zugehörigkeit. Sehen Sie sich als Mittel- oder Osteuropäer?
S.Zh.: Nun, ich bin natürlich ein Mensch aus dem Osten. Die Idee Mitteleuropas, die österreichisch-habsburgische Nostalgie und das „Stanislauer Phänomen“ liegen mir fern. Aber ich mag seine Adepten. Die Lesung im Literaturhaus ist dynamisch verlaufen – Jurko spürt und weiss alles sehr gut, das konnte auch gar nicht anders sein. Ich habe eine gute Beziehung zu westukrainischen Autoren und Intellektuellen, ungeachtet der verschiedenen politischen und weltanschaulichen Positionen. Ich denke, uns alle eint die Sprache – in der Ukraine ist die Sprachenfrage bis jetzt ein wichtiger Bestandteil der Selbstidentifikation. Mir scheint, dass in dem Konzept Mitteleuropa mehr Ästhetik als Politik drin ist – ein bewusster Konservatismus, eine speziell durchdachte Taktik der Hermetik. Das kann nach Stil aussehen. Obwohl ich mit Ihnen vollkommen einverstanden bin, dass es anachronistisch ist.
n.: Verfolgen Sie die Rezensionen Ihres neuen Buchs "Erfindung des Jazz im Donbass" in der deutschsprachigen Presse?
S.Zh.: Natürlich interessiert mich die Reaktion der deutschen Kritiker. Obwohl es mir scheint, dass es sich in der Mehrzahl der Fälle nicht so sehr um eine Kritik des Buchs handelt, sondern um eine Reaktion auf die darin beschriebene Realität. Meist lenken die Kritiker ihre Aufmerksamkeit auf den Inhalt, auf eine gewisse „Wildheit“ und Unechtheit unserer Wirklichkeit. Wahrscheinlich erscheint die ukrainische Realität aus der Sicht eines satten und erfolgreichen Schweizers oder Deutschen tatsächlich viel zu exotisch. Für uns ist das alles einfach nur alltäglich. Ich habe kein Interesse daran, Schreckensszenarien über mein Land auszudenken. Aber ich möchte auch nicht die scharfen, unangenehmen Momente vermeiden. Kurzum: Ich glaube, dass die russische und die polnische Literaturkritik besser spürt, was bei uns passiert, und wie das alles seinen Niederschlag in der Literatur findet. Das ist kein Vorwurf gegenüber den Kritikern – einige Dinge sind einfach nicht auf die Entfernung hin zu verstehen. Im Übrigen war mir immer die Präsenz von Ironie bei allem, was ich sage, wichtig. Pathos ist mir überhaupt nicht nah. Vielleicht trägt diese ironische Note beim Schreiben über im Grunde ernste Sachen zur Desorientierung bei. Aber für mich ist es selbstverständlich, die Welt so zu sehen.
n.: Wie würden Sie selbst über "Die Erfindung des Jazz im Donbass" urteilen, ich meine im Vergleich zu Ihren anderen Texten?
S.Zh.: Aus meiner Sicht ist es mein gelungenster Text im Hinblick auf die künstlerischen Verfahren und den gewählten Ton. Ich wollte es genau so schreiben, wie ich es geschrieben habe. Das ist ein wichtiges Gefühl, wenn die Idee ihrer Realisierung entspricht.
n.: Warum taucht "Vorošilovhrad" – im Original der Titel des Buches und der Hauptschauplatz der Handlung – als Stadt gar nicht auf?
S.Zh.: Das ist eine Metapher. Eine Metapher der Erinnerung, der Vergangenheit, des Jenseits. Eine Stadt, die es nicht gibt, ein Land, das es nicht gibt, eine Vergangenheit, die es auch nicht zu geben scheint, welche dich aber nicht loslässt.
n.: Neben der sowjetischen Vergangenheit ist auch die Gegenwart in Ihren Texten sehr präsent. Verbinden Sie Ihre künstlerischen Aktivitäten mit politischem Engagement?
S.Zh.: Politik mache ich nicht, eher würde ich sagen, ich engagiere mich gesellschaftlich. Ich versuche, verschiedene Initiativen zu unterstützen, zuletzt die Bewegung für einen offenen Zugang von Krebspatienten zu Schmerzmitteln. Die Aktion hiess „Schmerzstopp“. Ich habe mich ausserdem der Initiative unserer Rechtschützer angeschlossen, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Fall des nigerianischen Studenten Olaolu Femi lenken. Er wird beschuldigt, vier Ukrainer überfallen zu haben und sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft in Luhans’k. Mit der künstlerischen Tätigkeit hängt das wahrscheinlich gar nicht zusammen. Es ist einfach so, dass wenn man die Möglichkeit hat, eine richtige und notwendige Idee zu unterstützen – warum sollte man es nicht auch tun?
n.: Welche Rolle spielt dabei der Anarchismus?
S.Zh.: Für die Ukraine mit ihrer bedrohlichen Zentralisierung, dem Abgleiten ins Autoritäre und dem mächtigen Druck seitens des Staats ist das sehr aktuell. Wie widersteht man einem Staat, dessen Beziehung zu sich selbst mehr als feindlich ist, einem Staat, dessen einzige Funktion es ist, Steuern einzusammeln und die Macht zu schützen? Daher ist mir der Anarchismus mit seiner Idee der Nichtannahme der staatlichen totalitären Maschinerie wichtig. Generell haben wir im Land eine sehr komplizierte Beziehung zur linken Idee – hier zeigt sich die traurige Erfahrung der kommunistischen Epoche. Wahrscheinlich ist es das, was sich auf jeden Fall verändern wird – so oder so, ich bin der festen Überzeugung, dass es noch viel zu früh ist, die linke Idee abzuschreiben.
n.: Viele Linke werden später konservativ oder sogar rechts. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen dies in 20 Jahren widerfährt?
S.Zh.: Ach, nein, davor habe ich keine Angst. Im Gegenteil, als ich 17 war, fand ich den Nationalismus und rechte Ideen interessant. Vielleicht musste ich da durch. Vielleicht auch nicht.
n.: In "Anarchy in the UKR" träumt der Protagonist davon, dass Huljajpole zum Touristenmekka für Anarchismus-Anhänger wird. Sie haben dort tatsächlich vor einigen Jahren das Machno-Festival ins Leben gerufen.Wie hat es sich entwickelt?
S.Zh.: Das Festival, das Machno gewidmet gewesen ist, hat in seiner Heimat, in dem Städtchen Huljajpole von 2006 bis 2009 stattgefunden. Sein Organisator war der Volksdeputat Oles’ Donij. Ich habe dieses Festival mit allen Mitteln unterstützt, da ich daran interessiert bin, den Namen Machnos zu popularisieren. Das war wohl das grösste Festival der zeitgenössischen Kultur in der Ostukraine. Es gab viele Widersprüche: Ungeachtet dessen, dass das Festival „anarchistisch“ gewesen ist, sind viele junge Nationalisten hingefahren. Ich nehme an, alle waren durch die ukrainische Sprache verbunden und die Idee des Aufstiegs der ukrainischen Kultur. In Wirklichkeit gab es den Anarchismus als solchen dort also gar nicht. Das Denkmal für Machno hat zum Beispiel der damalige Minister des MVD Jurij Lucenko eröffnet. Aber echte Probleme hatte das Festival mit der lokalen Machtstruktur und der Bevölkerung. Die Einheimischen haben die Fremden, ihre Kultur und Ästhetik nicht aufgenommen. Das ist ein sehr ukrainisches Merkmal, vor dem Fremden und vor Veränderungen Angst zu haben und nichts Neues aufzunehmen.
n.: Ist im letzten Jahrzehnt eine Festival-Kultur in der Ukraine entstanden?
S.Zh.: Wir haben im letzten Jahrzehnt einen Festival-Boom gehabt und ja, es hat sich eine ganze Festival-Kultur entwickelt. Im Sommer sind junge Leute von einem Festival zum nächsten gereist. Dabei hat man auch aktiv Schriftsteller dorthin eingeladen. Zum Teil hat es damit zu tun, dass unser Musik- und Literaturmarkt nicht allzu stark entwickelt ist, es gibt insgesamt wenig Auftritte und Konzerte und wenige Aktionen der zeitgenössischen ukrainischen Kultur. Die Festivals kompensieren dies bis zu einem bestimmten Grad. Wenn man von literarischen Festivals spricht, sollte man sich vor allem das Lemberger Herausgeberforum vergegenwärtigen, das seit den frühen 1990er Jahren existiert. Das Forum wird traditionell für das wichtigste literarische Ereignis des Landes gehalten. In den letzten Jahren hat das Festival Meridian Czernowitz sehr laut und ernsthaft auf sich aufmerksam gemacht – auch eine zukunftsträchtige Initiative. Und es gibt noch das Festival Kievskie lavry, das von der bemerkenswerten Zeitschrift Echo organisiert wird. Es ist vielleicht die wichtigste Plattform des ukrainisch-russischen literarischen Dialogs.
n.: Wie sieht die literarische Landschaft in der Ostukraine momentan aus?
S.Zh.: Im Vergleich mit der Westukraine ist sie wohl nicht so dicht. Andererseits transformiert sie sich zu etwas neuem. Ausserdem besteht im Osten ein Nebeneinander von russisch- und ukrainischsprachiger Literatur. Daraus entspringt eine aufregende neue Situation. Ich denke, dass die literarische Landschaft im Osten sich aktiv verändern wird, da ständig neue Namen und neue Plattformen auftauchen. Zudem befinden sich gerade im Osten der Ukraine, in Charkiv, die grössten ukrainischen Verlage.
n.: Welche Autoren aus der Ostukraine sollten ins Deutsche übersetzt werden?
S.Zh.: Lassen Sie mich jene nennen, die noch kaum oder gar nicht übersetzt worden sind: Das sind junge Autoren wie Saško Uškalov, Pablo Korobčuk, Bohdana Matijaš, Oksana Forostina, Oleh Kocarev, Anna Maligon, Anastasia Afanasieva und andere.
n.: In dieser Liste sind ukrainisch- und russischsprachige AutorInnen. Was ist für Sie ukrainische Literatur?
S.Zh.: Für mich ist das die Literatur, die in der Ukraine entstanden ist. Oder die von den Bürgern der Ukraine geschaffen wurde. Die mit der Ukraine verbunden ist. Ich glaube, die Ukrainer verzichten zu leicht und zu unbegründet auf eine grosse kulturelle Ebene, wenn sie sich nur auf das Sprachprinzip verlassen und alles, was z. B. auf Russisch, Polnisch oder Deutsch geschrieben wurde, wegfallen lassen. Ich denke, dass man jemanden wie Gogol’ sowohl als russischen als auch ukrainischen Autor begreifen müsste. Aber ich befürchte, dass viele mit mir da nicht einer Meinung sind.
n.: Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
S.Zh.: Im Moment schreibe ich ein neues Buch. Ich denke, dort wird es Prosa und Lyrik geben. Parallel dazu versuche ich mich als Übersetzer und möchte insbesondere ein Buch mit ausgewählten Gedichten von Paul Celan herausgeben. Ich finde Celan wegen seines Verhältnisses zur Sprache spannend – es ist sehr hart und sehr tief zugleich.
n.: Welche Bedeutung hat jüdische Literatur in der Ukraine?
S.Zh.: Celan ist wichtig vor allem als Dichter, da seine Herkunft mit der Ukraine verbunden ist. Er erinnert an den Mythos des alten Czernowitz, der ein Teil unserer Geschichte und Kultur ist. Aber vor allem ist er ein spannender Dichter.
n.: Ist er noch nicht ins Ukrainische übersetzt worden?
S.Zh.: Ach wo, es gibt viele Übersetzungen, aber sein gesamtes Werk ist nicht übersetzt. Ich möchte mit seinen späten Texten arbeiten. Ich hoffe, ich kann das Buch in diesem Jahr herausgeben.
n.: Treten Sie in Zukunft mit "Sobaki v Kosmose", deren musikalische Begleitung Ihrer Lesungen in Berlin sehr erfolgreich gewesen ist, auch in Zürich auf?
S.Zh.: Schwer zu sagen. Es ist nicht einfach, eine solche Tour durch die Schweiz zu organisieren. Wir treten jetzt viel in der Ukraine auf und haben vor, nach Polen zu fahren. Vielleicht auch nach Deutschland.
n.: Wann sehen wir Sie das nächste Mal im deutschsprachigen Raum?
S.Zh.: Seit Mai bin ich in Zug und beschäftige mich vor allem mit Celan.