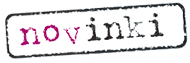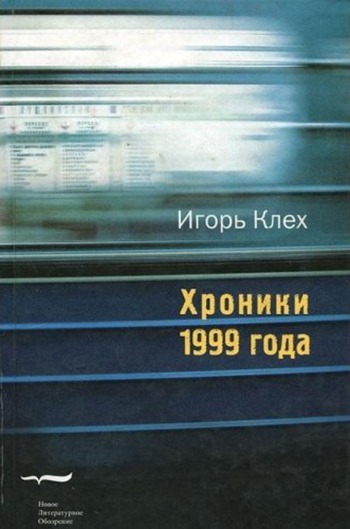 Im Jahr 2009 sind in Russland zwei Bücher von Igor’ Klech erschienen: Eine Sammlung von geopoetischen Kurzerzählungen, Essays und Skizzen unter dem Titel Migracii (Migrationen) und die Chroniki 1999 goda (Chroniken des Jahres 1999). Klech selbst bezeichnet die Chroniken als sein 'Opus Magnum'. Der Länge nach dürfte das stimmen, es ist einer seiner umfangreichsten Texte, der Bedeutung nach vor allem einer der persönlichsten und für sein bisheriges Werk ungewöhnlichsten: Ein Paradebeispiel für Bachtins Chronotopos der Schwelle, ein Krisentext in fragmentierter, aber episch ausholender Form.
Im Jahr 2009 sind in Russland zwei Bücher von Igor’ Klech erschienen: Eine Sammlung von geopoetischen Kurzerzählungen, Essays und Skizzen unter dem Titel Migracii (Migrationen) und die Chroniki 1999 goda (Chroniken des Jahres 1999). Klech selbst bezeichnet die Chroniken als sein 'Opus Magnum'. Der Länge nach dürfte das stimmen, es ist einer seiner umfangreichsten Texte, der Bedeutung nach vor allem einer der persönlichsten und für sein bisheriges Werk ungewöhnlichsten: Ein Paradebeispiel für Bachtins Chronotopos der Schwelle, ein Krisentext in fragmentierter, aber episch ausholender Form.
Klechs größter biografischer Übertritt fand mit seiner Übersiedlung von L’viv nach Moskau Anfang der 1990er Jahre statt. In L’viv hat Igor’ Klech, geb. 1952 in der Ukraine, den größten Teil seines Lebens verbracht, hat dort russische Literatur studiert und als Glasmaler gearbeitet. Obwohl er seit den 1970er Jahren schreibt, können seine Texte erst seit dem Zerfall der Sowjetunion erscheinen. Seit den 1990er Jahren hat er diverse Auszeichnungen und Reisestipendien auch im deutschsprachigen Raum erhalten.
In den Chroniken bewegt sich Klech zwischen Moskau und der Westukraine hin und her. Das Reisen verschafft dem Text zwar ein gliederndes Rückgrat, und der Erzähler reflektiert durchaus über den Zustand beider Staaten; doch eigentlich steht die innere Reise im Vordergrund. In Erinnerungen, Kontemplationen und Berichten springt Klech zwischen dem sowjetischen und einem postsowjetischen Leben, Galizien und Moskau sowie zwischen der Geschichte der Familie, in die der Ich-Erzähler hineingeboren wurde, und derjenigen, die er selbst gegründet hat.
 Dass Igor’ Klech Essayist ist, äußert sich kontinuierlich. Die Chroniken ließen sich gut als ein durchkomponierter Lang-Essay oder als Montage von Einzelskizzen bezeichnen, wenn diese Hommage an den Übergangszustand nicht mit dokumental’naja povest’ (dokumentarische Erzählung) untertitelt wäre. Werden hier Dokumentionen aneinandergereiht oder wird primär eine, wenn auch differenziert allegorisierte, Geschichte erzählt? Zum Glück entscheidet sich der Text nicht und hält dadurch die Grundspannung zwischen individuellen Mikrogeschichten und Rückschlüssen auf eine ukrainisch-russische Makrogeschichte aufrecht.
Dass Igor’ Klech Essayist ist, äußert sich kontinuierlich. Die Chroniken ließen sich gut als ein durchkomponierter Lang-Essay oder als Montage von Einzelskizzen bezeichnen, wenn diese Hommage an den Übergangszustand nicht mit dokumental’naja povest’ (dokumentarische Erzählung) untertitelt wäre. Werden hier Dokumentionen aneinandergereiht oder wird primär eine, wenn auch differenziert allegorisierte, Geschichte erzählt? Zum Glück entscheidet sich der Text nicht und hält dadurch die Grundspannung zwischen individuellen Mikrogeschichten und Rückschlüssen auf eine ukrainisch-russische Makrogeschichte aufrecht.Vor allem die reproduzierten Aufzeichnungen seiner Verwandten fransen den Erzählverlauf aus, relativieren seine Dramaturgie und geben verblüffende Einblicke in eine sowjetische Familiengeschichte. Ein Ausschnitt aus dem Arbeitsheft der Großmutter, das sie 1955 über die „Arbeit im Garten und Haus“ im ostukrainischen Slavjansk bis zu ihrem Tod führte, listet unter der Überschrift Anleitung zur Herstellung des Gartens Eden eine beinah idyllische Akkumulation sowjetischer Wohlstandsattribute auf. Dieser Paradieskonstruktion steht das Tagebuch der Tante im 'Genre der alternativen Geschichte' entgegen: Es registriert, wie sie als junge Mutter den Zweiten Weltkrieg überlebte.
Das Projekt der 'kleinen Geschichten', das zufällige Aufzeichnen von Stimmen, die Betonung des Authentischen und das scheinbare Zurücktreten des Erzählers erinnern an andere Beispiele dokumentarischer Prosa, an fiktionale 'Materialsammlungen' oder literarische 'oral history'. Im westukrainischen Kontext wären da Taras Prochas’kos Daraus lassen sich ein paar Erzählungen machen (dt. 2009) und im russischen Natal’ja Ključarėvas Endstation Russland (dt. 2010) zu nennen. Der Titel der Chroniken lässt – auch wegen des Genremixes – seinerseits an die altslawische Tradition der Chroniken denken und das Verfahren der 'Inventarisierung' an die deutsche Krisenliteratur des Kahlschlags. Was die Besonderheit von Klechs Textformat ausmacht, ist, ungeachtet der latenten Erwartung, das Fehlen eines Heilsplans, die multiperspektivische Pluralität und die präsente, sich immer wieder neu positionierende Erzählerfigur.
 Der Ich-Erzähler nimmt sich vor, einen Bericht abzuliefern – er berichtet auch, jedoch demonstrativ ohne die Ereignisse auszuwählen und zu sortieren. In einem Schwellenjahr, das eine ungewisse Zukunft mit sich bringt, scheinen alle Vorfälle gleichermaßen aussagekräftig und antizipatorisch, gar symbolisch zu sein. Er berichtet mit ungewöhnlicher Nüchternheit und vergleichsweise selten eingesetzten rhetorischen Kniffen: über das Sterben seiner Mutter, über sein Leben in der Westukraine, das er aufgegeben hat, über sein Leben in Moskau, über seine Glasmalerkollegen in L’viv, die sich betrinken und seine Werkstatt vollpinkeln?, über seine Kollegen in Moskau, die nacheinander wegsterben, über die Nachbarn seiner Eltern in der Ukraine oder über die Nachbarn seiner kleinen Moskauer Wohnung. Persönliche Details mit dem Leser zu teilen, scheint hier Teil einer Haltung zu sein, die die eigene Biographie bereits vor dem Schreiben als eine fingierte und historisierte auffasst. Klechs familiäres Mikrouniversum repräsentiert das postsowjetische Paradigma aus Staatsneugründungen, Umsiedlungen zwischen russischem und ukrainischem Territorium, und dem Aufbrechen ehemals familiär oder staatlich festgefügter Beziehungen.
Der Ich-Erzähler nimmt sich vor, einen Bericht abzuliefern – er berichtet auch, jedoch demonstrativ ohne die Ereignisse auszuwählen und zu sortieren. In einem Schwellenjahr, das eine ungewisse Zukunft mit sich bringt, scheinen alle Vorfälle gleichermaßen aussagekräftig und antizipatorisch, gar symbolisch zu sein. Er berichtet mit ungewöhnlicher Nüchternheit und vergleichsweise selten eingesetzten rhetorischen Kniffen: über das Sterben seiner Mutter, über sein Leben in der Westukraine, das er aufgegeben hat, über sein Leben in Moskau, über seine Glasmalerkollegen in L’viv, die sich betrinken und seine Werkstatt vollpinkeln?, über seine Kollegen in Moskau, die nacheinander wegsterben, über die Nachbarn seiner Eltern in der Ukraine oder über die Nachbarn seiner kleinen Moskauer Wohnung. Persönliche Details mit dem Leser zu teilen, scheint hier Teil einer Haltung zu sein, die die eigene Biographie bereits vor dem Schreiben als eine fingierte und historisierte auffasst. Klechs familiäres Mikrouniversum repräsentiert das postsowjetische Paradigma aus Staatsneugründungen, Umsiedlungen zwischen russischem und ukrainischem Territorium, und dem Aufbrechen ehemals familiär oder staatlich festgefügter Beziehungen.Besonders auffällig steht die eigene Existenzangst vor der unmittelbaren Zukunft im Vordergrund. Entblößend, in einem Aufrichtigkeitsgestus, der zu stark für eine rein selbstbezogene Besorgnis und zu schwach für ein begründetes politisches Statement ist, äußert der Erzähler seine Bedenken über die innen- und außenpolitischen Entscheidungen des Kremls.
Die Beobachtung der Schriftstellerwerdung bezieht auch die nachträgliche Betrachtung seiner Schreibsituation im Jahr 1999 ein. Er findet zufällig sein Aufnahmegerät mit einer Erzählung eines verstorbenen Huzulen, welcher offensichtlich in der Erzählung Chutor vo vselennoj (Das Gehöft im Weltall ) auftaucht. Klech lässt außerdem Revue passieren, wie er für die Zeitschrift GEO mit der Transsibirischen Eisenbahn durchs Land gefahren ist, und erlaubt sich in diesem Paratext, seinen damaligen Zustand auf der 'geographischen Pilgerreise' zu psychologisieren. Die innere Bewegung auf der Reise, auf welcher er halluzinatorisch mit seiner Kindheit in Berührung kommt, bildet ein Glied in einer Kette von kleineren und größeren Erschütterungen, die der Erzähler seismographiert. Verwandte, Bekannte, Freunde kommen beinahe oder endgültig ums Leben, Brände, Anschläge, die Willkür der Polizei stehen unvermittelt neben der Willkür des Glücks, eine Prämie für die beste Erzählung des Jahres Psy Poles’ja(Die Hunde von Polesje) zu erhalten.
 Am genauesten beobachtet und dokumentiert er die Geschichte vom Tod seiner Mutter. Therapeutisch könnte man diese Ich-Erzählerposition nennen, aber auch all- und besserwissend. Die Distanzsuche zum Tod der Mutter schließt Urteile über das eigene 'Erwachsenwerden' ein, sie stellt aber auch eine Art kontrollierten Verdrängungsprozess dar, denn der Nachgesang auf das problematische Verhältnis des Erzähler-Ichs zur Mutter, aber auch zum Vater und dem Rest der Familie, macht Platz für nostalgische, warme und zynische Nekrologe, Abrechnungen und Verabschiedungen. Die Porträts der Familienmitglieder gleichen denen der Schriftstellerkollegen, und auch der Dualismus zwischen den beiden Ländern, in welchen er sich aufhält, der Russischen Föderation und der unabhängigen Ukraine, hebt sich auf: Auch wenn die Chroniken Moskau zum Lebensmittelpunkt des Protagonisten und zum Entstehungsort des Textes machen, thematisieren sie seine innere Distanz zur russischen Hauptstadt auf ähnliche Weise wie jene zur Ukraine, welche er Anfang der 1990er verlassen hat und die er Ende der 1990er wieder besucht. Ihn befremden die Umbenennungen der Stadt seiner Kindheit (die er in der früheren Erzählung Svetoprestavlenie (Der Jüngste Tag) konserviert hat, wie die der Puškinstraße in die Čornovil-Straße und der Geburtsklinik in das „Vorkarpatische Zentrum für Menschenreproduktion“ (Prykarpats’kyj centr reprodukciï ljudyny). Die Bemerkungen über L’viv klingen wie ein Nekrolog auf die Stadt, was ein weiteres Autozitat ist, wenn man sich Klechs zum Teil polemische L’viv- und Galizienessays vergegenwärtigt.
Am genauesten beobachtet und dokumentiert er die Geschichte vom Tod seiner Mutter. Therapeutisch könnte man diese Ich-Erzählerposition nennen, aber auch all- und besserwissend. Die Distanzsuche zum Tod der Mutter schließt Urteile über das eigene 'Erwachsenwerden' ein, sie stellt aber auch eine Art kontrollierten Verdrängungsprozess dar, denn der Nachgesang auf das problematische Verhältnis des Erzähler-Ichs zur Mutter, aber auch zum Vater und dem Rest der Familie, macht Platz für nostalgische, warme und zynische Nekrologe, Abrechnungen und Verabschiedungen. Die Porträts der Familienmitglieder gleichen denen der Schriftstellerkollegen, und auch der Dualismus zwischen den beiden Ländern, in welchen er sich aufhält, der Russischen Föderation und der unabhängigen Ukraine, hebt sich auf: Auch wenn die Chroniken Moskau zum Lebensmittelpunkt des Protagonisten und zum Entstehungsort des Textes machen, thematisieren sie seine innere Distanz zur russischen Hauptstadt auf ähnliche Weise wie jene zur Ukraine, welche er Anfang der 1990er verlassen hat und die er Ende der 1990er wieder besucht. Ihn befremden die Umbenennungen der Stadt seiner Kindheit (die er in der früheren Erzählung Svetoprestavlenie (Der Jüngste Tag) konserviert hat, wie die der Puškinstraße in die Čornovil-Straße und der Geburtsklinik in das „Vorkarpatische Zentrum für Menschenreproduktion“ (Prykarpats’kyj centr reprodukciï ljudyny). Die Bemerkungen über L’viv klingen wie ein Nekrolog auf die Stadt, was ein weiteres Autozitat ist, wenn man sich Klechs zum Teil polemische L’viv- und Galizienessays vergegenwärtigt.Wovon der Text sich eindeutig distanziert ist jedoch weniger der Raum (den der Ukraine vermischt er in der a-chronologischen Struktur geradezu mit dem russischen), sondern die Zeit vor 1999. Dazu gehören auch die ehemalige Familie und die jungen Menschen, die in der Vergangenheit wie in einem „abgetrennten Zugwagen“ sitzen geblieben seien.
 Der Erzähler schwankt zwischen Selbststilisierung der eigenen Künstlerbiografie und Protokollierung eines Existenzkampfs. Diverse Künstler- und Schriftstellerpersönlichkeiten der literarischen Szene in L’viv und insbesondere in Moskau ziehen als Nebenfiguren am Erzähler-Protagonisten vorbei, der ihnen nicht nur Lobreden hinterher wirft. Die Suche nach einem Platz als Schriftsteller im Moskauer Intellektuellenmilieu verläuft parallel zum Prozess der bürokratischen 'naturalizacija', der alles andere als organisch und reibungslos vonstattengeht. Das Auswechseln der ukrainischen gegen die russische Staatsbürgerschaft ist eine Nebenfront des Hauptnarrativs, welches sich offensichtlich um das Erlangen einer endgültigen Unabhängigkeit von familiären, sozialen und staatlichen Bedingungen und dem konsequenten Durchleben eigener Entscheidungen dreht.
Der Erzähler schwankt zwischen Selbststilisierung der eigenen Künstlerbiografie und Protokollierung eines Existenzkampfs. Diverse Künstler- und Schriftstellerpersönlichkeiten der literarischen Szene in L’viv und insbesondere in Moskau ziehen als Nebenfiguren am Erzähler-Protagonisten vorbei, der ihnen nicht nur Lobreden hinterher wirft. Die Suche nach einem Platz als Schriftsteller im Moskauer Intellektuellenmilieu verläuft parallel zum Prozess der bürokratischen 'naturalizacija', der alles andere als organisch und reibungslos vonstattengeht. Das Auswechseln der ukrainischen gegen die russische Staatsbürgerschaft ist eine Nebenfront des Hauptnarrativs, welches sich offensichtlich um das Erlangen einer endgültigen Unabhängigkeit von familiären, sozialen und staatlichen Bedingungen und dem konsequenten Durchleben eigener Entscheidungen dreht.
Der Bericht über den Schöpfungsprozess, das Arbeitstagebuch und Trinkprotokoll ergeben zusammen genommen eine ausgestellte Chronik des eigenen Lebenskunstprojekts. Der private Kosmos mag in seiner hermetischen Werteskala irritieren, die Aktualisierung der Hoffnung auf ein neues Russland vermag ein Jahrzehnt nach dem Übergang ins neue Jahrtausend nur ein Schulterzucken auszulösen und die politisierten Äußerungen wirken mit übertriebener Bedeutungsschwere aufgeladen. Die letztlich mutige Positionierungsrhetorik kann im Sinne eines verantwortungsvollen Aushandelns der individuellen und im übertragenen Sinn nationalen Selbstwerdung verstanden werden, und zwar sowohl der ukrainischen als auch der russischen – ohne Entweder-Oder.
Igor’ Klech: Chroniki 1999 goda. Moskva: NLO, 2009.