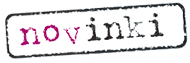2019 erscheint in Russland der Kriegsfilm „Secret Weapon“. Er macht vieles anders als herkömmliche Kriegsfilme und vieles nicht. Man möchte ihn als Satire lesen. Ob das gerechtfertigt ist?
Satire greift das Etablierte an. In Übertreibungsgesten bohrt sie sich ins festgesessene Fleisch der Politik oder will süffisant und bissig zeigen, was die Gesellschaft krank macht. Satire, so Tucholsky, kämpft gegen das Schlechte. Mit ihr werden Personen und Erscheinungen in der Zeitgeschichte lächerlich gemacht, immer heiter und gern ohne Tabus. Das sogenannte „Schlechte“ wird künstlerisch verfremdet, manchmal ins Gegenteil verkehrt, dann wieder zugespitzt.
Das 30. Filmfestival Cottbus zeigte in der Sektion „Close Up WW II“ eigentlich solche Filme, die zum Nachdenken anregen wollen. Anti-Kriegs-Filme wie Dylda (2019) von Kantemir Balagov oder satirisch angehauchte Streifen wie Quentin Tarantinos Inglorious Basterds (2009). Doch auch Kriegsfilme des Mainstream-Kinos tauchen auf, etwa der Actionkriegsfilm Ržev (2019) von Igor Kopylov aus Russland. Dabei wird man das Gefühl nicht los, dass der Hyperrealismus im populären Kriegsfilm zum Standard geworden ist. Hektisch huschen pixelfreie Bilder über den Bildschirm, das Auge zittert von den vielen Szenenwechseln; jede schmerzverzerrte Stirnfalte der Soldaten, jedes Gedärm, jede Träne, die den zurückgebliebenen Frauen von den Wangen rinnen, ist ausgeleuchtet, um anzuregen, mitzureißen. Das Gefühl der Gegenwart: Man ist überall dabei, nie wirklich ganz, nirgendwo von Dauer. Auch in modernen amerikanischen Filmen wie Hacksaw Ridge oder American Sniper verschmelzen hyperrealistische Kriegsszenen mit schicksalhaftem Patriotismus, Martial-Arts und Melodram – jetzt kann man sich durchaus fragen, ob das eine wirklich ohne das andere geht. Seit Erscheinen dieser populären Kriegsfilme ist die Welt leider kein besserer Ort geworden. Und auch keine Welt ohne Krieg, obwohl es diese Filme gab, die uns auf dessen Sinnlosigkeit aufmerksam machen wollten. Doch womöglich wollten sie das gar nicht. Will es vielleicht der Film Secret Weapon?
Secret Weapon, im russischen Original Prikaz „Uničtožit‘“ (Vernichtungsbefehl), kam 2019 unter Regie von Konstantin Statskij in die Kinos. Wer da in den Sesseln saß, wurde Zeuge von etwas, das man seit Kampffilm – und Abenteuerklassikern wie McGiver oder Indiana Jones nicht mehr gesehen hatte: Ein richtiger Vorspann! Fernglasperspektiven, kämpfende und um ihr Leben rennende Soldat_innen. Explosionen, Morsezeichen. Darauf die erste Szene, man sieht ein Bett, daneben ausgelatschte Schuhe ohne Schnürsenkel. Protagonist des Films, der ausrangierte Staatssicherheitsagent Ermakov, wird aus seiner Zelle geholt und in den Verhörraum gebracht. Er schaut sehr trotzig nach links, dann überaus traurig nach rechts. Es fehlt eigentlich nur noch ein melodramatisches Seufzen, um zu zeigen, hier ist jemand unzufrieden mit seiner Situation. Wird im Theater gegen die Herstellung von Unmittelbarkeit und das kompromisslose Eintauchen ins Stück gespielt, dann in dieser Art Überzeichnung. Die Brecht’sche Verfremdung zielt auf distanzierte Betrachtung. Wird also auch hier eine übertriebene Spielweise ausgestellt, wie sie in Kriegsfilmen üblich ist? „Krieg ich denn keine Umarmung?“, fragt der Offizier gekünstelt. „Eine Umarmung. Wirklich, mit dem Staatsfeind?“ antwortet Ermakov in larmoyanten Ton. „Hören Sie auf“, darauf der Offizier. „Es gibt eine Mission für Sie.“

Der Zweite Weltkrieg ist im Gange. Die Sowjetunion wurde überfallen, Deutschland hat den Hitler-Stalin-Pakt gebrochen. Ermakov bekommt die Chance durch die Befreiung einer Geheimwaffe aus den Händen der Nationalsozialisten dem sowjetischen Vaterland doch noch seine Loyalität zu beweisen. Ob er wohl die Politik Stalins kritisierte und deswegen im Gefängnis sitzt? Egal, der Plot muss weitergehen. Die Kriegswaffe Katjuša, auch Stalinorgel genannt, war in einem vorhergehenden Gefecht in die Hände der Feinde geraten. Ohne Zusicherung auf darauffolgende Absolution sagt Ermakov zu.
Er bekommt eine Spezialeinheit zugewiesen, alle Soldat_innen die Besten in ihrem Fach. Da ist etwa Galiev, Kommandant der Truppe, und Belous, Absolvent der Moskauer Sporthochschule und Meister der Sambo-Kampfsportkunst. Es gibt Knyš, den Boxer, der „tödliche Schläge mit beiden Händen“ verteilt, oder Subbotina, eine Bogenschützin und Juristin. „Irgendwelche Funker dabei?“, fragt Ermakov. „Das beherrschen alle von ihnen.“ Also geht es los, die Geheimwaffe befreien.
Bereits im Flugzeug funken sich Galiev und Subbotina mit den Augen an. Ihre Liebe wird in einer tragischen Diagonale zwischen Sandsäcken enden – aber alles zu seiner Zeit. Die Spezialeinheit wird über besetztem Gebiet abgeworfen und reißt gleich die Nationalsozialisten aus dem Schlaf. Der glorreiche Beginn eines kampfträchtigen Katz- und Maus-Spiels, bei dem mehr schief geht, als glatt. Immerhin lassen die Aufnahmen von saftigen Waldböden, wilde Kamerarundfahrten und Point-of-View-Perspektiven Computerspiel-Liebhabende auf ihre Kosten kommen. Das Licht des Films ist weich gehalten. Alles ist sichtbar und etwas zu hell. Üblicherweise werden romantische Komödien oder Seifenopern in diesem High-Key-Stil gedreht. In Deutschland kennt man ihn aus Vorabend-Serien wie Rote Rosen oder Sturm der Liebe. Doch offenbar geht damit auch Kriegsfilm. Vielleicht soll ja der High-Key-Filter eine satirische Antithese zum Hyperrealismus sein? Vielleicht will damit bewusst auf die Verzweigung von Seifenoper und Gefechtsspektakel hingewiesen werden. Auch der mit Fallschirm im Baum verhedderte Soldat, der kurz darauf wie ein Igel einen Sandhügel herunterkullert, ist doch so tollpatschig, dass Bewegung ins Gesicht der Zuschauer_innen kommt. Wird mit dieser Art Scherz der kriegerische Mensch lächerlich gemacht? Schon mit dem Vorspann wurde ja bereits die gesamte Tradition des Mediums Kampf- und Kriegsfilm hopsgenommen. Oder? Ist das jetzt Satire? Oder kann das weg?
Kurt Tucholsky schrieb 1912: „Der Satiriker kann nicht wägen – er muss schlagen.“ Satire würde demnach nicht andeutungsweise hinterfragen, sondern konkret und kompromisslos etablierte Gesellschaftsbilder kritisieren. Secret Weapon hat inhaltlich eindeutig die Bedeutung der Familie zum Gegenstand. Neben der sowjetischen Großfamilie, die den Soldat_innen den notwendigen Rückenwind verschafft, steht auch das Konzept Kleinfamilie im Scheinwerferlicht des Films. Galiev und Subbotina etwa, die von Anfang an buchstäblich die Augen aufeinander geworfen hatten, diskutieren geduckt im Gras die Bedeutung der Ehe. Und Subbotina stellt geradeheraus und durchaus kritisch klar: „Der Trauring ist Zeichen eines bürgerlichen Anachronismus.“ Doch was als überraschende Kritik am Traditionalismus beginnt, endet kurze Zeit später in einer Sequenz mit ihr und Galiev zwischen Sandsäcken, umstellt. In einer letzten pathetischen Geste streckt er seinen Arm zu ihr aus; in seiner Hand eine Handgranate, deren Ring einen Trauring simuliert. Subbotina zögert nicht lang. Sie hält ihren Ringfinger hin. Ein letzter, tiefer schicksalhafter Blick in die Augen und sie sprengen sich in die Luft. Das nennt man wohl Lieben und Sterben in Zeiten des romantischen Märtyrertodes. Oder: Besser verheiratet in den Tod, als Single im Himmel. Mit Secret Weapon ist es wie mit diesen Witzen, über die man erst lacht und dann beschämt die Hand vor die Augen schlägt, weil sie so leer sind. Was anfangs noch satirisch wirkte, kippt bei genauerem Hinsehen in das komplette Gegenteil. Die vagen Unklarheiten von Slapstick-Komödie und Betroffenheitsgesten machen den Film zu einer weiteren, infantilen Kriegsverharmlosung, die unterhalten will und nationalistisches Begehren (re)produziert, während und indem Menschen sterben. Denn opferbereit, scheinbar jeglicher Egozentrik entledigt, handeln die Soldat_innen stets im Rahmen eines staatlichen Moralismus, der sagt: Man ist erst vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, wenn man bereit ist, für sie zu sterben. Die „Befreiung“ der Geheimwaffe aus Feindeshand ist Gemeinschaftsaufgabe. Darin inszeniert der Film unermüdlich den Sinn des Kampfes; in der großen Gemeinschaft, der entfernten Familie. Es geht um den heroischen Schutz des Eigenen, des geliebten Landes, der Rettung der Welt durch das Militär. So auch in einer weiteren Szene, als eine junge Jüdin von herumstreifenden Männern vergewaltigt werden soll. Bevor es zum Schlimmsten kommt, wird sie von einem Soldaten der Spezialeinheit befreit – sie verliebt sich natürlich gleich in ihn. Der Mann als Retter, die Frau als Bedürftige, das kennt man ja. Über den Körper der Frau gesellschaftliche Ansprüche von Gut und Böse zu verhandeln, das kennt man leider auch. Lehnt man sich im heutigen Russland tatsächlich gegen patriarchale Familienstrukturen auf, kann das verheerend ausgehen. Der Regisseurin Julija Cvetkova (Yulia Tsvetkova) drohen derzeit sechs Jahre Haft wegen ihres politisch engagierten Theaters. Das von ihr gegründete Kinder- und Jugendtheater Merak war geschlossen worden, weil ihr vorgeworfen wurde, „nicht-traditionelle Familienwerte unter Minderjährigen zu verbreiten“. Ihre comicesken Zeichnungen, wegen derer sie bereits unter Hausarrest stand, zeigen weibliche Körper aus einer feministischen Perspektive. Sie sind dick, behaart und schön. Gute Satire würde gegen staatliche Repressionen, wie sie Cvetkova derzeit durch die Regierung Putins erlebt, lauthals anschreien. Secret Weapon krächzt leise in einer weit entfernten Ecke davon sein kitschiges Kriegslied.
Am Ende des Films wird die Kriegswaffe befreit und vernichtet. Alle sterben, außer die Jüdin und der Soldat. Sie reiten am Rand eines saftigen Feldes dem Horizont und, dank sei den gestorbenen Soldat_innen, einer gewissen Zukunft entgegen. Es ist das rührselige Ende eines weiteren Kriegsfilms, der nicht aufrütteln, sondern unterhalten will. Man war überall dabei, nirgendwo von Dauer und nie wirklich ganz. Problem ist seine politische Haltungslosigkeit, die wegen der ästhetischen und effektheischenden Aufmachung in Kriegsverherrlichung kippt. Im Lexikon der Filmbegriffe steht passend dazu als gut gelaunter Schlusssatz zum High-Key-Filter: Er wird angewandt, um zu zeigen, dass etwas gut ausgeht. „Er betont im allgemeinen Glück, Gelingen, Hoffnung und frohe Zuversicht.“