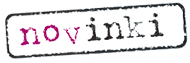Ein Interview mit Sabine Hänsgen
Dank der langjährigen dokumentarischen und editorischen Arbeit von Sabine Hänsgen ist die Kunst der Moskauer Konzeptualisten heute in Ausstellungen zu sehen. Für ihre leidenschaftliche und zugleich bedachte Kulturvermittlung zwischen Ost und West wurde die Kulturwissenschaftlerin 2012 in Warschau mit einem Arbeitsstipendium des Igor Zabel Awards für Kultur und Theorie ausgezeichnet. Im Interview mit novinki spricht S.H. über den russischen Underground der 1980er Jahre und ihre Erlebnisse in Ost und West.

novinki: 1984, als noch niemand an das Ende der Sowjetunion geglaubt hat, haben Sie als Studentin heimlich die Videodokumentation „Moskau Moskau“ über russische Underground-Künstler gedreht und in den Westen geschmuggelt. Das war sicher spannend für Sie. Aber war das nicht auch sehr riskant?
Sabine Hänsgen: Ja, aus sowjetischer Sicht war das eine verbotene Handlung. Ich hätte des Landes verwiesen werden und ein Einreiseverbot erhalten können. Aber schon Anfang der achtziger Jahre, als ich in Moskau studierte, hatte ich gespürt, dass die künstlerische Szene von Verbot, Verdrängung und Vernichtung bedroht war. Ich hielt es darum für wichtig, genau dieses Leben zu dokumentieren. Ich hatte damals viele Underground-Künstler aus dem Konzeptualistenkreis kennengelernt. Mir ging es bei meiner zweiten Reise auch darum, dieses künstlerische Leben, diese Art der Kommunikation ausserhalb der offiziellen sowjetischen Kunstszene festzuhalten. Video ist für mich grundsätzlich ein besonders geeignetes Medium, um Situationen, die von einer staatlichen Gedächtnispolitik ausgeschlossen werden, zu archivieren.
n.: Wie sind Sie damals an eine Kamera gekommen? Zu der Zeit war eine private Videokamera eine Rarität, besonders in der Sowjetunion.
S.H.: Bei meinem zweiten Moskau-Aufenthalt hatte ich eine Blaupunkt VHS Kamera dabei. Als wir in Brest an der weissrussischen Grenze ankamen, war ich die einzige, die aus dem Zug aussteigen und sich lange erklären und rechtfertigen musste. Da ich aber mit einem Stipendium an die Staatliche Filmhochschule (VGIK) fuhr und das auch in meinen Dokumenten stand, habe ich es geschafft, die Kamera doch mitzunehmen.
n.: Was genau hat Sie an den Moskauer Konzeptualisten fasziniert? Sie kommen aus einem ganz anderen Kulturraum, dennoch begegnen Sie dieser Kunst mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit.
S.H.: Für mich war diese besondere Art der Dichtung, der Performance und der bildenden Kunst nichts Exotisches, weil ich sie mit Erfahrungen in meiner eigenen Kultur in Verbindung bringen konnte. Die konkrete und visuelle Poesie erfuhr Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre in Westdeutschland recht grosse Aufmerksamkeit, zum Beispiel gab es in Bielefeld das Colloquium Neue Poesie, wo Dichter aus verschiedenen Ländern auftraten. Die sowjetischen Dichter haben in Bielefeld allerdings gefehlt, sie konnten nicht ausreisen. Es war nur Valeri Scherstjanoi dabei, der in die DDR umgesiedelt war. Auch Fluxus und John Cage, den ich im WDR Hörspielstudio erlebt hatte, interessierten mich sehr. Mir ging es weniger darum, in der inoffiziellen sowjetischen Kunst etwas Anderes zu finden, sondern eher das Ähnliche im Unähnlichen oder das Unähnliche im Ähnlichen zu entdecken.
n.: Was meinen Sie damit konkret?
S.H.: In der Nachkriegszeit stellte sich die Frage nach der Aufarbeitung der Erfahrungen in den totalitären Kulturen. Für Künstler stand dabei im Vordergrund, wie sie ihre Sprache, die vom System vereinnahmt worden war, von diesem ideologischen Ballast befreien konnten. Das machten sie, indem sie die Sprache zum Beispiel auf ihre Materialität, also Laute und Buchstaben, zurückführten. Dabei ging es ihnen einerseits darum festzustellen, wie sehr sie selber unbewusst diese Ideologie verinnerlicht hatten, aber anderseits auch ein Teil von ihr waren. Kennzeichnend war die Selbstreflexion der Künstler über ihre eigene Involviertheit in das totalitäre Sprachsystem. Gerade im Kulturvergleich zwischen Deutschland und Russland war es für mich spannend, sich auf ästhetische Weise mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen und dabei mit bestimmten Sprachverwendungen konfrontiert zu sein.
n.: Haben Sie deshalb mitten im Kalten Krieg Slavistik studiert?
S.H.: Für mich und viele andere Slavisten meiner Generation war wohl so etwas wie eine politisch-existenzielle Motivation für die Wahl dieses Studiums ausschlaggebend. Mein Vater war in Russland im Krieg gewesen, sein Bruder war bei Stalingrad gefallen und meine Mutter ist mit einem der letzten Schiffe aus Pommern geflüchtet. Diese traumatischen Erfahrungen haben meine Eltern an mich weitergegeben. Ich bin in Düsseldorf geboren und meine Kindheit und Jugend waren durch eine starke Westorientierung geprägt: Schüleraustausch mit England und Frankreich, Freizeit in Holland. Aber die Traumata meiner Familie, die die Beziehung zwischen Deutschland und Russland betreffen, wirkten bei mir nach, und das Slavistikstudium war für mich eine Möglichkeit, mich diesem Komplex zu stellen.
n.: Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie Slavistik und Russisch studieren wollten?
S.H.: (lacht) Das war schon eine gewisse Provokation… Beide hatten eine ambivalente Haltung dazu: Einerseits wollten sie es nicht so genau wissen, andererseits haben sie sich doch immer wieder dafür interessiert.
n.: Wie sind Sie dann mit der alltäglichen Verdrängung in der sowjetischen Wirklichkeit fertig geworden?
S.H.: Wir hatten es damals in der Sowjetunion mit einer schizophrenen, gespaltenen Kultur zu tun. Auf der einen Seite gab es die offizielle staatliche Kultur und auf der anderen die inoffizielle Konzeptualistenszene als eine Zirkelkultur. Diese schizophrene Gespaltenheit hatte ich so vorher noch nicht erfahren. In der Sphäre, in der ich mich bewegte, war das deutlich zu spüren. Mit meinen Mentoren an der Universität – also einer staatlichen offiziellen Institution – kommunizierte ich in der offiziellen sowjetischen Sprache. Aber es war wohl auch den Professoren klar, dass wir in leeren Worten redeten. Ganz anders war das mit den Freunden aus der inoffiziellen Kunstszene. Es gab also ein Doublespeak, und das war sehr kennzeichnend.
n.: Haben Sie als Studentin die staatliche Kontrolle gespürt?
S.H.: Es war eine Situation, in der nichts jenseits der Zensur veröffentlicht werden sollte. Insbesondere Medien der technischen Reproduktion wurden strikt kontrolliert, sogar neben jedem Fotokopierer stand ein Milizionär (russ. Polizist, red.). Da war der Zugang zu einer privaten Videokamera erst recht nicht gegeben.
n.: Das ist für uns heute unvorstellbar. Stichwort Milizionär – die schillernde Heldengestalt in den Gedichten und Performances von Dmitrij Prigov. Sie haben mit Ihrer Kamera Dmitrij Prigov – einen der bedeutendsten Konzeptualisten – bei seinen berühmten Milizionär-Lesungen aufgenommen. Wie ist Ihr Kontakt zu diesem Undergroundkünstler entstanden?
S.H.: Da die inoffizielle Kultur eine hermetisch geschlossene Zirkelkultur war, reichte es aus, eine Person zu kennen, von dieser akzeptiert und an die anderen weiterempfohlen zu werden. Zum ersten Mal kam ich durch eine Kommilitonin in diesen Kreis. Sie stammte aus Paris und war Botin für die Kunstzeitschrift А – Я. Diese Zeitschrift publizierte damals in Paris und New York erstmalig die Werke russischer Undergroundkünstler und machte es überhaupt möglich, dass diese von einem breiteren Publikum wahrgenommen wurden. Meine Kommilitonin sollte den Künstlern etwas übergeben oder auch Materialien von ihnen nach Paris schicken. Nach dem ersten Treffen bekam ich regelmässig Informationen über Wohnungsausstellungen, Diskussionen, Performances oder Dichterlesungen. All das wurde mündlich weitergegeben, ich rief auch Freunde an, um zu erfahren, was als nächstes ansteht. Bei einer solchen Veranstaltung in einem Künstleratelier war Dmitrij Prigov an der Reihe. Er trug seinen Freunden das vor, was er neu geschrieben hatte. Prigov war sehr kommunikativ und lud uns sofort zu sich nach Hause nach Beljaevo ein – in sein poetisches und künstlerisches Laboratorium.
n.: Die berühmte Wohnung in Beljaevo.
S.H.: Es stellte sich heraus, dass wir geradezu Nachbarn waren. Sowohl das Puschkin Institut, an dem ich Russisch studierte, wie Prigovs legendäre Wohnung liegen an der Volgin Strasse, fünf bis zehn Minuten voneinander entfernt. Sodass wir uns dann auch häufig gesehen haben.
n.: Das Öffentliche und der Underground lagen also buchstäblich sehr nah bei einander. Hat Dmitrij Prigov sich bereits damals von den anderen Künstlern der Moskauer Konzeptualisten abgehoben?
S.H.: Prigov fiel vor allem dadurch auf, dass er überaus aktiv war: Genauso wie er seine Gedichte nach Plansoll produzierte, so hatte er auch fast nach Plansoll Auftritte in der Szene. Zum anderen war er besonders bekannt, weil er sehr früh ein Image kreierte. In seiner Wohnung las er uns auch den „Milizionär“ vor. Das war eine provozierende und irritierende Selbststilisierung, wenn ein Dichter aus dem Underground in die Rolle eines staatlichen Ordnungshüters schlüpft. Und das hat Aufmerksamkeit erregt.
n.: Diese Aufmerksamkeit konnte aber nur in verborgenen Räumen, am Rande gelebt werden.
S.H.: Ja, es waren typische Situationen häuslicher Lesungen. Dmitrij Prigov konnte zu jener Zeit nicht öffentlich auftreten, da seine konzeptualistische und sozartistische Ästhetik nicht den Normen der sowjetischen Kultur entsprach. Diese Ästhetik entwickelte sich ausserhalb der offiziellen Räume. Zum Beispiel spielte die eigene Wohnung der Künstler eine ganz grosse Rolle – wie auch deren Ateliers oder der Naturraum um Moskau herum.
n.: Wer von den Konzeptualisten hat Sie noch beeindruckt?
S.H.: Es gab extrem unterschiedliche Persönlichkeiten, die alle zu dieser ästhetischen Schule gehörten. Die Gegenfigur zu Prigov war Vsevolod Nekrasov. Er hat mich ebenfalls sehr beeindruckt: Ein minimalistischer Dichter, der die alltägliche Sprache, eine leise, zurückgenommene Rede mit Pausen bis hin zum Schweigen für die Poesie entdeckte. Das war ein starker Kontrast zu einer lauten, pathetischen Rede von der Tribüne aus oder auch zu einer Sprache der politischen Losungen. Ein wichtiger Treffpunkt war das Atelier von Ilja Kabakov. Dort fanden zuweilen auch Dichterlesungen statt oder kleine Konzerte mit Auftritten von Vladimir Tarasov. Kabakov hat dabei auch regelmässig Werke vorgeführt und kommentiert.

Sabine Hänsgen und Dmitrij Prigov hinter der Blaupunkt VHS Kamera, Moskau, 1985
n.: Wie sahen die Diskussionen bei diesen Treffen genau aus?
S.H.: Es ging um ein Zusammenspiel von Text und Kommentar, das im Konzeptualismus generell eine wichtige Rolle spielt. Es wurde ständig kommentiert und diese Gespräche waren ein Teil des Werks. Insofern würde ich von einer Kommunikationsästhetik im Konzeptualismus sprechen. Im Zentrum standen also nicht nur die fertigen Werke, sondern auch die Prozesse der Aufführung, der Diskussion, der Kommentierung dieser Werke. Und hier hat die Videodokumentation ihre Bedeutung. Denn das Video als Medium machte es möglich, diese Kommunikationsprozesse in der Szene zu fixieren und zu erforschen. Die Künstler kommentierten ihr eigenes Werk, auch Prigov, sei es in seinen berühmten Vorbemerkungen oder in Kommentaren im Anschluss an seine Lesungen. Das steckte die anderen an, sich auch in irgendeiner Form zu äussern.
n.: Verstehe ich es richtig, dass die vertraulichen Küchengespräche, die wir von den russischen Dissidentenkünstlern und Intellektuellen kennen, in den konzeptualistischen Zirkeln durch den Diskurs als Teil des Kunstwerks abgelöst wurden?
S.H.: Die Tradition der Küchengespräche würde ich der vorherigen Generation zusprechen, wo das Gespräch als Gespräch funktionierte. In der Konzeptualistenszene handelt es sich vielmehr um eine künstlerische Performance, die immer weitere Kommentare, Deutungen, Interpretationen und theoretische Spekulationen provoziert. Diese gehen in den grösseren Zusammenhang eines Dokumentationskunstwerks ein und bleiben nicht nur als flüchtige Gespräche im Raum, sondern werden Teil des künstlerischen Prozesses.
n.: Den Wunsch, diese Künstlertreffen im Underground zu dokumentieren, haben Sie ja dann verwirklicht. Mit Ihrem Kollegen Georg Witte haben Sie im Westen die multimediale Publikation „Kulturpalast. Neue Moskauer Poesie und Aktionskunst“ veröffentlicht. Warum unter einem Pseudonym?
S.H.: In der Wahl eines Pseudonyms liegt eine gewisse Verschwisterung mit dem Underground. Es war aber zum Teil auch ein Selbstschutz, da wir ja russische Texte aus der inoffiziellen Kultur im Ausland veröffentlichten. Später, zur Zeit der Perestrojka, als die Zensur wegfiel, entwickelte sich dieser Pseudonymgebrauch zum Spiel und die Namen wurden zum Markenzeichen für eine bestimmte Übersetzer- und Herausgebertätigkeit.
n.: Wie haben Sie diese Pseudonyme gewählt?
S.H.: Wir haben sie so gewählt, dass die Namen etwas künstlich wirken: Günter Hirt und Sascha Wonders. Ein germanisch-mythologisch anmutender und ein international klingender Name. Bei meinem Pseudonym – Sascha Wonders – weiss man nicht, welche Nationalität und welches Geschlecht sich dahinter verbergen. Das führte dazu, dass es in den Briefen an mich hiess: „Sehr geehrter Herr Wonders…“. Eine Frau vermutete man dahinter nicht.
n.: Stimmt, im russischen Gebrauch hätte Sascha auch ein weiblicher Name sein können. Hat „Wonders“ auch mit „wundern“ und „anders“ zu tun?
S.H.: Genau. Da gibt es verschiedene Klangassoziationen! Günther Anders ist zum Beispiel ein berühmtes Pseudonym aus dem deutschsprachigen Raum. Man kann aber auch an Stevie Wonder und die Popkultur denken. Also ein schillerndes Pseudonym, auf das ich durch poetische Spielereien gekommen bin (lacht). Es war ein Nebenprodukt der Übersetzungstätigkeit und der Reflexion über offizielle und inoffizielle Kultur, Mainstream und Underground.
n.: Wieso hat Ihre Publikation aus dem Jahr 1984 ein besonderes Format?
S.H.: Wir haben „Kulturpalast“ als Medienkombination aus Buch, Tonkassette, Textobjekt (Kartenserien) in der Edition der S Press in Wuppertal herausgegeben. S Press veröffentlichte damals Künstler der konkreten, visuellen und akustischen Poesie im Westen. Und dies war genau der Kontext, in dem wir die russischen Dichter des Konzeptualismus vorstellen wollten. Das hatte zwei Gründe: Wir wollten diese Ästhetik nicht nur in ein sowjetologisches, slavistisches, sondern in ein internationales Wahrnehmungs- und Rezeptionsfeld hineinbringen. Und insgeheim hofften wir vielleicht auch, einen persönlichen Kontakt zwischen den Künstlern herstellen zu können. Dass es schon bald dazu kommen würde, ahnten wir damals noch nicht. 1989 konnten wir tatsächlich ein deutschsprachig-russisches Poesiefestival „Tut i Tam – Hier und Dort“ in Essen, Moskau und Leningrad organisieren. Da trafen Dichter aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen, die zuvor in der Publikationsplattform zusammengefunden hatten, zum ersten Mal real aufeinander.
n.: Wie fanden die zwei Kunstströmungen konkrete und visuelle Poesie und Konzeptkunst im Westen und im Osten zu ähnlichen Formen, bevor sie miteinander im direkten Kontakt standen?
S.H.: Der Dichter Vsevolod Nekrasov schreibt in einer „Erklärenden Notiz“ zu seinem Werk, dass er im Jahr 1964 über eine Publikation von Übersetzungen Lev Ginzburgs in der „Literaturnaja Gazeta“ (Literaturzeitung) die westliche konkrete und visuelle Poesie kennenlernte. Zu ähnlichen Formen der Poesie habe er aber bereits in den 1950er Jahren gefunden. Nekrasov vertritt die Position, dass es kein Austauschverhältnis zwischen den Kulturen gab, sondern dass es sich um unabhängige Entwicklungen handelte, die allerdings ähnliche historische Gründe hatten.
Die westliche Konzeptkunst war in den Kreisen der russischen inoffiziellen Kultur bereits sehr früh bekannt, und zwar über Bücher, Kataloge und Zeitschriften, die von westlichen Reisenden mitgebracht wurden. Erstaunlicherweise waren einige dieser Publikationen sogar in der Moskauer „Bibliothek für ausländische Literatur“ zugänglich. Und auch hier sollte wieder der Effekt des Ähnlichen im Unähnlichen und des Unähnlichen im Ähnlichen berücksichtigt werden. Unter dem Etikett „Konzeptualismus“, mit dem sich die Künstler selbst in einem internationalen Kontext verorteten, entstanden in Russland Formen der Sprachreflexion, der Thematisierung von Wahrnehmungs- und Rezeptionsbedingungen der Kunst, die sich durchaus von der westlichen Ästhetik unterscheiden und auf eigene kulturelle Traditionen stützen. Der Moskauer Konzeptualismus hat keine abstrakt-sprachanalytische Ausrichtung, hier gibt es viel mehr erzählerische Momente, und auch die Einflüsse von apophatischer Theologie, Zen-Buddhismus und Psychodelik sind sehr stark.
n.: Und wie sah dann das Ähnliche im Unähnlichen aus?
S.H.: S Press war ein Kleinverlag. Obwohl die Verleger so bedeutende Künstler wie John Cage, Fluxus, die Wiener Gruppe veröffentlichten, mussten sie zum Broterwerb anderen Berufen nachgehen. Darin ähnelten sie den Konzeptualisten, die damals im Alltag auch andere Berufe ausübten. Auch hier waren die Auflagen und das Programm sehr klein – am Rande eben. In gewisser Weise erinnern die Publikationsformen an den Samizdat (Selbstverlag red.). Zwar standen hier nicht Manuskripte und Typoskripte im Zentrum, sondern Tonkassetten, aber es ging letztlich auch um ein Veröffentlichen jenseits des klassischen gutenbergschen Drucks. Übrigens befindet sich der Nachlass unseres Hauptverlegers Michael Koehler in Berlin in der Akademie der Künste, und S Press gilt mittlerweile als einer der wichtigsten Sound Poetry Tonverlage der Nachkriegszeit weltweit.
n.: Bei der Kulturvermittlung zwischen unterschiedlichen Ländern und Sprachen hat die Übersetzungstätigkeit einen besonderen Stellenwert. Sie und Georg Witte haben viele Texte der Konzeptualisten dem deutschen Publikum zum ersten Mal näher gebracht. Worum ging es Ihnen bei den Übersetzungen?
S.H.: Für uns war das Übersetzen Teil der Herausgeber- und der Forschungstätigkeit. Es ging uns darum, zu zeigen, dass es nicht nur zwei unterschiedliche Systeme waren, sondern dass es ein Wechselverhältnis zwischen West und Ost gab. Es ging uns um Epochenphänomene, die mit einander vergleichbar waren: konkrete, visuelle Poesie und Konzeptkunst. Insbesondere durch das Übersetzen wird der Vergleichsmassstab zwischen den Kulturen eröffnet. Aber auch als persönliche Erfahrung ist das Übersetzen sehr wichtig, weil man den fremden Text durch sich hindurchlaufen lässt, nachvollzieht und im Nachvollziehen in einer anderen Sprache hervorbringt. Es ist also eine besondere Art der Texterfahrung, die mit dem Übersetzen verbunden ist.
n.: Wie war für Sie die Übersetzung so vieler unterschiedlicher konzeptualistischer Künstler?
S.H.: Das war nicht einfach, aber es war spannend, diese unterschiedlichen Schreibweisen vom Minimalismus bis zur Sozart zu übertragen und damit die ganze Kulturszene vorzustellen. Sich in dieses Spektrum als Übersetzer zu begeben, verschiedene Schreibweisen zu durchlaufen, war faszinierend. Ilja Kabakov beispielsweise war eine richtige Herausforderung, weil er theoretische Texte im mündlichen Skaz formulierte – einem Erzählstil, der mündliche Kommunikation zwischen Erzähler und Leser simuliert. Nach dem Überblick über die Szene haben wir im nächsten Schritt auch Einzelausgaben gemacht, etwa von Dmitrij Prigov, Lev Rubinštejn, Vsevolod Nekrasov. Im „Kulturpalast“, aber auch in anderen unserer Publikationen sind die Gedichte zweisprachig aufgenommen. Gedichte zweisprachig zu veröffentlichen, finde ich bis heute ein wichtiges Prinzip, weil Übersetzungen immer nur Annäherungen an das Original, auch Deutungen und Interpretationen sind.
n.: Zu welchen deutschen Prätexten kann man da als Übersetzerin überhaupt greifen, um eine Annäherung zu schaffen?
S.H.: Bei Lev Rubinštejn war es ein kybernetischer Stil, der durchaus Entsprechungen im Westen hatte. Viel schwieriger waren die Texte von Dmitrij Prigov. Er spielte mit der speziellen Sprachfolie der sowjetischen Kultur, noch dazu in gereimten, metrisch gebundenen Gedichten. Im Deutschen kann diese Form anachronistisch wirken, wenn sie nicht mit dem Blick auf den sowjetischen Hintergrund verstanden wird. Aber wir haben uns trotzdem bemüht, diese Fremdartigkeit zu belassen. Wir haben deswegen den „Milizionär“ bei Prigov nicht nicht als „Polizisten“ übersetzt. Die metrischen, gereimten Verse haben wir auch nicht in freie Verse umgewandelt. Die grosse Frage ist, ob ein westlicher Leser diese Textdimensionen ohne die Hintergrundfolie wahrnehmen kann.
n.: Ich bin in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen, mir war der Hintergrund der sowjetischen Kultur vertraut, darum wirkten die Texte von Dmitrij Prigov auf mich wie eine Art Psychoanalyse des Homo Soveticus. Ich frage mich darum: Wie ist es für den westlichen Leser möglich, gerade Prigovs künstlerische Auseinandersetzung mit der sowjetischen Kultur wahrzunehmen?
S.H.: An Prigov scheiden sich die Geister wohl am meisten. Und zwar nicht nur beim Leser im Westen, sondern auch in der russischen Rezeption. Das habe ich mehrere Male erlebt. Da spielt nicht nur das Hintergrundwissen über die sowjetische Kultur eine Rolle. Bei den literarisch interessierten Lesern gibt es die, welche die metrisch gebundene, gereimte Gedichtform bei Prigov als Stilisierung verstehen. Es gibt aber auch solche Leser, die sie als Anachronismus ablehnen. Die Selbststilisierung als Milizionär irritiert immer wieder aufs Neue, – es wird von manchen bis heute als Tabubruch wahrgenommen, den Underground auf diese Weise mit der staatlichen Macht zusammenzubringen.
n.: Was war bei Ihnen die Triebfeder für diese jahrelange Forschungstätigkeit?
S.H.: Die Erfahrung der konkreten Lebenssituation hatte ich mir so nicht ausmalen können, bevor ich nach Moskau kam. Mich beeindruckte, dass man sich in einer Stadt zwischen den Welten bewegen konnte. Aber auch die Spannung zwischen verschiedenen Emotionen – zwischen Angst und gleichzeitig Hoffnung – setzte etwas in Bewegung. Diese existenzielle Erfahrung war möglicherweise ein Impuls für ein so lange andauerndes Interesse.
n.: Diese persönlichen Erfahrungen in der Konzeptualistenszene führten auch dazu, dass Sie Mitglied der Moskauer Künstlergruppe „Kollektive Aktionen“ wurden. Wie wird man von einer Forscherin zur Künstlerin?
S.H.: Meine Blaupunktkamera hatte auch damit etwas zu tun (lacht). Uns faszinierte damals, dass es in dieser Szene eigentlich keine Konsumenten gab. Alle nahmen mehr oder minder aktiv an diesen Aktionen teil. Die aktive Teilnahme war ein wichtiges Kennzeichen. Das war uns sehr sympathisch im West-Ost-Vergleich. Denn im Westen verlief die Kultur – aus unserer Sicht – stark über den Konsum. Bei den „Kollektiven Aktionen“ stand gerade nicht der Konsum, sondern die Partizipation im Zentrum. Bis heute ist es eine Frage, wie diese flüchtigen Kunstereignisse überhaupt tradierbar sind. Hier spielte die Dokumentation in verschiedenen Schichten eine wichtige Rolle: Beschreibungstexte, Erzählungen über das Ereignis, Fotografien. Und an dieser Stelle kam meine Kamera wieder ins Spiel, denn mit ihr nahm die Videodokumentation der Aktionen ihren Anfang. Meine intensive Dokumentationstätigkeit schlug irgendwann in die Autorentätigkeit um. Das passierte bei den Aktionen einer späteren Phase, in denen auf einer Metaebene bereits das Wechselspiel zwischen Ereignis und Dokumentation reflektiert wurde. Es gab zwar eine fliessende Grenze zwischen Autorin und Teilnehmerin, aber in den Listen der Aktionen steht mein Name irgendwann an erster Stelle. Das war ein wichtiges Prinzip bei den „Kollektiven Aktionen“: Jemand wurde als Autor anerkannt, sobald sein Vorschlag zu einer Performance von anderen angenommen und durchgeführt wurde. Sein Name wurde dann an den Anfang der Liste gesetzt.
n.: Was hatten Sie da vorgeschlagen?
S.H.: Das war eine kleine Serie von Aktionen, in denen Video selbst zum Thema gemacht wurde. Sie heissen: „Für Elena Elagina (Ort der Aufnahme)“ und „Für Sergej Romaško (Video)“. Hier wurde ich zum ersten Mal zur Autorin bei den „Kollektiven Aktionen“. Und diese Aktionsserie fand später – in den 1990er Jahren, als die Moskauer Konzeptualisten im Zusammenhang mit Ausstellungsprojekten und Festivals auf Reisen durch Europa gingen, auch eine Fortsetzung in Deutschland. Bei der Aktion „Link“, die im Botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum stattfand, kamen etwa Materialien aus dem Computerspiel „The Legend of Zelda“ zur Verwendung und die Medienreflexion wurde auf die digitale Dimension, auf das Verhältnis von Realität und Virtualität ausgedehnt.
n.: Aus der Dokumentation wurde also eine poetische Geste. Wie sind Ihre Publikationen denn damals im Westen aufgenommen worden?
S.H.: „Kulturpalast“ war im Jahr 1984 eine gewisse Sensation, die Publikation wurde auch im Fernsehen, in einem Kulturjournal besprochen, weil zum ersten Mal so breit literarische und künstlerische Praktiken aus dem sowjetischen Underground vorgestellt wurden.

Ausstellung "PRIGOV. Die Textarbeiten des Dmitrij Aleksandrovič" im Museum Weserburg, Bremen, Nov. 2010
n.: Sie sind inzwischen auch Kuratorin der Ausstellung „Die Textarbeiten des Dmitrij Aleksandrovič“, die gerade in Europa gezeigt wird. Was war der Impuls dazu?
S.H.: Diese Ausstellung ging aus einer jahrelangen Beschäftigung mit dem Oeuvre Dmitrij Prigovs hervor. Die Exponate, die wir gemeinsam mit Georg Witte in dieser Zeit gesammelt haben, sollten nun im Raum präsentiert und so auch unsere Forschung anschaulich gemacht werden. Es gab in der letzten Zeit einige grosse Ausstellungen zu Prigov, etwa in Venedig während der letzten Biennale oder in der Eremitage in St. Petersburg. Mein Projekt ist als eine kleine und mobile Ausstellung aus dem Koffer konzipiert, die in verschiedenen Zusammenhängen funktionieren kann. Zum ersten Mal war sie 2010 im Museum Weserburg in Bremen zu sehen. Das war im Studienzentrum für Künstlerpublikationen. Und da lag es mir am Herzen, Dmitrij Prigov in einen internationalen Vergleichskontext zu bringen. Vorher wurden im Bremer Studienzentrum zum Beispiel Robert Rehfeldt (DDR), Allen Ruppersberg (USA) oder Clemente Padín (Uruguay) gezeigt. In Graz ist es im letzten Jahr zusammen mit dem dortigen Kurator Roman Grabner ganz gut gelungen, Prigov in Kombination mit einer jüngeren russischen Künstlergeneration zu präsentieren.
n.: Und wie äussert sich das Ähnliche und Unähnliche zwischen den Generationen?
S.H.: Die Konzeptualisten haben eine starke künstlerische Haltung entwickelt, aber es war keine direkte politische Positionsäusserung. Es war eher eine Haltung der Selbstreflexion. Die heutige Künstlergeneration nimmt weniger diese Reflexionshaltung ein, ihr geht es vielmehr um eine unmittelbare gesellschaftliche Intervention.
Bei der Ausstellung in Graz kam es zu einer Gegenüberstellung von Dmitrij Prigov und der Gruppe „Čto delať?“ (russ. Was tun? red.). Für mich war es spannend, denn es gab ein verbindendes plastisches Element in dieser Gegenüberstellung – die Zeitung. Bei Dmitrij Prigov bedeutet die Zeitungsübermalung eine Auseinandersetzung mit vorgefundenen politisch-ideologischen Zeichenwelten. Er nimmt die Zeitung „Pravda“ als Grundlage und überzeichnet sie etwa mit dem eigenen Namen „Prigov“, wobei der Text der Zeitung weiter durch den Namen hindurch scheint. Prigov bringt damit das wechselseitige Durchdrungensein von offizieller und inoffizieller Kultur zum Ausdruck, aber auch die eigene Involviertheit in diesen Kontext. Die Gruppe „Čto delať?“ dagegen hat einen Raum mit einer Installation aus ihrer eigenen Zeitung eingerichtet. Diese Zeitung ist ein reales politisches Diskussionsforum. Als Hommage an Prigov haben die Künstler eine Perestrojka-Nummer installiert. Darin sehe ich den Unterschied zwischen diesen beiden Generationen: Bei Prigov ist es eine Selbstreflexion in Bezug auf die politische Haltung. Und bei „Čto delať?“ ist es tatsächlich die eigene politische Zeitung – eine politische Äusserung, die eine breitere Öffentlichkeit intendiert.
n.: Die Ausstellung aus dem Koffer ist eine spannende Art von Werkschau, die ganz neue Horizonte eröffnet.
S.H.: Ja, das ist vielleicht die Stärke dieser Ausstellung, dass Prigovs Werke hier nicht in einer kanonisierten, historisierenden Form wie bei einer Dauerausstellung vorgestellt werden. Dagegen tauchen sie immer wieder in neuen Kontexten auf. Ich bin schon auf die Verwirklichung in Innsbruck und Budapest gespannt.
n.: Das Visier Ihrer VHS Blaupunkt Kamera wurde zum Teil des russischen Undergrounds und Ihre Dokumentationen ermöglichen uns heute einen Blick in diese Kunst. Gehört die Kamera eigentlich zu den Exponaten Ihrer Ausstellung?
S.H.: Nein, die Kamera ist leider verloren gegangen. Aber die Aufnahmen, die ich damals mit ihr gemacht hatte, sind bei der Ausstellung zu sehen.
Weiterführende Links:
http://www.conceptualism-moscow.org/page?id=173&lang=en
http://conceptualism.letov.ru/
http://hightechchat.reocities.com/
http://artkladovka.ru/
http://www.dissense.de/km/link.html
http://www.weserburg.de/index.php?id=420
http://alt.kultum.at/galerien/2011/archiv_Galerien11.htm
http://www.sabine-haensgen.de/
http://www.prigov.org/
http://vsevolod-nekrasov.ru/
http://vadimzakharov.com/