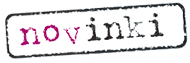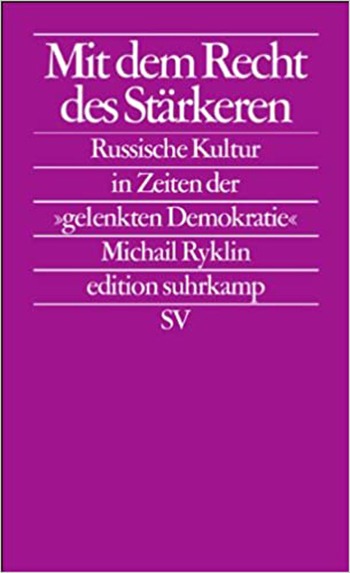 Michail Ryklin – der Moskauer Philosoph, hierzulande bekannt vor allem als Moskauer Dialogpartner der französischen Dekonstruktion sowie durch seine Essaysammlungen zu Nationalsozialismus und Stalinismus Räume des Jubels (Prostranstva likovanija) und Terrorlogiki, hat im Suhrkamp-Verlag ein Buch veröffentlicht, das er zu schreiben nicht vorhatte, dessen Niederschrift sich spontan entwickelte als Chronik traumatischer Ereignisse.
Michail Ryklin – der Moskauer Philosoph, hierzulande bekannt vor allem als Moskauer Dialogpartner der französischen Dekonstruktion sowie durch seine Essaysammlungen zu Nationalsozialismus und Stalinismus Räume des Jubels (Prostranstva likovanija) und Terrorlogiki, hat im Suhrkamp-Verlag ein Buch veröffentlicht, das er zu schreiben nicht vorhatte, dessen Niederschrift sich spontan entwickelte als Chronik traumatischer Ereignisse.
Mit dem Recht des Stärkeren. Russische Kultur in Zeiten der gelenkten Demokratie handelt von der Verwüstung der Ausstellung „Achtung, Religion!“ (Ostorožno, religija!) im Sacharow-Zentrum Januar 2003 durch fundamentalistisch orthodoxe Vandalen und dem langen juristischen Nachspiel, in dessen Verlauf nicht etwa die Vandalen, sondern der Direktor des Sacharow-Zentrums, Jurij Samodurov, und seine Kuratorin Ljudmila Vasilovskaja für das ‚Schüren nationalen und religiösen Zwists’ verurteilt wurden. Die Verteidigung hat beim Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte inzwischen Berufung eingelegt. Ryklins Frau, die Künstlerin Anna Alčuk saß – sozusagen stellvertretend für die anderen an der Ausstellung beteiligten Künstler – mit auf der Anklagebank, wurde jedoch schließlich freigesprochen.
Der Essay gliedert sich in drei Abschnitte: die Einleitung Eine unverlangte Erzählung, dem mit Dokumenten unterfütterten Prozessbericht Schall und Wahn und dem kommentierenden Teil Das Recht zu hassen. Eine unverlangte Erzählung widmet sich sehr persönlich dem eigenen emotionalen Erleben der Geschehnisse und den einsetzenden psychischen Mechanismen: von der anfänglichen Überraschung, dem Unglauben angesichts der Anklage der Geschädigten des vandalistischen Akts über die gleichgültigen, abwiegelnden Reaktionen im Bekanntenkreis bis hin zu den Verdächtigungen, es müsse doch etwas an den Vorwürfen dran sein, wenn die ‚dumme Geschichte’ nun schon so lange dauere. Hier schon zeichnet sich die performative Wirkung von Schauprozessen ab, die Ryklin im Laufe des Buches herausarbeitet und die er mit dem Goebbels-Aphorismus, nach dem eine Lüge nur ungeheuerlich genug sein müsse, damit man sie glaube, pointiert anzugeben vermag. Der Kreis der Gleichgültigkeit um die Beschuldigten heute ist nicht dasselbe wie jene aggressive Leere, welche sich um die Opfer des stalinistischen Terrors bildete – er ähnelt ihr aber doch. Überhaupt hat manches eine Vorgeschichte: Gut zwanzig Jahre zuvor erlebte Ryklin vor selbigem Taganer Gericht die Verurteilung seiner Schwiegermutter – und nun wieder das Gefühl, dass die Schuld schon von Beginn an feststeht, dass die eigenen Anstrengungen im ‚Verfahren der Wahrheitsfindung’ vergebliche Mühe sind. Ryklin zeigt sich enttäuscht von der mangelnden Solidarität in Kunstkreisen und fragt sich, welche Gründe dieser Mangel heute hat. Seine Diagnose: eine zunehmende Atomisierung ihrer Mitglieder, ihr Aufgehen im alltäglichen Existenzkampf einer rauer gewordenen Wirklichkeit, die Unmöglichkeit, den irgendwie doch gesicherten Undergroundstatus ‚spätsowjetischer’ Zeiten im marktwirtschaftlichen Milieu aufrecht zu erhalten.
Teil I Schall und Wahn unterfüttert das persönliche Erleben des Prozesses mit den Prozessakten und Dokumenten der öffentlichen Reaktion auf diesen. Die Kunstwerke werden charakterisiert. Einige von den zehn Arbeiten, die im Urteil als ‚lästerlich’ und ‚nationalen und religiösen Zwist schürend’ eingestuft wurden, sind fotographisch dokumentiert. Etwa Aleksandr Kosolapovs „This is my blood“. Die eine Reklametafel imitierende Arbeit zeigt im linken Drittel des Bildes ein aus Marien- und Erlöserbildnis montiertes Gesicht und rechts davon den Schriftzug „Coca-Cola. This is my blood“. Wie viele der Exponate lässt sich das Bild schlüssiger als Kritik an Massenkultur deuten. Diese Deutungsmöglichkeit wird im Gutachten von der Mitarbeiterin am „Institut für Allgemeine Geschichte“ an der Akademie der Wissenschaften (Institut Vseobščej Istorii RAN) Natalija T. Ėneeva auch erwogen; doch alleine die Verwendung einer Formel der Eucharistie in dem säkularen Kunstkontext scheint für den Tatbestand der Blasphemie auszureichen. Diese Experten-Gutachten, deren Verfasser teilweise ihre Ferne, bzw. offene Ablehnung von zeitgenössischer Kunst unumwunden zugeben, zitiert Ryklin ausgiebig. Alle Gutachter besetzen Stellen, entweder im Museumsbetrieb (Tretjakov-Galerie) oder an der Russischen Akademie der Wissenschaften, an welcher Ryklin selbst beschäftigt ist. Wäre dem nicht so, hätte man es vielmehr mit fiktiven Gutachten innerhalb eines Romans Sorokins zu tun, man könnte sich köstlich amüsieren. So etwa wenn in der Expertise der Leiterin des „Instituts für sozialökonomische Probleme der Bevölkerung“ (Institut Social’no-Ėkonomičeskich Problem Narodonaselenija RAN) Natalija E. Markova die zu Stalins Zeiten überbeanspruchte Theorie des ‚bedingten Reflexes’ (Pavlov, Bechterev) im Gutachten auf Fotografien Oleg Kuliks anwendet. In Bezug auf diese Fotos, auf denen menschlich-tierischer Geschlechtsverkehr angedeutet wird, heißt es: „Der bedingte Reflex, ausgelöst durch ein Bild, auf welchem die Akte von Menschen und Tieren vereinigt sind, mag einen Menschen auf ewig in einen Zoophilen zu verwandeln.“ Zum Glück sind die Gutachter gegen solche Konditionierung mit formaler Schule und Ikonologie a la Warburg und Panofsky gewappnet. Klar: da das Volk – oder besser: die Bevölkerung – nicht über diese verfügt, vermag sie sich denn auch nur mit ‚gesunden’ psychischen Reizreaktionen zu schützen – in Akten des Vandalismus eben.
Nun leugnet Ryklin nicht, dass Kunst verletzen könne, der Gläubigen Sucht jedoch, sich verletzen zu lassen – zudem von Kunstwerken, die man zumeist nur vom Hörensagen kennt –, zeugt für ihn von einer ‚mittelalterlichen’ Logik, in welcher es keinen Kunstraum mit einer auch nur eingeschränkten Autonomie geben kann. Die Kirche will demnach ihre Deutungshoheit über die religiösen Zeichen und deren Ordnung verteidigen bzw. festigen: es darf keine anderen Spielregeln der Interpretation geben. Der Kunstraum ist dann immer schon identisch mit dem Kirchenraum, die Ausstellung konkurriert mit dem Gottesdienst. Nur in dieser Logik werden die absurden Vorwürfe des Satanismus, des Schamanismus gegen die Künstler verständlich.
Ryklin lehnt in diesem Zusammenhang auch jene Hinweise auf die vermeintlich ‚geringe Qualität der Ausstellung’ ab, mit denen einige Künstler und Kritiker sich des Protests enthielten oder gar sich von ihr distanzierten. Dies, so die Argumentation von Ryklin, sehe davon ab, dass weder die Fundamentalisten noch die Gerichte sich für diese Frage nach dem künstlerischen Wert ernsthaft interessierten; wenn, dann müssten sie diese Frage in der Sprache der Kunstkritik adressieren, wie sie eben im Kunstraum angesiedelt ist. Auch kann er in den Zerstörungen der Kunstwerke keinen ‚Konzeptualismus’ erkennen: Dieser mag – wie es etwa Oleg Kulik mit seinen aggressiven, gewalttätigen Aktionen vorgeführt hat – mit terroristischen Strategien den Kunstraum transgredieren, der Vandalismus aber intendiert eine einfache terroristische Aufhebung dieser Grenzen von Außen.
Teil II, Das Recht zu hassen widmet sich den Strukturen von Politik und Öffentlichkeit in Russland, wie sie der Prozess zu Tage fördern konnte. Ryklin untersucht die ideologische Neuerfindung Russlands als orthodoxe Nation, wobei er an einer Dosierung des Einflusses der Russisch-Orthodoxen Kirche durch die Exekutive nicht zweifelt (der ROK, es gibt in Russland mehrere Orthodoxe Kirchen ohne größere Machtambitionen). Ryklin nimmt auch an, dass das letztlich ergangene Urteil – nur Geldstrafen, jedoch eine sprachlich bedrohliche Urteilsbegründung – „von ganz oben“ heruntergereicht wurde. Die Gefahr, die Ryklin in diesem ideologischen Reizen der Instinkte der Massen sieht, kann nicht darin begrenzt werden, dass die Exekutive bei Bedarf ihren Repressionsapparat sporadisch gegen Neofaschisten richtet. Es ist die Zerstörung der politischen Öffentlichkeit selbst, die den Weg bereiten könnte für eine spezifisch russische Variante des Faschismus.
Wie immer man zu solchen Befürchtungen Ryklins stehen mag, die Charakterisierung der Pogromstimmung unter den fundamentalistischen Belagerern des Taganer Gerichtssaals gehört zum Bedrückendsten des Essays. Irritiert von einem gegen die Angeklagten gerichteten Aufschrei einer jungen, religiösen „Hysterikerin“, man hätte doch nur den Zaren nicht ermorden dürfen, wagt sich Ryklin in die Untiefen religiösen Schrifttums in Russland. Er zitiert den Oberpriester Šargunov, der die Kontinuität der jüdischen Feindschaft gegen das Kreuz Christi vom Mord an Christus bis zum Mord am Zaren durch die Bolševiki behauptet. Mit ihrer ‚tatsächlichen’, nicht nur symbolischen Kreuzigung Christi hatten die Künstler auch diese Schuld übernommen. Der Aufschrei war kein Einzelfall -- die Gruppen der betenden, singenden und schimpfenden Gläubigen bildeten wie der Chor in der griechischen Tragödie einen unabdingbaren Teil der Inszenierung. Die Gläubigen standen vor dem Gerichtsgebäude, sangen auf seinen Fluren und beteten in seinen Treppenhäusern. Sie versuchten das Gericht in ein Gotteshaus zu verwandeln und mit ihrer Präsenz die ‚Gottlosen’ einzuschüchtern.
Die ‚Logik’ der religiös antisemitischen Anfeindungen („ihr Juden“, „Judenfressen“) wurde im Zeugenstand weiter entwickelt. Dort wurde argumentiert, die Künstler – nur wenige unter ihnen waren ‚tatsächlich’ Juden – hätten mit der Ausstellung den Antisemitismus geschürt. Angesichts des Aufgreifens dieses nationalsozialistischen Klischees des jüdischen agent provocateur, welcher an dem ‚Niedergang’ seines eigenen Volks arbeitet, mag man verstehen, dass Ryklin in diesem Buch so oft – wie einst Hannah Arendt im Hinblick auf den Totalitarismus – den gesunden Menschenverstand anruft, mit dem in Berührung kommend, solche Lügengebäude augenblicklich in sich zusammenfallen. Den Versuch, dem gesunden Menschenverstand ein totalitäres Denken entgegenzustellen, hatte Ryklin in Räume des Jubels in dekonstruktiver Manier stark in Frage gestellt: Zu viele Differenzen würden damit getilgt. Auch in Mit dem Rechts des Stärkeren hält er an der Kritik des Begriffes fest: ‚Totalitarismus’ sei eben nicht mehr als ein Wort, das in die Umgangssprache aufgenommen, einige Ähnlichkeiten zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus benennt; er kann jedoch kein ausgebildetes wissenschaftliches Paradigma darstellen. Ryklins „Bilanz“ aber – seine Befürchtungen eines Faschismus, weil dieser die einzige Staatsform sei, die in Russland noch nicht korrumpiert worden sei – erinnert, indem sie sich vom dokumentarischen Material löst, stark an jenes düstere, weitschweifige Philosophieren, dessen sich die Philosophin zuweilen befleißigte. Man kann sich daran erinnern, dass einst auch Hannah Arendt angesichts der antidemokratischen Exzesse der McCarty-Ära in Amerika einen neuen Faschismus heraufkommen sah.
Diese Unbestimmtheit blieb auch in der Diskussion nach einer Vorstellung des Buches in Anwesenheit des Autors und seiner Frau in der Berliner IFA-Galerie am 23. November bestehen. Als eine Fragestellerin das Wort totalitär verwendete, um ihrer Betroffenheit Ausdruck zu geben, winkte Ryklin ab – der Zustand Russlands erinnere allenfalls an die Weimarer Republik.
Eine Arbeit, welche auf der Ausstellung „Achtung, Religion!“ zu sehen war – Aleksandr Dorochovs „Am Anfang war das Wort“ – stellt in der Form eines Tryptichons Kreuz, Sowjetstern und Hakenkreuz nebeneinander, an die jeweils ein expressiver, an Matisse’ Gemälde Der Tanz erinnernder, menschlicher Körper gekreuzigt ist (nach dem Vandalismus wiederum überlagert von den Worten mraz’ vy besy – Dreckskerl ihr Teufel). Hinterlegt sind die Kreuze mit Textmaterial aus der Bibel, dem Kommunistischen Manifest und Mein Kampf. Das Gutachten stört sich an der durch die formalen Mittel suggerierten, empörende Gleichsetzung christlicher Symbole und biblischer Worte mit denen menschenverachtender Ideologien. Ist aber eine solche Gleichsetzung intendiert? Wenn ja, so meine ich, könnte man auch die Gleichsetzung des Kommunistischen Manifests und Mein Kampf beanstanden (in einer Kritik und nicht in einem Prozess). Vielleicht will das Objekt aber vielmehr mit formalen Mitteln Gleichsetzungen vorführen, die schnell dahingesagt sind. Hakenkreuz, viel mehr aber noch Sowjetstern sind die Symbole zweier Projekte der Moderne mit dem Anspruch umfassender Neuschaffung der conditio humana – und zweier Verbrechen riesigen Ausmaßes, jedoch verschiedenen Charakters. Und wie steht es mit dem Kreuz? Kann es als grundlegendes Symbol für den abendländisch-christlichen Kulturkreis in ähnlicher Weise als ideologisches Zeichen fungieren? Leuchtet die Verbindung von Kreuz und Faschismus ein? Vielleicht sollte man das Kreuz als Zeichen der Institution der ROK eher als Element der Neuerfindung Russlands als einer der zukünftigen ‚imperialen’ Großmächte deuten? – Sie singt „das alte Entsagungslied. Das Eiapopeia vom Himmel“ (Heine) für die vielen Verlierer der ‚Transformationsphase’ und grenzt das kulturell Fremde und teils tatsächlich Feindselige, Bedrohliche aus, was Russland sich in seiner langen Imperialgeschichte unter Zar und Stalin herangezüchtet hat. Viele Fragen stellen sich – deutet sich in der direkten Instrumentalisierung der Kirche als ideologischem Zensurapparat ein neuerlicher russischer Sonderweg an, welcher mit der Inanspruchnahme ‚christlicher Werte’ durch Konservative in Europa und Amerika nicht vergleichbar ist? Ist die Gegenüberstellung der Religion mit den modernen Ideologien, wenn kein Holz-, so zumindest ein Umweg?
Unbeantwortet bleibt im Buch jedenfalls, und blieb es auch in der IFA-Galerie, was man denn eigentlich mit der Ausstellung erreichen wollte. Auf die Frage hin, für wen denn die Ausstellung gedacht gewesen wäre, antwortete Ryklin, dass eine solche Ausstellung normalerweise von ein Paar Dutzend Leuten besucht wird („jeder Künstler lädt drei Freunde ein...“). Die kritische künstlerische Reflexion von Religion und Kirche interessiert also nur einen verschwindend geringen Teil der russischen oder vielmehr Moskauer Öffentlichkeit. Die Ausstellungsmacher aber schienen vom Schutz ihrer öffentlichen Aktivität durch den Staat auszugehen. Wenn aber nun, wie es Ryklin nahe legt, die Exekutive, indem sie den Prozess initiierte, darauf abgesehen hatte, das Sacharow-Zentrum zu treffen – das seine Ablehnung des Tschetschenienkriegs mit einem Protestplakat am Gebäude zum Ausdruck gebracht hatte –, greift dann die Auseinandersetzung mit der Kirche oder gar ‚der Religion’ nicht zu kurz? Ryklin hat daher Recht, wenn er schreibt, dass mit dem Prozess klar wurde, dass sich die Künstler und Intellektuellen der Tatsache nicht entziehen werden können, dass sie in einem Staat leben, welcher einen grausamen Krieg in Tschetschenien führt.
Die Solidarität im westlichen Ausland, so Ryklin, habe ihm während der Prozesse sehr viel geholfen, zudem erhalten seine Befürchtungen ihre Authentizität auch aus der Perspektive des Opfers, mit welcher er sich in der Einleitung auseinandersetzt. Dennoch sollte man mit solchen Konjekturen eines ‚russischen Faschismus’ hierzulande vorsichtig sein, denn in Deutschland könnte der Ausdruck einen anderen, nicht zuletzt vergangenheitspolitischen, Sinn annehmen. Die Voraussetzung jedenfalls, dass man hier in einem unversehrten Raum internationaler zivilgesellschaftlicher Kommunikation spricht, mag trügerisch sein. Überhaupt darf man, was die Rezeption des Buches anbelangt, pessimistisch sein – wen wird Ryklins Buch berühren? Wie viele werden Svastika, krest i zvezda, das in Russland zeitgleich mit der Übersetzung im kleinen Moskauer Logos-Verlag erschien, überhaupt lesen? Und was wird es in Deutschland anderes auslösen als stillen Stolz über ‚unsere Wertegemeinschaft’ (welche jetzt nicht nur wieder vermehrt ‚christlich’ apostrophiert sondern auch vom Kosovo bis nach Afghanistan von deutschen Soldaten verbreitet werden darf). Die Präsentation in der IFA-Galerie hinterließ jedenfalls einen fahlen Nachgeschmack bei mir. Die Veranstaltung wurde in fast pastoralen Ton von der Galeristin Paula Böttcher moderiert und anwesend waren vor allem Herrschaften, die ihre „Betroffenheit“ über die Verletzung von Menschenrechten ausdrücken wollten. Nun sollte man sich vor einem unumwundenen Bekenntnis zu Menschenrechten, zu Meinungs- und Redefreiheit, nicht scheuen, aber die Frage ist doch, ob der Westen noch einen gültigen Gesellschaftsentwurf anzubieten hat. Auch hierzulande entsolidarisiert sich die Gesellschaft zunehmend und den Marginalisierten wird als Kompensation die Identifikation mit dem Abstraktum der Nation angeboten oder gar – wenn es sich um ‚Immigranten’ handelt – ihre Identifikation mit der „Wertegemeinschaft“ abgefordert. Der Zusammenhang von Mangel an Solidarität und dem Existenzkampf in der heutigen russischen Gesellschaft, auf den Ryklin hinweist, sollte nicht vernachlässigt werden.
Michael Ryklin: Mit dem Recht des Stärkeren. Aus dem Russischen von Gabriele Leupold. edition suhrkamp. Frankfurt a.M. 2006.
www.sakharov-center.ru/museum/exhibitionhall/hall_exhibitions_religion_ostorojno.html