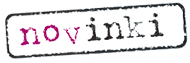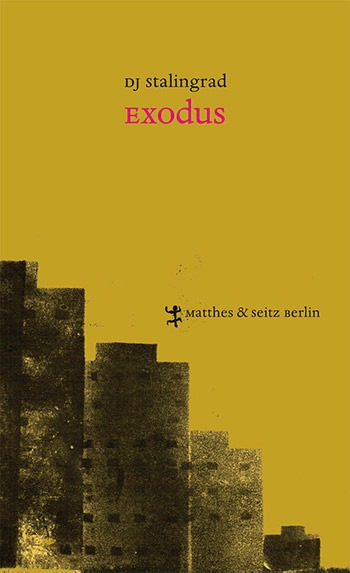 DJ Stalingrad, Exodus, erster Satz: „Die Sonne brennt.“ Es ist ein schmales, seltsames Buch, das soeben in deutscher Übersetzung bei Matthes & Seitz erschienen ist. Bereits die Vorgeschichte ist von Legenden umwittert. Erste Spuren DJ Stalingrads bahnen sich im April 2011 den Weg ins deutsche Feuilleton: Kerstin Holm berichtet in der FAZ von einem Protagonisten des Untergrunds, der wegen verschiedener Aktionen gegen die russische Staatsmacht mit Haftbefehl gesucht werde und sich auf der Flucht (und der Suche nach der nächsten Revolution) quer durch Europa befinde. Seinen wahren Namen aus Sicherheitsgründen geheim haltend, sei DJ Stalingrad seinem Selbstverständnis nach radikaler Anarchist, Antifaschist und „roter Skinhead“.
DJ Stalingrad, Exodus, erster Satz: „Die Sonne brennt.“ Es ist ein schmales, seltsames Buch, das soeben in deutscher Übersetzung bei Matthes & Seitz erschienen ist. Bereits die Vorgeschichte ist von Legenden umwittert. Erste Spuren DJ Stalingrads bahnen sich im April 2011 den Weg ins deutsche Feuilleton: Kerstin Holm berichtet in der FAZ von einem Protagonisten des Untergrunds, der wegen verschiedener Aktionen gegen die russische Staatsmacht mit Haftbefehl gesucht werde und sich auf der Flucht (und der Suche nach der nächsten Revolution) quer durch Europa befinde. Seinen wahren Namen aus Sicherheitsgründen geheim haltend, sei DJ Stalingrad seinem Selbstverständnis nach radikaler Anarchist, Antifaschist und „roter Skinhead“.
Gegenstand des FAZ-Artikels ist auch der zunächst im Internet, dann in der Zeitschrift Znamja (Ausgabe 9/2010) publizierte Text Ischod, der ein Milieu beschreibt, das von Gewalt und Brutalität geprägt ist und in dem (physischer) Schmerz „überflüssigen Männern“ als Medium der Wahrnehmung und Selbsterfahrung gilt. Es ist eine Generation, die ihre Sozialisierung in den 1990er Jahren erfahren hat und die den nächsten großen Aderlass herbeisehnt: einen Krieg nämlich, der die Welt von überschüssigem männlichen Blut befreit. Bis dahin fressen sie – eher düstere Vertreter dieser Generation – Drogen und Asphalt, üben sich in Straßenschlachten gegen verfeindete Untergrundgruppierungen, prügeln sich bis aufs Blut.
Dem DJ springen Ikonen des russischen Literaturbetriebs wie der Verleger Alexander Ivanov bei, der in ihm einen „intellektuellen Straßenpartisanen“ ausmacht. Es sind krude Einblicke in den russischen Untergrund, die Holms Artikel gewährt: die Passagen aus Exodus klingen martialisch, die Protagonisten frönen einem eigentümlichen Ideal von Schmerz und Krieg, die beigegebene Fotografie zeigt den DJ „in Unordnung“, nämlich nur mit einer Unterhose bekleidet inmitten von Chaos, die Pose unruhig, das Gesicht abgewandt – eine Ohrfeige dem bürgerlichen Geschmack.
Szenenwechsel. Zur Buchpremiere der deutschen Übersetzung in Berlin zwei Jahre später ist der Name des Autors kein Geheimnis mehr: Petr Silaev, Jahrgang 1985, geboren und aufgewachsen in Moskau. Seine Geschichte liest sich ähnlich wie die seines Alter Egos DJ Stalingrad und doch ganz anders: Aus dem Anarchisten in Unterhose ist ein Mann mit Gesicht geworden, den man nicht mehr als obskuren Schläger wahrnimmt, sondern als politischen Aktivisten, der wegen seiner Unterstützung für die Umweltschutzbewegung in Chimki ins Ausland flüchten musste. Der dortige zivile Protest gegen die Abholzung eines Waldgeländes sah sich massiven Einschüchterungsversuchen und gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt – DJ Stalingrad und Gleichgesinnte konterten mit Steinen und Flaschen und demonstrierten damit, dass Gewalt kein Privileg von Machthabern und Militär sei. Eine tragische Aktualisierung erfuhren die Vorgänge in Chimki kürzlich mit dem Tod des Lokaljournalisten Michail Beketov, der sich für die Protestbewegung eingesetzt hatte, 2008 brutal zusammengeschlagen wurde und im April dieses Jahres den Spätfolgen des Überfalls erlag.
Die Sehnsucht nach dem nächsten Krieg, die den DJ ins Ausland getrieben hatte, erweist sich für Silaev als Odyssee durch Europa, dessen Gefängnisse und Gerichte. In Russland wirft man ihm Hooliganismus vor und damit einen jener Straftatbestände, die sich wie unlängst im Falle der Punk-Band Pussy Riot wieder als probates Mittel erwiesen haben, missliebige Stimmen in Straflagern ruhig zu stellen. Silaev, der nach einer Art riot hopping schließlich in Finnland politisches Asyl erhält, wird im August 2012 auf der Grundlage eines Interpol-Gesuchs in Spanien verhaftet, nach einigen Tagen aber wieder freigelassen. Seine Auslieferung nach Russland wird in Anerkennung der Tatsache, dass seine Verfolgung politisch motiviert sei, von spanischen Gerichten verhindert. Die missbräuchliche Instrumentalisierung von Interpol durch Russland wird von der Organisation Fair Trials International angeprangert, die sich mittlerweile für den Fall Petr Silaevs einsetzt.
Indes, der Text Exodus bleibt auch in einer veränderten paratextuellen Positionierung erst einmal gleich. Ob man ihn nun als authentisches Zeugnis aus dem Untergrund lesen mag oder als wütenden Protestschrei einer hoffnungslosen Jugend in postsowjetischer Szenerie: Es geht darin vor allen Dingen um Gewalt, die sich als buchstäblich blutroter Faden durch die Seiten zieht, eine ekstatische und rücksichtslose Gewalt, die die Protagonisten ausüben oder an anderen bewundern. Der Text schlaglichtert durch wüste Schlägereien in Moskauer Vororten und den internationalen Hotspots der körperlichen Auseinandersetzung zwischen Links und Rechts, die mit Lust am Blut und brutaler Härte, gleichwohl konzentriert geplant und vollzogen werden. Beschrieben werden irre Straßenschlachten, Drogenexzesse und Ausnahmebrutalisten wie der Punkrocker GG Allin, der regelmäßig sein Publikum attackierte, bei seinen Auftritten masturbierte oder sich selbst verstümmelte, seine eigenen Exkremente aß oder Frauen vor den Augen anderer vergewaltigte.
Dass man dem Erzähler durch die Aneinanderreihung dieser grellen, oft brutalen Szenen trotzdem folgt, ist neben einer gewissen Freude am drastischen Anarcho-Sound der Faszination geschuldet, die der Exzess hervorruft. Der öffentliche Geschmack wird hier nicht mit der futuristischen Ohrfeige, sondern mit entfesselten Fäusten, Messern, Gummigeschossen traktiert. Die Gewaltausbrüche sind dabei aus dem Text heraus oft bis zu einem bestimmten Grade nachvollziehbar. Großartig ist etwa die Schilderung der düsteren Epiphanie zu Beginn der Erzählung: Jemand, der wohl Gott sein müsse, wie der Erzähler später beschließt, verheißt dem Kind Elend und Leid, wenn es IHM nicht folge, am Ende wird trotzdem die Vernichtung stehen. Dieser bedrohliche ER, das wird sogleich präzisiert, ist ein attraktiver Lebemann, fest in einem guten, gerechten Leben stehend. Einer, der das Glücksspiel und die Frauen liebt, einer, der sich, seine Nächsten und seine ehrenwerten Prinzipien gegen Unbill verteidigen kann. Es ist dieser menschgewordene Gott eines gelingenden Lebens, der abends an der Kasse vor dem Erzähler (ausgeleierter Pullover, schmutzige Turnschuhe, Teenager-Schnauzbärtchen, Akne und verfaulte Zähne) steht und dessen furiose „Fleischwerdung“ der Text mit Genuss beschreibt: „Und innerhalb einer Sekunde verwandelt sich dieser super Typ in ein Stück Scheiße. Ein Eisenrohr macht aus seinem Kopf blutiges Hackfleisch. Zähne, Hautfetzen, Blut fliegen in alle Richtungen.“ Der Erzähler ist einer, der nichts hat und dem nichts gelingt, und der sich deshalb an „dieser Schwuchtel“ für all die verlorenen Jahre, für sein ganzes verlorenes Leben, für alle, denen es wie ihm selbst ergeht, rächt und darin „etwas von Heiligkeit“ erkennt.
„Etwas von Heiligkeit“? Bereits im Titel klingt eine religiöse Dimension an, die sich im Buch fortsetzt, der Autor hat ein religionswissenschaftliches Studium abgeschlossen. Helle Heilserwartungen ergeben sich daraus freilich nicht. Der düstere ER vom Anfang, dessen Odem eher Pesthauch ist, gebietet über eine irre Welt, über „Betrunkene, Halbwahnsinnige, kostümierte Heilige, Fromme mit Stalinikonen und andere phantastische Figuren“ (Holm). All seiner Unerbittlichkeit zum Trotz hat aber selbst ER den Eisenstangen seiner wildgewordenen Schäfchen nichts entgegenzusetzen, wenn sie ihn an der Kasse erkennen. Das Verhältnis zur religiösen Praxis ist ambivalent. Der Erzähler verhöhnt die Orthodoxie als gesellschaftliche Residualkategorie, in der sich Fanatiker und Verrückte sammeln und jene, die unter den Anforderungen postsowjetischer Zeiten zerbrechen – aber immerhin sind es Orthodoxe, mit denen er die (Halb-)Leichen von Obdachlosen in der Stadt zusammensucht, bis das Geld ausgeht. Die Begegnung mit einem Mönch in einem Bettelkloster bleibt sonderbar sprachlos. Und doch bildet die Religion eine der wenigen Grenzen, die der Erzähler empfinden kann – einen Priester zu entführen, das ist selbst ihm zu viel.
Von Fragen des Geschmacks einmal abgesehen, bleibt das Verhältnis des Textes zu der darin ausgestellten Gewalt problematisch. Das ideologische Bekenntnis der Schlägertruppe, das kaum ausgeführt wird, scheint merkwürdig beliebig. Ohnehin könnte es keine Legitimation herstellen für die Brutalität des Schlägertrupps. Der Text kokettiert bald mit den politischen Bezugsgrößen links und rechts, der in der deutschen Ausgabe enthaltene Kommentar, welcher die Abgrenzung von neonazistischen Gruppierungen zweifelsfrei ermöglicht, solle, so der Autor in Berlin, unbedingt erst nach der Lektüre des Textes gelesen werden.
Eine Rezension im russischen Internet-Journal rabkor verweist denn auch auf die dergestalt strukturelle Nähe linker und neonazistischer Extremisten, die in den Tiefen des Hasses und der Gewalt zusammenfinden und eigentlich austauschbar werden. In der Rezension heißt es: „Diese für beide Seiten unerfreuliche Ähnlichkeit zeigt sich beispielsweise darin, dass einzelne Absätze aus Exodus wie Passagen des bekannten Romans ,Skins: Russland erwacht‘ klingen, dessen Autor letztes Jahr Selbstmord beging.“ Angesichts der Tatsache, dass der genannte Roman Nesterovs „der aggressiven urbanen Subkultur der Glatzköpfe“ gewidmet ist, „die sich den Ideen der Säuberung der arischen Rasse und der Wiederbelebung des imperialen Stolzes verschrieben hat“, bringt das Spiel mit dem Verzicht auf eine klare politische Verortung, das Exodus betreibt, keine Haltung für oder gegen etwas hervor, sondern bleibt den Abgründen einer Gewalt verhaftet, die jede erklärte ideologische Ausrichtung ad absurdum führt. In diesem Milieu extremer Gewalt verschwimmen die Grenzen zwischen den politischen Lagern, werden vielmehr bewusst verwischt. Deutlich zeigt sich dies in einer der letzten Szenen der Erzählung, als es um die Tätowierungen des niedergestochenen Fedja geht. Die Polizisten erzählen sich, Fedja habe überall Hakenkreuz-, Totenkopf- und Adler-Tattoos gehabt. Der Ich-Erzähler weiß es besser – Fedja trug keine neonazistischen Tattoos, sondern ein Herz, einen Vogel, eine Klinge und den Schriftzug Liebe deinen Nächsten. Er denkt dies bei sich, ohne den Irrtum der Polizisten aufzuklären. Damit bleibt der Antifaschist Fedja in den Augen der Polizisten ein Neonazi. Vielleicht ist es bezeichnend genug, dass Milieu und Gebaren der Protagonisten eine solche Festlegung durch den oberflächlichen Blick von außen nahelegen.
Exodus ist ein brutaler Text, der die Verlorenheit jener artikuliert, die Orientierung nur noch im Blutvergießen suchen. Gewalt ist für die Protagonisten DJ Stalingrads weniger Mittel zum Zweck als vielmehr letztes Ausdrucksmittel einer Generation, die sich nur noch im Schmerz und in einer Art Krieg (be-)findet. Es ist ein Text, dem man die wütend gereckte Faust und die Emphase des Asphalts anmerkt und dem man manchmal etwas mehr Aufsicht gewünscht hätte. Es ist schließlich ein Text, der eine Schauerlichkeit nach der anderen aneinanderreiht und dabei in vielen Momenten über das bloße Vorführen und Ausstellen von Brutalität und Härte nicht hinausgeht. Gleichwohl gerinnt in den Blutlachen eine erschütternde Ahnung davon, wie das aussehen kann: eine Jugend im Straßenkrieg, in den Ruinen der sowjetischen Gesellschaftsordnung, aus denen sich ein „neues Russland“ erhebt. Vielleicht ist der Text auch deswegen erschütternd, weil er von einer rohen gesellschaftlichen Gewalt dieses neuen Russlands zeugt, die sich für manche nur in die Ausübung physischer Gewalt übersetzen lässt. DJ Stalingrad, Exodus, letzter Satz: „Wir sind jetzt Hobbits.“
DJ Stalingrad: Exodus. Aus dem Russischen von Friederike Meltendorf. Berlin: Matthes & Seitz, 2013.
DJ Stalingrad, „Ischod“. In: Znamja, Nr. 9/2010. URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2010/9/d9.html
Weiterführende Links:
Holm, Kerstin: DJ Stalingrad. Im Rausch der Gefahr. FAZ, 3. April 2011