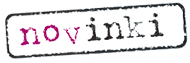Ein Interview mit Dorothea Trottenberg
Dorothea Trottenberg ist die aktuelle Preisträgerin des Paul-Celan-Preises für herausragende Übersetzung ins Deutsche. Neben dem ausgezeichneten Durst von Andrej Gelasimov hat die Osteuropa-Fachreferentin und Russischübersetzerin vor kurzem die Urfassung von Tolstojs Krieg und Frieden veröffentlicht und arbeitet weiterhin an der Gesamtausgabe Ivan Bunins. Im Interview mit novinki erzählt Trottenberg von den Freuden und Leiden des Kulturtransfers, von Ur- und anderen Fassungen und von individuellen Antworten auf unlösbare Fragen.

novinki: Frau Trottenberg, Sie übersetzen russische Literatur ins Deutsche. Wie schätzen Sie die Lage der russischen Literatur auf dem deutschen Buchmarkt ein? Zeichnet sich hier eine Krise ab, wie man sie sonst im Buchhandel spürt?
Dorothea Trottenberg: Die russische Literatur hat es generell nicht so einfach, wenn man von speziellen Genres wie Klassikern oder dem Krimi absieht. Da ist in den vergangenen Jahren einiges ins Rollen gekommen, was sich auch in Verkaufszahlen ausdrückt. Ansonsten krankt russische Literatur an ihrem Ruf als gute, aber schwierige Literatur. Sie hat einfach dieses Label. Als Russland 2003 Gastland an der Frankfurter Buchmesse war, wurde viel übersetzt. In der Folge aber, so scheint mir, ist es nicht wie bei anderen Ländern bei einer kontinuierlichen Steigerung oder Beibehaltung der Übersetzungsmenge geblieben. Als Polen Gastland war, gab es nachher einen regelrechten Boom polnischer Literatur. Bei Ungarn auch. Aber bei Russland war das nicht der Fall.
n.: Warum boomt gerade der russiche Krimi?
D.T.: Boom ist vielleicht übertrieben. Im Vergleich zu Krimis von Stieg Larsson oder anderen ist es kein Boom. Aber dennoch liegen russische Krimiautoren, zum Beispiel Boris Akunin mit seinen historischen Krimis, Aleksandra Marinina oder Polina Daškova, von den Verkaufszahlen her ganz eindeutig über dem Niveau der anderen literarischen Texte. Allerdings verkaufen sich Krimis allgemein besser als andere Literatur.
n.: Wie kamen Sie überhaupt dazu, literarische Texte zu übersetzen?
D.T.: Mich hat von Anfang an die Arbeit mit der Sprache fasziniert. Der Versuch, einen Kulturkreis mit Hilfe der Literatur und Sprache in einen anderen zu transportieren. Ich habe während des Studiums auch viele Übersetzungen gelesen, weil ich am Anfang das Russische noch nicht so gut beherrscht habe.
n.: Sie haben Slavistik studiert?
D.T.: Ich habe Slavistik im Hauptfach studiert und osteuropäische Geschichte und Politik im Nebenfach.
n.: Können Sie sich noch an Ihr erstes übersetztes Buch erinnern?
D.T.: Ja, jaja klar! (lacht) Das war eine Zusammenarbeit mit einer Freundin, mit der ich auch zusammen studiert habe. Sie ist heute in Tübingen Professorin, Schamma Schahadat. Es war eine Biographie über Marina Cvetaeva, über ihre letzten beiden Lebensjahre. Das war das erste, im Insel-Verlag publizierte Buch, das wir damals zusammen gemacht haben. Ich habe nur einen kleineren Teil davon übersetzt. Das war 1991.
n.: Das Buch haben Sie in Eigenregie übersetzt, oder haben Sie einen Auftrag bekommen?
D.T.: Das war in der Tat so, dass wir das dem Verlag vorgeschlagen haben. Wir hätten es aber vermutlich als Übersetzungsauftrag nicht bekommen, wenn wir nicht die Lektorin gekannt hätten.
n.: Wie ist es danach weitergegangen? Haben Sie im gleichen Verlag wieder etwas übersetzt oder im gleichen Genre..?
D.T.: Ich habe die ersten Jahre relativ wenig gemacht. Es ist gar nicht so einfach, ins Geschäft zu kommen, wenn man noch keinen Namen hat. Eigentlich fing das regelmässige Übersetzen erst Ende der neunziger Jahre an.
n.: Sie sagten, Sie seien beim Übersetzen an einem Kulturtransfer interessiert. Können Sie das bitte etwas ausführen?
D.T.: Zum einen gefällt mir die Arbeit mit Sprache an sich. Sowohl mit der Ausgangs- als auch mit der Zielsprache. Es ist ja beim Übersetzen oft so: Erst mal liest man ein Buch auf Russisch, dann meint man alles zu verstehen, und wenn man dann anfängt zu übersetzen, Wort für Wort, Satz für Satz, merkt man erst, wo die eigentliche Crux an diesem Text liegt. Man muss aber versuchen, den Text in einer Form wiederzugeben, dass ihn auch ein potenzieller Leser versteht. So ist jede Übersetzung auch eine Entdeckung. Gerade jetzt arbeite ich an der Gesamtausgabe von Ivan Bunin, eine Übersetzung, die mir eher zufällig zugeflogen ist, die sich aber als sehr schönes Projekt schon über viele Jahre hinzieht. Bunin war für mich selbst wie auch für den deutschsprachigen Leser eine Entdeckung. Obwohl er der erste Literaturnobelpreisträger war, ist er völlig in Vergessenheit geraten. Einen Autor mit dem Verlag zusammen auf dem deutschsprachigen Markt neu zu positionieren, finde ich eine schöne Aufgabe.
n.: Sie übersetzen das Russische ins Deutsche. Ist es nicht mehr ein Spiel mit der deutschen Sprache als mit der russischen?
D.T.: Ja sicher, weil mir das Instrument trotz Studium und relativ guter Russischkenntnisse immer noch besser zur Verfügung steht. Russisch ist für mich eine Bildungssprache und nicht die Muttersprache. Natürlich bin ich in den Instrumenten meiner Muttersprache sicherer als in denen der Ausgangssprache. Es ist auch kein Zufall, dass man in der Regel in die Muttersprache übersetzt. Man arbeitet stärker mit der Zielsprache. Zum Beispiel in der Überarbeitungsphase, wenn man einen Text übersetzt. Ich mache jeweils zwei bis drei Überarbeitungsphasen. Gerade in der letzten Phase oder im Lektorat und beim Fahnen lesen, da geht es vor allen Dingen um den Umgang mit der deutschen Sprache.
n.: Muss ein Text ein gewisses Merkmal tragen, damit er sich zur Übersetzung eignet? Gerade sprachliche Besonderheiten lassen sich nur schwer übersetzen. Geht nicht der Rhythmus auf Kosten des Inhalts verloren?
D.T.: Der Rhythmus geht verloren, Alliterationen gehen oft verloren aus semantischen oder lexikalischen Gründen, das ist klar. Ich versuche wirklich das zu transportieren, was ich auch transportieren kann und mich nicht so sehr darauf zu fokussieren, was verloren geht. Natürlich versuche ich, möglichst viel beizubehalten, aber wenn man jedes Mal alles mit reinpacken will, dann scheitert man wohl zwangsläufig, man kann einfach nicht weitermachen. Manchmal bin ich zwar versucht, etwas aufzugeben, aber ich versuche, darüber hinwegzukommen. Das geht einem mit wissenschaftlicher Arbeit auch manchmal so.
n.: Inwiefern versuchen Sie, in Ihren Übersetzungen die Eigenschaften des Russischen beizubehalten? Sie haben im Gespräch an der BuchBasel erwähnt, dass Sie zum Beispiel die typischen langen tolstojschen Sätze als solche langen Sätze zu übersetzen versucht haben. Wo hört das Russische auf, und wo fängt das Deutsche an?
D.T.: Das ist sehr schwierig und bei jedem Text ein neues Austarieren. Für mich ist es abhängig von dem Text, den ich übersetze. Ich versuche, generell eher nah am Text zu arbeiten, was aber nicht heisst, dass ich die russische Syntax beibehalte oder russischen Partizipialkonstruktionen, die auf Deutsch ja oft sehr sperrig wirken. Das Russische ist da viel unempfindlicher, auch was Wiederholungen angeht. Wenn man hunderttausend Mal „on skazal“ sagt, variiere ich das auf Deutsch. Es kommt aber auch darauf an. Ich habe einmal in meinem Leben einen Krimi übersetzt. Da geht es darum, dass der Text sich liest, ohne dass der Leser ständig darüber stolpert oder darüber reflektiert, warum der Text nun so kompliziert ist. Wenn es aber ein Autor ist, der formal ganz streng arbeitet, dann ist es mir wichtig, zum Beispiel die langen Satzperioden beizubehalten. Dasselbe gilt, wenn der Text eine gewisse Fremdheit hat, sei es durch Exotismen oder Fremdwörter.
n.: Wenn Sie schon von Fremdheit sprechen – haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihnen eine Textstelle fremd vorkommt und Sie nicht sicher sind, ob das für russische Muttersprachler auch so ist?
D.T.: Ständig (lacht). Das habe ich ganz oft. Man kann eine Sprache bis zu einem gewissen Punkt lernen, aber man kann eigentlich nie sagen, wie es für einen Muttersprachler ist. Ich frage dann meistens Muttersprachler. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass mir verschiedene Muttersprachler unterschiedliche Auskunft geben. Ich habe beispielsweise das Buch von Elena Čižova, die auch an der BuchBasel war, übersetzt. Das Buch heisst auf Deutsch Die stille Macht der Frauen. Es geht um die Leningrader Blockadezeit im Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit. Mir hat die Autorin gesagt, als ich sie zu vielen Stellen fragte: „das ist für jeden Russen sofort klar, was das heisst“. Ich habe dann eine etwa 15 Jahre jüngere russische Kollegin gefragt, und die sagte, dass das für einen Russen überhaupt nicht klar sei. Auch Muttersprachler können oft nicht eindeutig Auskunft geben. Auf jeden Fall versuche ich bei allen Stellen, bei denen ich unsicher bin, nachzufragen. Im Idealfall ist es der Autor selbst, wie zum Beispiel jetzt bei Pelevin. Ich habe ihm alle Stellen per E-Mail geschrieben und mir Erklärungen erbeten. Es könnte aber auch sein, wenn ich sie jemand anderem schicke, dass ich ganz andere Antworten erhalte.
n.: Und wie gehen Sie mit verschiedenen Schreibstilen von Autorinnen oder Autoren um? Kommt Ihnen dabei manchmal Ihr eigener Schreibstil in die Quere?
D.T.: Ich hoffe nicht zu sehr. Ich weiss nicht, ob man sich da ganz frei machen kann davon. Deswegen versuche ich auch möglichst nahe am Text zu arbeiten. Für mich ist der Text schon massgeblich als Hauptrahmen für das, was ich wiedergeben will. Ich würde nicht auf die Idee kommen, einen Autor zu korrigieren oder einfach etwas wegzulassen. Kürzlich hat mir ein Übersetzerkollege gesagt, wenn ein Autor sich wiederholt, würde er die zweite Stelle weglassen, weil die dann nicht nötig sei. Das ist für mich persönlich eine ungewöhnliche Vorgehensweise. Das würde ich nicht machen.
n.: Gibt es Autoren, die Ihnen zum Übersetzen besser gefallen oder näher stehen?
D.T.: Wer für mich wirklich eine Entdeckung war, ist Ivan Bunin. Ich kannte ihn vorher kaum – nur die Texte, die man so kennt, wenn man mal Slavistik studiert hat. Der Herr aus San Francisco, Mitjas Liebe und diese Dinge. Ich wusste wirklich nicht, was für ein grossartiger Autor er ist. Das Dorf kannte ich natürlich, aber diese vielen kleineren Texte, Erzählungen, oder auch die Texte, die wir in dem Band Der Sonnentempel publiziert haben, literarische Reisetexte, von denen hatte ich noch nie gehört. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit dieser Ausgabe weitermachen kann. Es werden wahrscheinlich neun oder zehn Bände, ich bin jetzt gerade am fünften. Ich finde es schön, weil ich mich mit Bunin angefreundet habe. Meistens entdeckt man, wenn man sich auf einen Autor einlässt, viele Dinge bei der nahen Beschäftigung mit dem Text. Diese Dinge sind es, die einen die Schwierigkeiten vergessen lassen oder den Autor oder den Text sympathisch machen.
n.: Wenn Sie eine Übersetzung beginnen, fangen Sie am Anfang an oder suchen Sie sich spezielle Schlüsselszenen heraus?
D.T.: Nein, ich fange immer am Anfang an, ganz banal. Klar, ich lese den Text vorher, damit ich auch eine Idee habe, wie der Rhythmus ist und was überhaupt noch passiert. Ich lese den Text durch und mache ein paar Probeseiten für mich. Dann mache ich eine Hochrechnung, es gibt wirklich auch eine handwerkliche Seite. Ich rechne mir aus, wieviele Zeichen das Original hat und rechne diese auf die sogenannten Normseiten um. Wenn ich die Testseiten mache, schaue ich, wie lange ich ungefähr für die Rohübersetzung brauche. Dann mache ich mir einen Plan, bis wann ich ungefähr fertig sein will oder muss.
n.: Wenn Sie auf eine schwierige Stelle stossen, nehmen Sie die manchmal raus und übersetzen sie erst am Schluss?
D.T.: Den ersten Durchgang, die Rohübersetzung, mache ich ziemlich zügig. Schwierige Stellen markiere ich mir einfach, sowohl im russischen Text als auch in meiner Übersetzung. Die Rohübersetzung mache ich nur mit einem Wörterbuch, damit ich weiss, was ich benutzt habe. In der Überarbeitungsphase, in der ich einen Text-Text-Vergleich mache, benutze ich auch andere Wörterbücher und versuche, einen grossen Teil dieser Fragen zu klären.
n.: Sie bezeichnen das Übersetzen als ein Handwerk. Gibt es auch kreative, künstlerische Momente?
D.T.: Es ist ein Handwerk mit vielen kreativen Aspekten und nicht nicht nur Inspiration oder vdochnovenie, wie Puškin sagen würde. Man muss die Instrumente beherrschen, die Sprachen und die Hilfsmittel. Und diese dann kreativ und phantasievoll einsetzen. Man muss wissen, wo man nachschauen kann. Vielleicht machen das andere Übersetzer anders, aber ich versuche, mir ein Bild vom Text zu machen und das beim Übersetzen beizubehalten.
n.: Eine Ihrer Übersetzungen ist die Urfassung von Tolstojs Krieg und Frieden. Was hat Sie an diesem Text interessiert?
D.T.: Ich wusste vorher gar nicht, dass es so etwas gab. Ich wusste schon, dass es verschiedene Fassungen gab, aber nicht, dass es diese von Tolstoj selbst vorgesehene Endfassung gab. Der Verlag Eichborn in Berlin hatte mich über eine Lektorin angefragt, mit der ich schon zusammengearbeitet habe. Ich habe mir den Text dann angeguckt und fand es faszinierend, dass es so ein erstaunlich fertiges Buch gibt. Es unterscheidet sich auch in vielem von den späteren Fassungen. Auf der kleinen Ebene, auf der Mikroebene, aber auch auf der Strukturebene des Textes. Der Text unterscheidet sich auch inhaltlich und von der politischen Ausrichtung her in ganz vielen Dingen von den anderen Fassungen. Man kann den Autor beim Arbeiten beobachten, wenn man vergleicht, was gestrichen oder hinzugefügt wurde.
n.: Es gibt auch zahlreiche Übersetzungen der späteren Fassung von Krieg und Frieden – wieviele Fassungen braucht ein deutschsprachiges Publikum?
D.T.: Fragen Sie fünf Übersetzer, und Sie bekommen zehn Antworten. Es gibt ja diese Theorie, dass ein Original nicht veraltet, dass aber jede Generation ihre neue Übersetzung braucht. Ich weiss es nicht. Ich bin keine Freundin von Neuübersetzungen um jeden Preis. Es kommt darauf an. Bei Krieg und Frieden zum Beispiel habe ich das sehr genau verglichen. Es gibt eine Übersetzung einer dieser Endfassungen von Werner Bergengruen, der ein bedeutender Autor war und den ich als Übersetzer sehr geschätzt habe. Ich habe ihn in anderen Übersetzungen schon gelesen. Er hat zum Beispiel auch Hadschi Murat von Tolstoj übersetzt. Ich finde, es sind wirklich grossartige Übersetzungen, obwohl sie schon der letzten oder vorletzten Generation angehören. Ich hätte da nicht so viel Ehrgeiz, dagegen an zu übersetzen. Bei Ivan Bunin waren die beiden ersten Bände überhaupt noch nie auf Deutsch erschienen. Bei dem letzten Ivan Bunin-Band, Das Dorf und Suchodol, haben wir zudem eine Fassung genommen, die noch nie übersetzt war. Sie ist ein Drittel länger als die bisherigen Übersetzungen von Das Dorf.
n.: Das heisst, die früheren Übersetzungen von Das Dorf waren gekürzt, oder war es eine gekürzte Fassung, die übersetzt wurde?
D.T.: Genau. Es waren gekürzte Fassungen, die übersetzt wurden. Bei Das Dorf war es ganz interessant. Es gab, glaube ich, zwei DDR-Übersetzungen. Beide beruhten auf einer sowjetischen Ausgabe, die offenbar noch Bunin selber redigiert hatte. Das, was er rausgenommen hat, waren zum Beispiel besonders brutale Szenen. Vermutlich wollte er nicht als Steigbügelhalter der Revolution dastehen, die er abgelehnt hat. Er hat sich also quasi selbst zensiert. Für den deutschsprachigen Markt fand ich es aber interessant, dass man auch die Originalfassung hat, die politisch oder soziologisch einen ganz anderen Aspekt reinbringt. Ich finde aber nicht, dass man ganz grosse Sachen unbedingt neu übersetzen muss, nur um der Neuübersetzung willen.
n.: Sie haben kürzlich den Paul-Celan-Preis erhalten für Ihre Übersetzungen. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
D.T.: Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Es war auch eine grosse Überraschung, weil ich gar nicht wusste, dass ich da auf dieser Liste stand. Ich habe mich gefreut, aber es ist auch eine Verantwortung, weil dieser Preis für ein Buch, aber auch für ein Gesamtwerk vergeben wird. Das hört sich schon so... fertig an. Für mich ist es eher eine Aufforderung, doch noch weiterzumachen. Eine Ermunterung. Das Schöne am Übersetzen ist ja, dass man weitermachen kann, solange man Aufträge und Ideen hat.
n.: Frau Trottenberg, vielen Dank für das Gespräch.