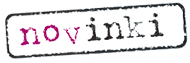Ein Interview mit Milo Rau
Die letzten Tage der Ceauşescus heisst das letzte ‚Stück‘ des International Institute of Political Murder, das 2007 von Milo Rau mit Sitz in Berlin und Zürich zusammen mit Simone Eisenring, Jens Dietrich, Marcel Bächtiger, Nina Wolters und Franziska Dick gegründet worden ist. Das IIPM interessiert sich für die mediale Inszenierung historischer Ereignisse, die sich ins kollektive Unbewusste der Fernsehzuschauer unserer Generation zwar tief eingegraben haben, über deren Zustandekommen, zumindest gilt das für die Ermordung des Ehepaars Ceauşescu, man jedoch ziemlich wenig weiss. Die Idee des IIPM ist es, diese Ereignisse zu rekonstruieren und mit den Mitteln des Theaters zu reinszenieren. Für diese Reinszenierung verwenden sie den Begriff des Reenactments, ein Begriff, der ursprünglich aus der Unterhaltungskultur stammt, aber seit einigen Jahren immer mehr in die Theater- und Kunstszene eingewandert ist.
Die letzten Tage der Ceauşescus hatte 2009 Premiere in Bukarest und war anschliessend in der Schweiz (Bern, Zürich, Luzern) und Deutschland (Berlin) zu sehen. Novinki sprach mit dem Leiter des IIPM, Milo Rau, anlässlich der Premiere des Films im Herbst 2010 zum Stück Die letzten Tage der Ceauşescus. Der Film wurde für Januar 2011 zum Solothurner Filmfestival eingeladen und als einer von 8 Schweizer Spiel-/Dokumentarfilmen für den Prix de Soleure nominiert.
 novinki: Milo, auf der Homepage eures International Institute of Political Murder schreibt ihr, dass es euch darum geht, mithilfe von Reenactments geschichtliche, künstlerische, popkulturelle Ereignisse künstlerisch und theoretisch zu reflektieren. Für welche Art von Ereignissen interessiert ihr euch? Oder anders gefragt, was müssen diese Ereignisse von sich aus mitbringen, damit sie für euch künstlerisch interessant sind?
novinki: Milo, auf der Homepage eures International Institute of Political Murder schreibt ihr, dass es euch darum geht, mithilfe von Reenactments geschichtliche, künstlerische, popkulturelle Ereignisse künstlerisch und theoretisch zu reflektieren. Für welche Art von Ereignissen interessiert ihr euch? Oder anders gefragt, was müssen diese Ereignisse von sich aus mitbringen, damit sie für euch künstlerisch interessant sind?
Milo Rau: Wir interessieren uns ganz bewusst nicht für private, sondern ‚nur‘ für historisch gewordene Ereignisse. Die Hinrichtung der Ceauşescus etwa ist ein Kardinalereignis der Fernsehgeschichte. Die Bilder des Ehepaars an dem Tischchen im Gerichtssaal oder dann die Bilder ihrer Leichen vor der Erschiessungsmauer haben sich mit geradezu ikonografischer Kraft ins kollektive Unbewusste gebrannt. Dies hat letztlich wenig mit ihrer konkreten Bedeutung zu tun – denn weder hatte die rumänische Revolution einen Einfluss auf die Weltgeschichte (die „Wende“ war zu dem Zeitpunkt bereits vollzogen), noch ist der Prozess gegen die Ceauşescus im klassischen Sinn dramatisch. Aber es ist etwas an diesen Bildern, das mir, als ich sie zum ersten Mal im Fernsehen sah, sofort das Gefühl gab: Hier geschieht Geschichte – und viel wichtiger noch: Es gibt also Geschichte! Es ist sehr schwierig zu beschreiben, warum das so ist, dass es einige (und es sind nicht viele) Ereignisse, ‚Nachrichten‘ gibt, von denen jeder weiss, wo und wann er von ihnen erreicht worden ist. Und mit „erreicht” meine ich vielleicht ungefähr das, was Althusser mit „Anrufung“ meint, wenn er sagt: „Die Ideologie ruft die Individuen als Subjekte an.“ Man ist als Einzelner, als Subjekt „gemeint“ von diesen völlig objektiven Ereignissen, die keinen Zusammenhang mit der eigenen Lebensgeschichte haben – von der Mondlandung, vom Fall der Türme, vom Tod Kennedys. Man ist „gemeint“ von der Geschichte, von diesen beiden Diktatoren, von ihrem Schicksal in einem öden, ländlichen Gerichtssaal in einem fremden Land. Ja, man ist gemeint von etwas völlig Abstraktem und erkennt sich darin ganz körperlich als historisches Subjekt.
Neben diesen eher emotionalen Vorbedingungen oder Qualitäten, die ein Ereignis für unsere Arbeit interessant machen, gibt es natürlich auch rein faktische: Es muss relativ gut dokumentiert sein, denn sonst ist ja eine Re-Inszenierung nicht möglich. Wobei auch diese Ebene – die einer Genauigkeit oder Detailtreue – eher eine der möglichen Intensität als eine wissenschaftliche ist. Es geht nicht um Wahrheit im technischen, sondern um Wahrheit, um Wieder-Holung im Kierkegaardschen Sinn. Es geht um die Wiederherstellung einer Situation, einer Ergriffenheit, nicht eines korrekten Bedeutungszusammenhangs. Und deshalb kann es sein, dass eine einzige Zeugenaussage, ein unscharfer Schnappschuss mehr dazu beiträgt, um ein historisches Grossereignis zu re-enacten, als ein gewaltiges dokumentarisches Archiv.
n.: Dann interessiert euch weniger das historische Ereignis selbst, sondern eher die Frage, wie dieses Ereignis als medial Vermitteltes in Erscheinung getreten ist? Also als mediales Ereignis, als Bild, als Kameraeinstellung, als Bildmontage, als Appell oder Anrufung? Geht es – als Ausgangspunkt – um das sekundäre, medial vermittelte Erleben, dem eine eigene Aura zukommt?
M. R.: Das stimmt, der Ausgangspunkt dieser ganzen Arbeit war eine private Fernseh-Ergriffenheit: Die eines 12-jährigen Jungen, der Ende der 80er Jahre an Weihnachten vor dem Fernseher sitzt. Diese quasi-mythologische Erfahrung hat dann auch 18 Jahre später die theatrale Wunschmaschine überhaupt erst in Gang gesetzt, und als ich das erste Exposé zu Ceauşescu geschrieben habe, da ging es mir nur um die möglichst genaue Evokation genau dieser einen Erfahrung. Ich wollte dieses Tele-Tribunal, diesen medial vermittelten Vorgang so zwingend und überwältigend real werden lassen, wie er mir damals in meinem kindlichen Gemüt erschienen ist. Sobald aber die Recherchen beginnen, also der praktische Vorgang des Wieder-Holens eines Ereignisses, etabliert sich eine Interferenz zwischen beiden Bereichen: dem realen Ereignis (der Spur) und seiner medialen Abbildung und der damit verbundenen Ergriffenheit (der Aura). Also zwischen der „historischen Wahrheit“, die sich durch eine technische Untersuchung des Videos, durch Zeugenaussagen, durch Ortsbegehungen und logische Schlussfolgerungen annäherungsweise ermitteln lässt – und dem, was Robbe-Grillet in seinem Roman Die Wiederholung die „objektive Wahrheit“ nennt, die Wahrheit der Erfahrung eines 12-jährigen – letztlich also jener Generation, die die politische Wende im Fernsehen zu einem Zeitpunkt mitverfolgt hat, als sie von Kindern zu Erwachsenen wurden. Was deshalb sicherlich am Anfang aller für Die letzten Tage der Ceauşescus gemachten Anstrengungen steht und zugleich ihr Ziel ausmacht, das ist die Aura, nicht die korrekte Wiederholung eines Ereignisses. Es geht um die szenische Rekonstruktion eines Paradoxes, um die künstlerisch hergestellte „Erscheinung einer Ferne“, wie Walter Benjamin den Begriff Aura definiert. Das Erleben einer solchen Ferne ist zwingend sekundär, also ‚medial‘ im weitesten Sinn, aber ich denke, dass das Spektrum der Medien, ihrer Erfahrungsweisen und damit der formalen Ansprüche an die Evokation sehr-sehr weit ist.
n.: Wie habt ihr versucht, die Aura der Fern-Seh-Erfahrung von 1989 in euer Reenactment, das ja eher eine Nah-Seh-Erfahrung ist, einzubringen? Habt ihr euch also auch Gedanken gemacht über die Rolle der Zuschauer eures Reenactments? Als was/wen wolltet ihr die Zuschauer ansprechen?
M. R.: In Rumänien und später auch in Berlin und der Schweiz ist uns mit Die letzten Tage der Ceauşescus etwas Seltsames passiert: Das Publikum hat nicht geklatscht – in Bukarest überhaupt nicht, und in Westeuropa sehr spät, also erst nach zwei, drei Minuten Stille. Einerseits hängt das natürlich mit dem Thema und der Dramaturgie des Abends zusammen. Andererseits hat es etwas mit dem performativen Status eines Reenactments zu tun, einer Form, die die Zuschauer zu intimen Zeugen einer Situation macht, die völlig verbürgt ist, kurz: Was man sieht, ist im allerschlichtesten Wortsinn wahr und tatsächlich so passiert. Jede Möglichkeit der Distanzierung wird von der schieren Realität der Aufführung erbeutet, und die Zuschauer müssen ihre ‚Rolle‘ nach dem Ende des Stücks erst wieder finden, sie müssen sich gewissermassen erinnern, was nun zu tun ist – nämlich klatschen. Und an diesem Klatschen ist etwas substantiell Schuldhaftes: Denn wie kann man einen Mord beklatschen, auch wenn er noch so verdient ist? Um ehrlich zu sein, waren mir diese beiden Umstände während der Inszenierung nicht bewusst – nämlich, dass wir die Zuschauer gewissermassen gezwungen haben, Stellung zu nehmen zu etwas, das viel zu widersprüchlich ist, um sich irgendwie dazu zu positionieren. Das rumänische Publikum war sehr sensibel für dieses unmoralische Angebot, das ihnen Die letzten Tage machte, und die bleierne Stille nach der Inszenierung, die Verwirrung und Verweigerung des Publikums war Gegenstand vieler Kritiken. Diese übertriebene, fast verbrecherische Zeugenschaft war auch im Westen einigen Leuten so unangenehm, dass wir schliesslich dazu übergegangen sind, ihnen zu „helfen”: Wir haben in Berlin und der Schweiz nach einer Minute Dunkelheit ein klassisch interpretiertes Volkslied eingespielt, eine (wie viele Volkslieder) sehr einfache und berührende Musik. So als würde sich ein Fenster auftun im dunkeln Himmel des Geschichtspessimismus der Letzten Tage, als hätte der Theaterabend in einem höheren Sinn einen guten Ausgang gehabt, als sei eine alte Geschichte erzählt worden und nun alles wieder in Ordnung. Leider ist es uns nicht gelungen, diese sehr starke und sehr brutale Wirkung des Abends in der Aufzeichnung zu konservieren – aber das gelingt ja nie.
n.: Geht es nicht eher um das Problem, nicht zu wissen, was man beklatscht? Das historische Ereignis oder euer Reenactment, wobei das Reenactment sein Theatersein zwar nicht ganz leugnet, aber doch zumindest soweit herunterfährt, dass das historische Ereignis nicht überblendet wird. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich in dem Moment eigentlich beklatsche und mir womöglich Gedanken darüber gemacht, man könnte meinen, ich beklatsche den Mord an den Ceauşescus oder die Dramaturgen ihres Tribunals. In Moskau hat vor ein paar Jahren eine Künstlergruppe einen ‚Schauprozess‘ veranstaltet im Kunstkontext. Die Zuschauer dachten, sie nehmen an einer Performance teil und beklatschten die ‚Nähe‘ zur Rhetorik der Schauprozesse. Dabei handelte es sich aber um den Ausschluss eines Mitglieds der Künstlergruppe aus der Gruppe, also nicht um Kunst.
Ich will noch mal in eine ganz andere Richtung fragen. Euer Film zeigt, im Unterschied zum Reenactment im Theater, mehr historische Einbettung, viele Originalaufnahmen, die dann kontrastiert werden mit der Reinszenierung im Theater in Bukarest. Warum habt ihr den Film gemacht?
M. R.: Deine Beobachtung zur Einbettung stimmt, und das ist wohl auch der Grund, warum die Wirkung des Films eine sehr andere als die des Theaterabends ist – eigentlich die gegenteilige. Während das Stück auf eine möglichst deckungsgleiche Überblendung von Ereignis und Wiederholung setzt, was bei den Zuschauern den von dir beobachteten Effekt hervorruft (“Wofür klatsche ich eigentlich?”), ist im Film die Selbstbefragung des Zuschauers schon in der Montage präsent, was eine sehr grosse emotionale Entlastung mit sich bringt. Der Film kommentiert sich selbst, er ist sehr viel klassischer, sehr viel ‚dokumentarischer‘ oder eben analytischer als das Stück; weniger monumental, menschlicher. Das hat damit zu tun, dass wir den Film fürs Fernsehen gemacht haben, wo es ja so etwas wie das ‚dokumentarische Genre‘ gibt und die Sache auch irgendwie interessant und vor allem selbsterklärend sein muss.
 n.: Kannst du vielleicht ein Beispiel für den Unterschied geben?
n.: Kannst du vielleicht ein Beispiel für den Unterschied geben?
M. R.: Während man etwa im Stück, wenn man es nicht weiss, mehr oder weniger nichts über die doppeldeutige Rolle General Stanculescus erfährt (Ceauşescus Lieblingsgeneral und zugleich Organisator des Prozesses), ist eine wichtige Ebene des Films um seine Person, um das „Et tu, Brute“-Moment herum aufgebaut. Es hat aber auch rein technische Gründe: dass die Kamera nah dran ist, dass man zwischen den Figuren oder auch zwischen Prozess, Archiv und Kommentar schneiden kann und sich dadurch automatisch eine Dramatisierung ergibt. Und Dramatisierung ist immer Kommentar, Kanalisierung, Entlastung. Ein rumänischer Filmregisseur, der sich unseren Film jetzt auf dem Festival d’Avignon angesehen hat und selber einen Film über das Ende der Ceauşescus dreht, hat uns interessanterweise folgenden Tipp gegeben: Immer nur die Kamera zu zeigen, die auf die Ceauşescus gerichtet ist, also die Möglichkeiten der Montage so weit wie möglich einzuschränken. Natürlich können wir das nicht machen, denn dann würde der Film nicht einmal mehr im Nachtprogramm von ARTE laufen. Übrigens ist es so, dass die Idee, einen Film zu machen, vor der Idee zum Stück für die Bühne da war. Das Bühnenstück war dann die technische Vorbedingung dazu, aber natürlich haben ich und mein Co-Regisseur im Filmbereich (Marcel Bächtiger) sehr schnell, also schon weit im Vorfeld gemerkt, dass der Medienwechsel – das tatsächliche Im-gleichen-Raum-Sein – der entscheidende Punkt an der Sache ist. Der Film ist so im Produktionsprozess sekundär geworden, wie übrigens auch das Buch. Es hat sich dann alles um die szenische Wiederholung, ums Reenactment herum angeordnet, wie ein Netz um die Spinne. Und wie es sich ja meistens mit zentralen Ereignissen verhält, ist es nun gerade diese Position, die auch im Film leer, unerfahrbar bleibt. Theater ist eben immer irgendwann abgespielt – wie die Geschichte selbst.
 n.: Arbeitet ihr in Zukunft weiter an Reenactments?
n.: Arbeitet ihr in Zukunft weiter an Reenactments?
M. R.: Fürs HAU Berlin entwickeln wir unter dem Titel Hate Radio eine Rekonstruktion des Radiostudios RTLM, das zwischen April und Juni 1994 in Ruanda die Ermordung von fast einer Million Menschen als eine Art Werbekampagne vorbereitet und dann mit Talkshows, rassistischen Aufrufen und einem speziell darauf abgestellten Musikprogramm begleitet hat. Wir werden das Studio nachbauen, bespielen und tatsächlich auf Sendung gehen. In den Vorräumen des Studios werden aber die Opfer des Völkermords zu Wort kommen. Auch dieses Projekt ist motiviert durch eine mediale Erfahrung: Ich habe vor etwa zehn Jahren in einem Film über den Genozid in Ruanda eine kurze Tonspur aus dem Programm des RTLM gehört und konnte bis heute den geradezu teuflischen Eindruck dieser Stimme, dieses fröhlichen, mit Hip-Hop unterlegten Singsangs, der zum Mord an Kindern aufruft, nicht aus dem Kopf kriegen. So, als hätte ich auf einmal ‚verstanden‘, was es eigentlich heisst, dass zu dem Zeitpunkt, als ich als Jugendlicher auf Konzerte gegangen bin, zu einer sehr ähnlichen Musik Millionen Menschen ermordet wurden. Das andere Projekt steht noch in den ersten Anfängen, wir entwickeln es mit dem Nationaltheater Weimar, der Menschenrechtsorganisation Memorial und Tänzern des Bolschoj: Es ist ein Stück über die Moskauer Schauprozesse, speziell den letzten Prozess gegen den Block der Rechten und der Trotzkisten von 1938.
n.: Das Totalitäre bzw. der ehemalige Ostblock scheint euch irgendwie anzuziehen?
M. R.: Hier liegt die ‚Inspiration‘ ebenfalls irgendwo in meiner Kindheit. Meine Eltern waren Trotzkisten, die Figur Stalins – in der Ideologie der 4. Internationale ja immer nur Trotzkis Mörder, der Judas der Weltrevolution gewissermassen – stand deshalb meine ganze Kindheit hindurch als grosse Negativfigur, als finstere Chiffre über dem damals schon absehbaren Untergang des Sowjet-Kommunismus. Als mich nun Weimar anfragte, ob ich was zum GULAG machen will, da wusste ich sofort, dass es etwas über diese Prozesse werden würde, dass dies mit Musik und Tänzern geschehen sollte, dass es Dauer, Grösse und eine Art Überwältigungsästhetik haben müsste, fast wie eine Oper – also ein stalinistischer „Ring“, der wiederum durch Erzählungen der Opfer der Grossen Säuberung konterkariert und gesteigert wird. Es ist also jedes Mal ein sehr anderer Ausgangspunkt, und vom einfachen Fernsehbild bis zur quasi-abstrakten medialen Grosskonstellation ist alles möglich: Bei den Letzten Tagen der Ceauşescus war es ein Videogramm, bei Hate Radio eine Stimme und eine Musik aus dem Äther, bei den Moskauer Prozessen ein ganzes Narrativ: der Stalinismus.
n.: Da bin ich gespannt. Ich habe mich auch selbst mit den Schauprozessen beschäftigt. Der russische Regisseur Nikolaj Evreinov hat übrigens im Pariser Exil ein Stück über die Schauprozesse geschrieben, auch eine Art Reenactment. Er hatte damals die zensierten ‚Protokolle‘ der Schauprozesse in der sowjetischen Pravda gelesen und diese für sein Stück benutzt. Er hat die Schauprozesse quasi zurückgeholt ins Theater. Seine Schlusspointe ist eine Anrufung an das Publikum. Die Figuren auf der Bühne, der Angeklagte Bucharin, der Staatsanwalt Vyšinskij etc. geben am Schluss zu, nur Theater gespielt zu haben und fragen das Publikum, warum sie das nicht bemerkt haben und warum sie sich so etwas anschauen. Evreinov unterstellt dem Publikum am Schluss ein Begehren und zwar jenes, sich unterhalten zu lassen. Dienen eure Reenactments auch einer Art Entlarvung eines Begehrens, z.B. Teil von historischen Ereignissen sein zu wollen und sei es nur als Zuschauer?
M. R.: Das ist eine sehr schwierige Frage – nicht theoretisch, sondern praktisch gesehen. Für die deutsche Kunst ist ja seit der faschistischen Wirkungsästhetik (und ihren Folgen) unkritische Immersion oder gar Überwältigung eigentlich der verbotene Apfel überhaupt, und das zu Recht. Vom sozialpsychologischen Standpunkt aus bin ich wie jeder klar denkende Mensch für Entlarvung und gegen Immersion, insbesondere wenn es um die Entlarvung einer so atavistischen und asozialen Neigung wie der in den Schauprozessen zum Tragen kommenden Bestrafungssehnsucht geht. Die einzige Lehre aus der Gewaltgeschichte der letzten hundert Jahre ist es, dass der Mensch genau so sadistisch ist, wie es ihm das Gesetz bzw. die jeweilige Situation erlaubt, oder anders ausgedrückt: Sobald die Bühne eines Gerichts bereitet ist, sind die Henker nicht weit.
n.: Kannst du das erläutern?
M. R.: Dazu kann ich gern ein Beispiel aus meinem privaten Leben geben: Vor ein paar Monaten wurde in einigen Schweizerischen Medien (zuerst in Boulevardblättern wie 20minuten oder Blick, dann aber auch in der NZZ, dem Schweizer Fernsehen etc.) irrtümlich behauptet, ich würde ein Theaterstück über die Leiden einer armen Witwe vorbereiten und dies aus reinem Profitinteresse, worauf ich, das Theater und meine ganze Familie im Lauf weniger Tage über hundert Morddrohungen erhielten, jede unter Hinweis darauf, dass wir es „verdient“ hätten. Meine Eltern mussten den Wohnort wechseln, das Theaterprojekt (das einen komplett anderen Inhalt als den behaupteten hätte haben sollen) musste abgesagt werden. Was mich an den Artikeln, Leserbriefen und Mails am meisten erschreckt hat, war die lustvolle Selbstverständlichkeit, mit der die Illusion einer ‚Gefährdung‘ des gesellschaftlichen Lebens konstruiert, jede Rücksichtnahme fallen gelassen und jede Richtigstellung als zusätzliche Frechheit gewertet wurde – ähnlich wie Bucharins Hinweise auf allzu offensichtliche Widersprüche in Vyšinskijs ‚Beweisketten‘ ja immer nur eine weitere Bestätigung seines rechthaberischen, abweichlerischen, „jüdischen“ Charakters waren. Von den Hexenprozessen über die Schauprozesse bis zu dem verglichen damit natürlich völlig bedeutungslosen ‚Theaterskandal‘, dessen Opfer ich wurde: Das Begehren, rechtschaffener Teil eines Strafgerichts zu sein, ist stärker als jede Diskussionskultur, und Roland Barthes hat in seinen Mythen des Alltags behauptet, die „Philosophie des Heimzahlens und der Abrechnung“ sei überhaupt die einzige Dialektik, die der Durchschnittsbürger verstehen würde. Nun ist das Anprangern dieses bedauerlicherweise normalsten menschlichen Verhaltens das eine, das Herstellen einer kathartischen Situation, also der schuldhaften Verstrickung des Zuschauers in ein Bühnengeschehen eine völlig andere.
n.: Glaubst du wirklich an Katharsis?
M. R.: Der Zuschauer muss sich selbst als Täter erlebt haben, er muss von der Handlung im Althusserschen Sinn gemeint sein, er muss sich tatsächlich fragen, warum er nicht anders (oder überhaupt) gehandelt hat, und diese Selbstbefragung muss schmerzhaft, bohrend sein. Ich will dazu noch einmal ein Beispiel geben: Vor einigen Wochen war ich in der Volksbühne, und in einem slowenischen Stück wurde, nachdem darüber abgestimmt worden war, ein Messer gewetzt und ein Huhn geschlachtet. Etwa fünf Zuschauer verliessen den Saal, die anderen (unter anderem ich selbst) blieben wie versteinert sitzen, kicherten hysterisch und versicherten sich gegenseitig, dass ‚überhaupt nichts‘ geschehen würde. Dann starb das Huhn, das Licht ging an und eine Art generelles Schuldig-geworden-sein legte sich über die Zuschauer. Die normalen Entlastungsreaktionen traten ein: Die einen zweifelten an der Realität der Schlachtung (obwohl alle den Leichnam des Huhns gesehen hatten). Die anderen richteten Vorwürfe an die slowenische Künstlergruppe, die ihnen das zugemutet hatte (obwohl sie selbst für den Tod des Tiers gestimmt hatten). Die dritten flüchteten sich in die altbekannte Argumentation, dass man, da Fleischesser, ohnehin tagtäglich mitschuldig an so-und-so-vielen Morden würde (die man aber nie zu Gesicht bekommt). Und einige Unentwegte versuchten sogar, hinter die Bühne zu gelangen, um dort ein lebendes Huhn anzutreffen oder mit den slowenischen Künstlern eine Prügelei anzufangen. Die Formel lautet also: Ohne Überwältigung keine Entlarvung. Und insofern ist Evreinovs Strategie natürlich auch die, die ich selbst als die richtige (oder einzige mögliche) erachte.
n.: Žižek hatte ein ähnliches Verfahren bei Laibach und der NSK als „Überidentifikation“ beschrieben. D.h. die Aktionen oder Performances waren so angelegt, dass die Zuschauer oder Teilnehmer sich zunächst mit dem Geschehen identifizieren sollten, um später diese Identifikation zu reflektieren. Bei einem Gerichtsprozess findet noch etwas anderes statt, da identifizieren sich die Zuschauer mit der Rolle, die ihnen im Gerichtsprozess zugewiesen wird, und zwar zuzuschauen. Sie geniessen diese Rolle, geniessen auch den kathartischen Effekt des stellvertretenden Erlebens des Verbrechens und werden sich dann am Schluss ihres Genusses bewusst. Schwebt euch so etwas vor, wenn ihr Reenactments macht?
M. R.: Ja, wobei ich denke, dass das vielleicht jedem Künstler und auch jedem Theoretiker oder Politiker vorschwebt – eine Rezeptionssituation zu schaffen, in der das Verhandelte so intensiv erlebt wird, dass die Barriere zwischen passivem Zuschauen und aktivem Nachvollzug überschritten wird, in der der Zuschauer mitschuldig wird an etwas, in das er rein faktisch betrachtet nicht direkt verwickelt ist. Ich habe vor einiger Zeit einen albernen, aber sehr eindrücklichen Horrorfilm gesehen, The Gathering, in dem es um genau diese Thematik geht: um das Schuldigwerden durch Schaulust, durch den Genuss am Leiden anderer. Konkret handelt The Gathering von der ewigen Verdammnis der Seelen jener Leute, die bei der Kreuzigung Jesu zugeschaut haben und deshalb über die Jahrtausende hinweg gezwungen sind, immer wieder bei Katastrophen dabei zu sein, immer wieder Sterbende, Leidende zu sehen, bis ihnen der Genuss am Zuschauen im christlichsten Wortsinn ausgetrieben ist. Doch ich weiss nicht, ob das ausgetrieben, oder wie man in der Psychoanalyse sagen würde: sublimiert werden kann, auch wenn man eine Seele (oder ein Augenpaar) 2000 Jahre nicht zur Ruhe kommen lässt. Als Kind sah ich in einer Ausgabe der NZZ ein postkartengrosses Bild, das ich ausgeschnitten und immer wieder angeschaut habe. Es war in den späten 1930ern aufgenommen worden, nach der Besetzung Chinas durch Japan, und zeigte eine Art Krater oder Graben, an dessen Rand gefesselte, seltsam gleichmütige chinesische Soldaten standen. Unten lagen ein paar von ihnen am Boden, und vor dem Leichenberg stand in Angriffsstellung ein japanischer Soldat mit einem Bajonett. Der Untertitel des Bilds lautete: „Die japanische Armee erprobt ein neues Bajonett”. Und das war eine zwanghafte Erfahrung: Ich musste immer wieder in die Augen und die Gesichter der wartenden chinesischen Soldaten und des Manns mit dem Bajonett schauen. Es war eine Art Genuss, aber ein sehr schrecklicher, klarer. Ich hatte, wenn ich dieses Bild hervorholte, immer das Gefühl, dass ich, könnte ich etwas über diesen Genuss in Erfahrung bringen, auch etwas über den Tod lernen würde (und natürlich das Töten, das mich noch viel mehr interessierte). Ich erinnere mich sehr genau, wie ich jedesmal dachte: Diesmal werde ich es begreifen – und mir dann das Bild konzentriert vor die Augen hielt wie jene Suchbilder, die man nur ein paar Sekunden anschauen darf und dem Doktor dann möglichst viele der gezeigten Gegenstände nennen muss. Was ich damit sagen will: Es war eine sehr-sehr kühle, analytische, und zugleich eine absolut auf Genuss, auf Angst und Triumph ausgerichtete, ja sadistische Aktion, wenn das Kind, das ich damals war, auf diese längst schon toten Chinesen und Japaner starrte. Es war ja ein Bild, also musste ich es verstehen können. Und doch verstand ich es nicht. Es gab keinen Lösungsweg, aber ich hatte das Gefühl, die Lösung stehe ganz bildlich vor mir. Obwohl ich das Bild verloren habe, schaue ich es heute noch an, innerlich, ein Vierteljahrhundert später.
n.: Was machst du mit dieser Kindheitserkenntnis im Theater?
M. R.: Fürs Theater oder die Kunst konkret heisst das, dass man Situationen schaffen muss, in denen diese Zerrissenheit zur Erfahrung wird: diese Mischung aus Überidentifikation, also dem Genuss des stellvertretenden Lebens, des stellvertretenden Tötens und Sterbens, und dem Nicht-Verstehen, also der Beschreibung des Abstands, der immer da ist zwischen sich selbst und einem Bild, einem Schauspiel, einem anderen – und in dem sich eben auch so etwas wie „Schuld“, „Haltung“ oder „Katharsis“, also all diese Formen emotionaler oder moralischer Analyse entwickeln können. Wonach ich als Kind auf der Suche war, wenn ich mir die Bajonettierung dieser Menschen anschaute, war tatsächlich eine ‚Auflösung‘, das plötzliche Aufbrechen einer Distanz, eines Sinns in der ganzen unverständlichen Krassheit, in die diese Erwachsenen vor so vielen Jahren und so weit entfernt verwickelt gewesen waren (und von der ich ausging, dass ich es später auch sein würde). Kunst – und Theater im speziellen – ist ja nicht nur deshalb auf eine geradezu renitente Art und Weise ‚krass‘, weil das einer avantgardistischen Verabredung oder der Selbsterfahrung der Schauspieler zuträglich wäre, sondern weil das situative Verstehen erst in einer ganz bestimmten Überspanntheit zu funktionieren beginnt. Gerade wo Theater oder Kunst allgemein am ‚künstlichsten‘ ist, funktioniert sie am besten, und ich habe mich deshalb immer gewundert, dass viele Kritiker, wenn es um das geht, was sie ‚dokumentarisch‘ nennen (und auch Reenactments werden, der Einfachheit halber, noch zum ‚Dokumentarischen‘ gezählt), von einer Thematik sprechen, die „interessant“ oder eben „langweilig“ sei, „nachvollziehbar“. Aber was ist denn nachvollziehbar, interessant oder langweilig an dem, was dort in China im Graben geschah? Was beschreiben denn diese Wörter überhaupt von dem, wonach ich in meinem kindlichen Sadismus auf der Suche war? Was hätte mir dabei irgendein Hintergrundwissen über den japanisch-chinesischen Krieg geholfen? Denn das Interessante an solchen Szenen, an solchen Bildern ist ja, dass man sie nicht verstehen muss, um stillzusitzen und mitgerissen zu sein. Letztlich funktioniert hier das berühmte psychoanalytische „Je sais, mais quand-même“, also die Grundfigur des Menschenverstands: “Das alles ist ja nur ein Bild, ein Schauspiel, und ich bin nur ein Betrachter. Aber trotzdem...”
n.: Ein bisschen wie Schlingensiefs „Tötet Helmut Kohl“, wo er dann immer zur Beruhigung derer, die an das Theater als Theater glauben, sagte, aber das ist doch alles nur Theater… Woraus besteht dann das „Trotzdem“?
M. R.: Dieses „Trotzdem“ ist natürlich die Unwiderruflichlichkeit, das So-Sein des REALEN (im Sinn Lacans): dass diese Spielfiguren, diese Japaner und Chinesen, diese 30er-Jahre-Menschen nicht wieder aufgestellt werden, dass ein Wesen leidet und zu Grunde geht, dass jemand zusticht mit einer bestimmten Geschwindigkeit und einer bestimmten Kraftanstrengung und einem wirren Empfinden, es also Positionen in diesem ‚Spiel‘ gibt, die REAL sind, die aus der allgemeinen symbolischen Verabredung herausfallen. Und bei guten, das heisst funktionierenden Kunstwerken, wie jenes Bild eines war, wird man von dieser REALITÄT selbst infiziert. Man wird von ihr nicht nur belästigt, analysiert, abgestossen oder hysterisiert, verpestet oder gereinigt, sondern gleichsam unheilbar verwirrt und zerrüttet, man hört einen Ruf, den man nicht versteht, obwohl er verdammt laut ist.
n.: Was bedeutet das alles für das Reenactment?
M. R.: Ein Reenactment, glaube ich, tut nun genau dies: In die völlig offengelegte Verabredung, dass alles nur ein Spiel, ein Bild, eine Reproduktion, eine Wiederholung ist, die REALITÄT selbst herein zu tragen, also die beiden alten geschichtsphilosophischen Widersacher auf die Bühne zu zerren – den objektiven Sinn und das subjektive Leiden, das „Wir wissen, dass dies ein Bild ist“ und das „Es ist so geschehen, Wirklichkeit“. Ein funktionierendes Reenactment und überhaupt ein funktionierendes Kunstwerk reaktiviert also im Zuschauer die Historizität seines Empfindens, seinen körperlichen, mimetischen Drang, das Schrecklichste mitzuerleben und seinen Wunsch nach Gewissheit, es zu verstehen, eben einen Sinn daraus zu ziehen. Ich würde hier gern mit einer allgemeinen Betrachtung schliessen: Nach über einem halben Jahrhundert verschärfter Repräsentationskritik, bei der man davon ausging, dass man es dem REALEN und den Wächtern der GEWISSHEIT schon irgendwie zeigen würde (der Geschichte, dem Totalitarismus, dem Subjekt, dem Geschlecht, dem Tod), dass am Schluss alles zum fröhlichen Spiel der immateriellen Simulacren und zur demokratischen Collage irgendwelcher Diskurse würde und sogar die Toten irgendwo zwischengelagert und bei Bedarf wieder auf die Bühne geholt werden könnten, während die Lebenden sich wie kleine Hündchen gegenseitig Zitate zuwerfen. Im Vergleich dazu ist man heute, glaube ich, einiges ernster geworden, oder, wenn man so will, ‚realistischer‘. Ich weiss nicht, warum das so ist, aber es ist so.
n.: Sind Reenactments nicht Simulacren schlechthin?
M. R.: Ja, das stimmt, wobei es natürlich zweierlei Arten gibt, wie der Begriff ‚Simulacrum‘ verstanden werden kann: der eine wurde von Barthes in den frühen 60ern in die Diskussion eingeführt, der andere wurde durch Baudrillard etwa dreissig Jahre später populär. Für Barthes war das Herstellen von Simulacren der eigentliche Kern der theoretischen Praxis, quasi ihr inszenatorisches Prinzip: Der Theoretiker stellt ein (künstliches) Double her, um im Auseinanderbauen und Wiederzusammenfügen der Einzelteile einer Vorlage (etwa der verschiedenen Bildelemente einer Werbefotografie oder der syntaktischen Elemente eines Satzes von Flaubert) ihr Funktionieren zu verstehen. Wie man weiss, begann sich Barthes dann etwas später vor allem für jene Teile zu interessieren, die eben gerade nicht „funktionierten“, die „überflüssig“ waren und deshalb, wie er schrieb, „nichts anderes als die Realität selbst meinten“. Barthes Simulacrum-Begriff bezeichnet damit die paradoxe oder unmögliche Arbeit einer repräsentativen Verdoppelung, das unauflösbare Hier- und Dortsein eines Reenactments, der unabweisbare Realitätsgehalt einer Abbildung, dieser ständige „Überfluss“ des Realen. Baudrillard dagegen kappt diese Beziehung – etwa in seinen Untersuchungen zu den „dokumentarischen“ Bildern aus dem Irak-Krieg – und kommt damit zu einem ganz anderen Simulacrum-Begriff. Das Baudrillardsche Simulacrum meint eine unabhängige, künstliche Zeichen-Welt ohne Referenten, ohne Körper und vor allem ohne Geschichte. Für Baudrillard hat der Irak-Krieg, den wir ja nur aus Bildern kennen, „nicht stattgefunden“, und zweifellos hätte er, hätte ich ihn zu den Ceauşescus befragt, darauf beharrt, dass auch die rumänische Revolution eine reine „Tele-Revolution“ war.
Aber wie auch immer – und das mag wie gesagt spitzfindig erscheinen: Ich finde den Begriff „Simulacrum“ für Reenactments sehr zutreffend, nur würde ich ihn gern altmodisch verstanden wissen, also im Sinn von Barthes. Denn Reenactments sind, in erster Linie, kein Produkt, sondern eine Praktologie, also der Versuch, eine Kunstpraxis zu finden, die sich der Unmöglichkeit der Darstellung von Wirklichkeit ganz aussetzt – und zwar, indem der ursprünglichste Kunstakt überhaupt, also das Darstellen von Etwas, das geschehen ist, wiederholt und in Szene gesetzt wird.
n.: Danke für den ausführlichen E-Mail-Wechsel!