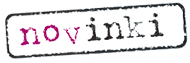Es gehört zum paradoxen Dasein jener Schreibenden, die in ihren Texten die sprachlichen Finessen ihrer Muttersprache zelebrieren, dass ihr Erfolg im fremdsprachigen Ausland von den Qualitäten der Übersetzer abhängig ist. Und nicht selten teilen gerade die talentiertesten unter diesen auf die Sprache fokussierten Autoren das bedauernswerte Schicksal, dass sich kaum jemand an einer Übersetzung versucht – sie bzw. ihre Werke sind, sozusagen, lost in translation, wie man es mit Sofia Coppola ausdrücken mag.
Saša Sokolov (Sascha Sokolow) reiht sich ein unter jene Schriftsteller, deren Erfolg beim ausserrussischen Publikum bei der Übersetzung verloren gegangen ist. Seine Texte dringen so tief in die Seele der russischen Sprache ein, dass selbst Muttersprachler sich darin zu verirren Gefahr laufen. Für die deutschen Leser hingegen bleiben Sokolovs Bücher zum grössten Teil eine Symphonie, deren Pracht ihnen als taube Rezipienten unzugänglich bleibt. Und dies ist schade.
Saša Sokolov wurde am 6. November 1943 im kanadischen Ottawa geboren, wo sein Vater Vsevolod Sokolov als Major des Geheimdienstes bei der sowjetischen Botschaft angegliedert war. Major Sokolov spielte eine zentrale Rolle bei der Informationsübermittlung über das amerikanische Atomprogramm. Nach dem Auffliegen des Spionagerings im Jahr 1946 kehrten die Sokolovs nach Moskau zurück. Dank der hohen Stellung des Vaters genoss die Familie ein Leben über dem damaligen Standard: eine Datscha ausserhalb Moskaus, ein Dienstwagen und Sommerferien am Schwarzen Meer zeugen von den Annehmlichkeiten der Macht.
Nach seinem Schulabschluss schrieb sich Saša Sokolov 1962 ins Institut für Fremdsprachen der Armee ein, wo er während dreier Jahre Englisch und Spanisch studierte. Mehr schlecht als recht mit den strikten Regeln des Instituts zurechkommend, simulierte er ein schizophrenes Leiden, wofür er drei Monate in einer psychiatrischen Anstalt verbrachte. Im Februar 1965 wurde er aus der Klinik und aus dem Militärdienst entlassen.
Zurück in Moskau wurde Sokolov Mitglied der literarischen Bohème und schloss sich der Autorengruppe SMOG (Smelost’, Mysl’, Obraz, Glubina oder Samoe Molodoe Obščestvo Geniev) an, der unter anderem Leonid Gubanov, Jurij Kublanovskij, Vladimir Alejnikov oder Arkadij Pachomov angehörten. Von 1966 bis 1971 studierte Sokolov Journalistik an der MGU und schrieb nebenbei für verschiedene Zeitungen. In der Zeitschrift Novorossijskij rabočij erschien 1967 seine erste Erzählung Za molokom. 1971 wurde seine Kurzgeschichte Staryj šturman vom Magazin Naša žizn’ als „beste Geschichte über einen Blinden“ ausgezeichnet.
Nach dem Abschluss des Studiums arbeitete Sokolov über ein Jahr als Wildhüter in der Oblast’ Kalinin an der oberen Wolga. Er nutzte die Zeit und vollendete im Frühjahr 1973 seinen ersten Roman Škola dlja durakov (Die Schule der Dummen). Im November fuhr er zurück nach Moskau, wo es ihm nicht gelang, einen Job zu finden. Kurze Zeit später lernte er die Österreicherin Johanna Steindl kennen, die in der Hauptstadt Deutsch unterrichtete. Als er nachzuforschen begann, ob seine Geburt in Ottawa ihm die Möglichkeit für die kanadische Staatsbürgerschaft bot, wurde der KGB zunehmend aufmerksam. Nach einigen Verhören und dem spürbar steigendem Druck beschloss das Paar zu heiraten. Ein Termin auf dem Moskauer Standesamt war bereits gebucht, als Steindl zur Erneuerung des Visums das Land verlassen musste. Doch ein neues Visum wurde ihr fortan verweigert. Zudem ertrugen seine Eltern die Schande einer möglichen Emigration ihres Sohnes nicht und stellten sich der geplanten Hochzeit entgegen: sie versuchten, ihn als Geisteskranken zu entmündigen.
Zur gleichen Zeit lancierte Johanna Steindl eine öffentliche Kampagne, um Aufmerksamkeit für das Schicksal ihres Verlobten zu erregen. Sie trat in einen Hungerstreik und internationale Medien berichteten über den Fall. Schliesslich war es dem österreichischen Kanzler Kreisky, der sich persönlich bei Brežnev für das Paar einsetzte, zu verdanken, dass Sokolov das Land verlassen konnte und am 8. Oktober 1975 in Wien eintraf.
Noch vor Sokolovs Ausreise war das Manuskript der Škola dlja durkov in den Westen gelangt. Johanna Steindl schickte es an Carl Proffer von Ardis Publishers, dem Verlag, der auch Vladimir Nabokov publizierte. Proffer war begeistert vom jungen Talent und beschloss, das Werk zu veröffentlichen. Die russische Version erschien im Frühling 1976. Nabokov selbst schrieb Proffer einen Brief und lobte Škola dlja durakov als „an enchanting, tragic, and touching book. It is by far the best thing you have published in the way of modern Soviet prose.“ Nabokovs Worte zierten den Umschlag der 1977 erschienenen englischen Übersetzung und wirkten als publizistischer Katalysator: Noch im selben Jahr kam die kongeniale Übersetzung ins Deutsche von Wolfgang Kasack heraus, bis heute wurde das Werk in zwölf Sprachen übersetzt.
Durch die Vermittlung von Kanzler Kreisky fand Sokolov eine Anstellung als Waldarbeiter in der Nähe Wiens. Gleichzeitig schrieb er weiter an seinem zweiten Roman Meždu sobakoj i volkom (Zwischen Hund und Wolf), den er noch in der Sowjetunion begonnen hatte. Im Frühling 1976 traf er in Wien erstmals auf seinen Verleger Carl Proffer, welcher ihn in die Vereinigten Staaten einlud. Sokolov entschloss sich, im September 1976 nach Nordamerika zu fliegen, kurze Zeit darauf erhielt er seinen lange ersehnten kanadischen Pass.
1980 erschien Meždu sobakoj i volkom, wiederum bei Ardis. Noch viel stärker als sein Debüt lebt Sokolovs zweiter Roman von den Eigenheiten der russischen Sprache und wurde von der Kritik überaus zurückhaltend aufgenommen. Bis heute ist einzig eine von Aleksander Bogusławski besorgte Übersetzung ins Polnische erschienen. Nichtsdestotrotz wurde das Buch vom Leningrader Untergrundmagazin Časy mit dem Andrej Belyj-Preis für das beste russische Prosawerk des Jahres 1981 ausgezeichnet.
Im Frühling 1985 erschien Sokolovs bisher letzter Roman Palisandrija. Doch die Hoffnungen auf einen kommerziellen Erfolg wurden enttäuscht. Die englische Übersetzung unter dem Titel Astrophobia erschien 1989, konnte jedoch nicht an den früheren Erfolg von Škola dlja durakov anknüpfen.
Seither ist es ruhig geworden um Sokolov. Nur vereinzelt hat er Essays oder Gedichte veröffentlicht, nur selten äußert er sich in Interviews über sich und sein Werk. Ein vierter Roman ist am Entstehen, über seinen Inhalt hüllt sich der Autor jedoch in eisernes Schweigen.
Trotz seines vom Umfang her bescheidenen Werks kommt man nicht umhin, Saša Sokolov zu den bedeutendsten russischen Prosastimmen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu zählen. Wie kaum ein anderer Autor konzentriert sich Sokolov auf das Wort und dessen Wirkung beim Leser. Sokolov sieht sich selbst als Vertreter des Modernismus, dessen charakterisierendes Merkmal darin bestehe, das wie über das was zu stellen.
Die Geschehnisse von Sokolovs Erstling Škola dlja durakov resümieren zu wollen, wäre ein hoffnungsloses Unterfangen. Im Zentrum des Buches steht der Ich-Erzähler, der namenlose ‚Schüler soundso’ (učenik takoj-to) einer Sonderschule für geistig Behinderte – der ‚Schule der Dummen’ eben. In einem ununterbrochenen Zwiegespräch mit seinem forsch auftretenden Alter Ego diskutiert er seine misslichen Lebensumstände in der Sonderschule, welche sich alsbald als Symbol einer alle kreative Freiheit des Querdenkers unterdrückende Institution entpuppt. Der schizophrene Dialog (Monolog?) der Hauptfigur(en) zieht sich durch die ganze Erzählung hindurch und strukturiert diese in gleichem Masse wie er jegliche Struktur verunmöglicht. Als pathologisches Merkmal des Ich-Erzählers präsentiert uns Sokolov seitenlange Passagen eines Stream of consciousness, dessen Reinheit in der russischen Literatur seinesgleichen sucht. Nicht irgendeine Handlung verbindet die einzelnen Teile des Buches miteinander, sondern das selektiv-assoziative Gedächtnis des Schülers soundso, dessen Gedankengänge wie aus dem Nichts von der eingeschlagenen Richtung abweichen, sich zu längeren Einschüben über ein scheinbar nur zufällig erwähntes Stück Kreide ausweiten, um dann unverhofft wieder zum begonnenen Gespräch zurückzukehren, als wäre es das natürlichste der Welt. Nach und nach kristallisieren sich auf diese Art wiederkehrende Elemente heraus, welche die Erzählung als Ganzes begleiten: Das Leben in der sommerlichen Datschensiedlung mit den verschiedenen Personen, welche sich aus der Stadt zurückgezogen haben und ihr Leben zu leben versuchen, die unerwiderte Liebe des Schülers soundso zu seiner Biologielehrerin Veta Akatova, der ödipale Konflikt mit seinem Vater und die damit zusammenhängende Zuneigung zu seiner Mutter, oder aber die Gespräche mit dem Geographielehrer Pavel/Savl Norvegov, welcher sich in der Sonderschule ähnlich unwohl fühlt wie der Ich-Erzähler selbst. Die Erkenntnis am Ende des Buches, dass Norvegov bereits vor einiger Zeit verstorben ist, stellt ein ‚realistisches’ Herausfiltern des Plots vor weitere Hürden: Entspringen die Gespräche mit dem Lehrer schlicht der Imagination des Erzählers? Und welche Konsequenzen bringt dies für die Kontingenz der beschriebenen Romanwelt im Allgemeinen? Oder ist einfach nur etwas mit der Zeit durcheinander geraten?
In der Tat gestaltet sich eine zeitliche Einordnung des Geschehens noch um ein Vielfaches schwieriger als das Aufspüren des Geschehens an sich. Absolute Zeitbezüge braucht man im Roman schon gar nicht zu suchen und die spärlichen relativen Bezüge (‚damals’, ‚seit jenem Tag’ o.Ä.) bringen nur bedingt Klarheit in den Ablauf der Ereignisse. Die Geschichte scheint retrospektiv erzählt zu sein, aber wie alt der Erzähler zum Zeitpunkt des Berichtes ist, bleibt genauso undeutlich wie die gesamte Summe der erzählten Zeit, so dass man dem Schüler soundso nickend zustimmt, wenn er verkündet: „Es steht schlecht bei uns um die Zeit“.
 Auch in Sokolovs zweitem Roman Meždu sobakoj i volkom ist die Zeit kaum fassbar. Ort der ‚Handlung’ ist ein mythisches Land am Fluss Itil’ (die mittelalterliche, aus Turksprachen stammende Bezeichnung für die Wolga), an dem die Gesetze des Zeitflusses aufgehoben zu sein scheinen. Der Fluss – und mit ihm die Zeit, die er symbolisiert – fliesst mal in die eine, mal in die andere Richtung, mal schneller, mal langsamer, und bestimmt so das Leben der Figuren, welche sich in diese Gegend verloren haben. Jäger, Bettler, Tagelöhner, Witwen und Prostituierte; die Figuren des Romans bewegen sich am Rande einer Gesellschaft, deren Existenz als Ganzes nur schleierhaft angedeutet wird. Es ist eine rauhe Welt, die da beschrieben ist, eine Welt im Dämmerungszustand – die Phraseologie des Titels ‚zwischen Hund und Wolf’ beschreibt die Zeit des Tages, zu welcher der Jäger aufgrund der Dämmerung nicht imstande ist, zwischen Freund (Hund) und Feind (Wolf) zu unterscheiden. Der Leser sieht sich gezwungen, seine Augen zuzukneifen, um die Konturen einer Handlung zu erkennen. Doch noch stärker als in seinem ersten Roman verwischt Sokolov hier alle Ansätze eines Plots und präsentiert uns statt dessen eine fragmentierte Erzählung, deren Bruchstücke sich nicht zu einem einheitlichen Ganzen zusammenfügen lassen. Aber vermutlich entsprach dies auch nie der Absicht des Autors: Sokolov beschreibt in Meždu sobakoj i volkom eine Philosophie der zyklischen Zeitwahrnehmung, welche verschiedene Möglichkeiten eines Ereignisses gleichwertig nebeneinander stehen lässt. Nur so ist zu begreifen, dass innerhalb der Erzählung mehrere Varianten ein und desselben Geschehnisses berichtet werden, ohne dass der Wahrheitsgehalt jeweils steigen würde.
Auch in Sokolovs zweitem Roman Meždu sobakoj i volkom ist die Zeit kaum fassbar. Ort der ‚Handlung’ ist ein mythisches Land am Fluss Itil’ (die mittelalterliche, aus Turksprachen stammende Bezeichnung für die Wolga), an dem die Gesetze des Zeitflusses aufgehoben zu sein scheinen. Der Fluss – und mit ihm die Zeit, die er symbolisiert – fliesst mal in die eine, mal in die andere Richtung, mal schneller, mal langsamer, und bestimmt so das Leben der Figuren, welche sich in diese Gegend verloren haben. Jäger, Bettler, Tagelöhner, Witwen und Prostituierte; die Figuren des Romans bewegen sich am Rande einer Gesellschaft, deren Existenz als Ganzes nur schleierhaft angedeutet wird. Es ist eine rauhe Welt, die da beschrieben ist, eine Welt im Dämmerungszustand – die Phraseologie des Titels ‚zwischen Hund und Wolf’ beschreibt die Zeit des Tages, zu welcher der Jäger aufgrund der Dämmerung nicht imstande ist, zwischen Freund (Hund) und Feind (Wolf) zu unterscheiden. Der Leser sieht sich gezwungen, seine Augen zuzukneifen, um die Konturen einer Handlung zu erkennen. Doch noch stärker als in seinem ersten Roman verwischt Sokolov hier alle Ansätze eines Plots und präsentiert uns statt dessen eine fragmentierte Erzählung, deren Bruchstücke sich nicht zu einem einheitlichen Ganzen zusammenfügen lassen. Aber vermutlich entsprach dies auch nie der Absicht des Autors: Sokolov beschreibt in Meždu sobakoj i volkom eine Philosophie der zyklischen Zeitwahrnehmung, welche verschiedene Möglichkeiten eines Ereignisses gleichwertig nebeneinander stehen lässt. Nur so ist zu begreifen, dass innerhalb der Erzählung mehrere Varianten ein und desselben Geschehnisses berichtet werden, ohne dass der Wahrheitsgehalt jeweils steigen würde.Sokolov hat in diesem Roman Eindrücke seiner persönlichen Erfahrung verarbeitet, die er während seiner Zeit als Jagdaufseher an der oberen Wolga gemacht hat. Sein erklärtes Ziel war es, die Stimmung jenes Ortes und die Sprache der Jäger in der russischen Provinz einzufangen. Entsprechend gestaltet sich der Stil des Buches: Der Skaz wird zum dominierenden Element, umgangssprachliche Ausdrücke und ländliche Phraseologismen verfremden die Sprache und kreieren eine fast schon mythische Variante des Russischen, die irgendwo im neunzehnten Jahrhundert anzusiedeln wäre.
Sokolov war sich der sprachlichen Dichte seines zweiten Romans durchaus bewusst und ging schon gar nicht davon aus, dass ihn jemand verstehen würde, wie er in Briefen an seinen Verleger Proffer gesteht. Nichtsdestotrotz versprach er, dass sein nächstes Buch „um einiges sujethafter und leserlicher“ sein würde als die beiden vorangegangenen. Und in der Tat zieht sich durch seinen dritten Roman Palisandrija so etwas wie ein Ansatz einer Handlung:
Der Kreml-Waise und Anwärter auf die Erbfolge an der Macht des grossen Russland, Palisander Dahlberg, wird nach einem kindlichen Scherz, der Stalins Tod zur Folge hatte (ein im Schrank versteckter Schlosshund provozierte einen Herzanfall), ins Novodevichi-Kloster verbannt, das als Bordell für die Machtelite seinen Zweck erfüllt. Nach weiteren Ränkespielen und einem missglückten Attentat auf den Usurpatoren Brežnev, wird Palisander nach Sibirien und anschliessend ins westliche Exil verbannt, wo, nach jahrelangem Umherstreifen, schliesslich sein wahres Geheimnis – er/sie/es ist Hermaphrodit – enthüllt wird. Palisander wird zur Speerspitze einer Art Queer-Bewegung, wird für sein emanzipatorisches Engagement mit dem Friedens- und für seine promiskuitive Autobiographie mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, kommt zu Reichtum und Ruhm, was ihn in die Lage versetzt, die auf der Welt verstreuten sterblichen Überreste sämtlicher Exilrussen zusammenzukaufen, um dann mit dieser Armee der Toten im Schlepptau einen triumphalen Einzug in Moskau zu halten, wo er als rechtmässiger Thronfolger von der Menge gefeiert wird.
Allein die Absurdität der Fabel lässt jedoch erahnen, dass es Sokolov mit dem Plot nicht allzu ernst ist, bzw. dass dieser nur die Fassade für ein weiteres sprachliches Feuerwerk darstellt. Sokolov, der mit seinem dritten Buch ohne Bescheidenheit ein Buch schreiben wollte, welches „das Genre des Romans als solchen beenden“ würde, nimmt die absurde Handlung zum Anlass für eine wilde Parodie der russischen Gegenwartsliteratur, namentlich der Memoirenliteratur und der sexuell freizügigen Skandalliteratur. Im Gegensatz zu letzterer verzichtet Sokolov jedoch völlig auf den in Mode gekommenen Mat, die russische Fluchsprache, was seine Schilderungen der amourösen Abenteuer seines Helden Palisander jedoch nicht weniger obszön erscheinen lässt. Im Gegenteil: Sokolov zeigt als Meister des sprachlichen Ausdrucks, dass das Russische in seiner Mächtigkeit Bilder zulässt, welche den obszönen Mat zu Sandkastenvokabular degradiert.
Saša Sokolovs Werk oszilliert zwischen Moderne und Postmoderne, seine Nähe zu Nabokovs Literaturverständnis ist genauso wenig umstritten wie seine Rolle als „Schlüsselfigur der russischen Postmoderne“ (T. Brajnina).
Bei Saša Sokolov zeigt sich das Erzählen in seiner reinsten Form. Die Frage ‚Wer spricht?’ verliert ihre sonst übliche Relevanz, ganz zu schweigen vom lapidaren ‚Was geschieht?’. Das einzige, was noch zählt, ist, dass gesprochen, dass erzählt wird. Es ist dieses Sichtbarmachen des Erzählens, welches in Sokolovs Büchern einen so atemberaubenden Eindruck hinterlässt.
Auf Russisch sind erschienen:
Škola dlja durakov. Ann Arbor 1976.
Meždu sobakoj i volkom. Ann Arbor 1980.
Palisandrija. Ann Arbor 1985
Trevožnaja kukolka. Ėsse. Sankt-Peterburg 2008.
Škola dlja durakov. Meždu sobakoj i volkom. Palisandrija. Ėsse. Sankt-Peterburg 2009.
Auf Deutsch sind erschienen:
Die Schule der Dummen. Aus dem Russ. von Wolfgang Kasack. Mit einem Nachwort von Iris Radisch. Frankfurt a.M. 1993.
„Puppe in Aufruhr“. Aus dem Russ. von Felix Philipp Ingold. In: Schreibheft. Zeitschrift für Literatur. Nr. 36, November 1990. S. 11-14.
„Dsyndsyrelas Transitilien“ Aus dem Russ. von Birgit Veit. In: Schreibheft. Zeitschrift für Literatur. Nr. 36, November 1990. S. 23-30.
„Palisandrija“ Aus dem Russ. von Eveline Passet. In: Schreibheft. Zeitschrift für Literatur. Nr. 36, November 1990. S. 31-39.