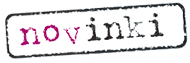3. Vorsicht, gefährliche Bäume
Der Krieg macht uns sprachlos. Er frisst Leben, Gebäude, ganze Städte – und auch die Sprache. Die Wörter, die er wieder ausspuckt, haben plötzlich eine andere Bedeutung. Der Alltag im Krieg findet in einer grotesken Realität statt, in der Stille zur Bedrohung, ein Badezimmer zum Bunker, Schönheit zur Gefahr werden können, wie Ostap Slyvynskys Slovnyk vijny deutlich macht.
Kateryna Jakovlenko, ukrainische Kuratorin, Autorin, Kunstwissenschaftlerin und Chefredakteurin des Kultursenders Suspil’ne Kultura erlebte persönlich, wie die Wörter ‚Pech‘ und ‚Glück‘ ihre Bedeutung verloren. Hatte sie Pech, weil ihre Wohnung in Irpin‘ am 18. März 2022 fast vollständig durch eine Granatenexplosion zerstört wurde? Oder hatte sie Glück, weil sie eben nur fast vollständig zerstört wurde, während 70 Prozent der Stadt Irpin‘ so gut wie dem Erdboden gleichgemacht wurde? Und wenn ihre Wohnung nun fast völlig zerstört ist, die Decke behelfsmäßig befestigt werden muss, die Wände kahl und verbrannt sind, die Fenster aus den Rahmen gesprengt wurden, die ganze Einrichtung zerstört, alle Erinnerungen verbrannt sind, ist es dann noch ihre Wohnung? Was hat dieser Raum, diese Ruine, noch mit ihr zu tun, fragt sie sich.
Jurij Andruchovyč beschrieb vor etwa 20 Jahren in seinem Essay Mittelöstliches Memento (2000) seine jugendlichen Streifzüge zwischen verlassenen, verfallenen Orten im ehemaligen Galizien. Ruinen sind für ihn Zeugen der Vergangenheit: Es sind nicht nur verwitternde Mauern, sondern Dinge, die einmal für den Menschen einen Nutzen hatten und dann verfallen oder in Vergessenheit geraten sind. Das Wort ‚Ruine‘ hört sich nach etwas längst Vergangenem und Geheimnisvollem an. Aber für Jakovlenko ist dieses Vergangene noch Gegenwart, und im kahlen Gemäuer spiegelt sich ihr Trauma: „Ich wollte weg, ich zweifelte und hatte Angst, diesen Raum irgendwem zu zeigen ‒ als würde die ganze Welt meine innersten Geheimnisse erfahren, all meine Narben und Wunden sehen können.” Dennoch eröffnet sie in ihrer zerstörten Wohnung am 26. August 2022 für einen Tag eine Ausstellung unter dem Titel „Jeder hat Angst vor dem Bäcker, aber ich bin dankbar“ (Vsi bojat’sja pekarja, a ja djakuju). In ihrem Essay „Vorsicht, gefährliche Bäume“ schreibt sie über die Ausstellung. Der Raum selbst sei zum wichtigsten Ausstellungsstück geworden ‒ durch sich verändernde Licht- und Schattenreflexe sowie Vögel und Insekten, die durch die offenen Fensterlöcher hineinflogen. Die ausgestellten Werke, eine Zusammenstellung aus Fotos, Zeichnungen und Installationen von Künstler*innen wie Anna Zvjaginceva, Katja Bučacka, Tamara Turljun, Roman Mychajlov und weiteren, wählte sie aus, weil sie vom Umgang mit Traumata und von Gesten der Dankbarkeit für Zusammenhalt und Fürsorge erzählen. Für Jakovlenko funktioniert Sprache allein nicht mehr: „Könnte man über Wörter stolpern, so könnte ich keinen Kilometer laufen, ohne mir blaue Flecken zu holen.“ Deshalb will sie die Sprache durch Bilder und Gesten ersetzen und ergänzen. So findet sich in der Ausstellung beispielsweise auch das Werk des Künstlers Stanislav Turina: Servietten, auf denen das Wort danke auf Ukrainisch geschrieben steht. Täglich schreibe er es auf Zettel und verteile sie, um seine Unterstützung zu zeigen. So wird ein Wort durch eine Geste zu einem Akt der Solidarität.
So zieht sich auch die Symbolik des Baums als Thema durch die Werke der Ausstellung und durch Jakovlenkos Essay. Der Baum wird für sie zu einem Sinnbild der Heilung, zu einer Stütze in der Traumabewältigung. Die Ukraine brauche auch etwas Ähnliches wie Harz ‒ diese klebrige Substanz, die wie Tränen die Wunden der Bäume verschließt. Das Harz für ihr traumatisiertes Heimatland sieht Jakovlenko in der Dankbarkeit, der Solidarität und dem Zusammenhalt der Menschen.
Das erste Werk, das sie für die Ausstellung auswählte, war das Bild „Einen Stock pflanzen“ (To Plant a Stick, 2019-2022) von Anna Zvjaginceva. Die Künstlerin habe es ihrem Großvater gewidmet, der in der Westukraine in einer ländlichen Gegend lebte. Sie habe einmal bei ihm ein handschriftlich notiertes Zitat eines ukrainischen Schriftstellers gefunden: „Wie ein Baum ohne Blätter steht meine Seele in den Feldern.” Ausgestellt ist das gerahmte Bild in einem Zimmer auf dem Boden, lehnt wie beiläufig abgestellt an der kahlen Wand. Darauf zu sehen: ein Foto von einem Stock, der aus einer Wiese ragt. Es sieht fast so aus, als würde er in dem mit einer Plane bedeckten und sandigen Boden der verbrannten Ruine stecken. Wieso sollte aus dem Stock nicht doch noch ein Baum werden können?
von Stella Breitbach