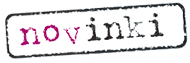III. Lyrik in Zeiten des Krieges
Die Organisatoren des internationalen Lyrikfestivals Meridian Czernowitz und auch das Publikum haben sich gefragt, ob es angebracht sei, ein Literaturfestival zu veranstalten, während in Teilen des Landes Krieg herrscht. Es zeigt sich aber, dass es nicht nur angebracht, sondern sogar notwendig ist. Meridian Czernowitz wird mit einer Schweigeminute für die Soldaten eröffnet, die in Donezk und Luhansk getötet wurden. Danach erklärt der Hauptorganisator, Svjatoslav Pomerancev, das Motto des Festivals „Die Musen schweigen nicht“: Meridian Czernowitz sei ein Versuch, die Gräuel des Krieges zu überwinden. Im Programm des Festivals sind mehrere Diskussionen zum Thema „Krieg und Literatur“ eingeplant, an denen berühmte Autoren, wie Igor Pomerancev, Jurij Andruchovyč, Kateryna Babkina, Serhij Žadan, teilnehmen. Irgendwie können sich alle auf die programmatische Hoffnung einigen, dass Literatur und Kunst den Tod überwinden können. Serhij Žadan betont, es sei in dieser Zeit wichtig, Energie auszutauschen, einander zu unterstützen; wenn die Lyrik verschwunden wäre, wäre es nicht besser geworden.
Meridian Czernowitz ist auch ein Brückenschlag, der Autoren und Übersetzer aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Dänemark, Polen, England in die Ukraine gebracht hat, darunter auch den Sohn von Paul Celan. Das scheinbar provinzielle Czernowitz mit gerade mal 200 000 Einwohnern wird zur kulturellen Hauptstadt. Die gemeinsamen Werte verbinden die Menschen unterschiedlichster Herkunft. Dabei spielt die Sprache, spielen Worte, die man genau versteht, erstaunlicherweise keine wichtige Rolle. Nicht alle Gedichte und Diskussionen werden übersetzt, das stört aber niemanden. Auf den Straßen hört man Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch. Meine deutschen Freunde lehnen überraschenderweise meinen Vorschlag ab, ukrainische Gedichte für sie zu übersetzen. Sie wollen lieber den Klang der ukrainischen Poesie genießen. Obwohl längst nicht alle Zuhörer Deutsch verstehen, ist es kaum möglich, in den Lesungen der deutschsprachigen Poesie einen freien Sitzplatz zu finden.
Das Festival bestätigt, dass die ukrainische Kultur blüht, trotz allem. Es werden Essays, Gedichte, Romane und Erzählungen von ukrainischen Autoren veröffentlicht, fremdsprachige Werke werden ins Ukrainische übersetzt. Somit wird die interkulturelle Kommunikation bereichert. Die für September ungewöhnlich sonnigen und warmen Tage in den westukrainischen, europäisch aussehenden Städten Czernowitz und Ivano-Frankivsk unterstreichen die kulturelle Pracht des Festivals.
An allen Ecken sind die blau-gelben Farben der ukrainischen Nationalflagge zu sehen, in den Sonnenstrahlen glänzen sie noch mehr. Es scheint, dass die Luft mit Liebe erfüllt ist. Es fühlt sich an wie ein entblößter Nerv, eine entblößte Seele. Die einander unbekannten Menschen lächeln und umarmen sich gedanklich. In jeder Veranstaltung gibt es viel junges Publikum. Die Gesichter sind begeistert, hoffnungsvoll, selbstsicher und aufgeschlossen. Die Verkäufer in einem Lebensmittelladen machen sich über die russische Propaganda lustig und fragen uns, ob wir etwa keine Angst vor „Banderivci“ haben. Allerdings gibt es keine Hassslogans gegen Feinde, nur Witze und begründete Aufrufe zum Boykott der russischen Waren.
Viele Male wird das Wort „Nationalismus“ von ausländischen Gästen des Festivals in privaten Gesprächen hinsichtlich der auffallenden Präsenz der nationalen Symbole in den Städten aufgeworfen. Das Zusammenhalten, die gegenseitige Unterstützung und Achtung vor der eigenen Kultur in der Ukraine sind jedoch etwas anderes, als das, was man mit diesem Wort sonst normalerweise assoziiert. Beim Literaturfestival erzählen auch mehrere DichterInnen, dass sie in der letzten Zeit viel über die Liebe schreiben. Liebe als eine Abwehrreaktion gegen Krieg, Tod, gegen Feindlichkeit.
von Lina Zalitok (Studentin der „Europäischen Literaturen“ an der HU Berlin; Lina Zalitok stammt aus Kiev, wo sie ihr erstes Studium abgeschlossen hat. Als Teilnehmerin der Exkursion war sie zum ersten Mal im Leben in der Bukowina.)
IV. Geopoetische Reflexionen
1. Über die geopoetischen Landschaften und Czernowitz
Jedes Mal, wenn ich auf Reisen bin,
gelange ich auf alle Straßen, die ich gegangen bin.
Jedes Mal, wenn ich in einer neuen Stadt bin,
gelange ich in alle Städte, in denen ich früher war.
Im Sommersemester 2014 hatte der ukrainische Autor Jurij Andruchovyč die Siegfried-Unseld-Professur inne. Neben einem Seminar zum kreativen Schreiben, aus dem sich das Projekt „Erfundene DichterInnen“ entwickelte, gab Andruchovyč ein literaturtheoretisches Seminar mit dem Schwerpunkt Geopoetik . In dem Seminar haben wir uns mit der Frage befasst, ob es eine spezifische ost- und mitteleuropäische Poetik gibt. Dafür hat Juri Andruchovych uns eine Auswahl an theoretischen und fiktionalen Texten vorgeschlagen, darunter die Anthologie Last&Lost, Bruno Schultz, Gregor von Rezzori, Taras Prochas’ko. Als eine spannende Abwechselung zum Seminar wurden ReferentInnen eingeladen und interviewt: der ukrainische Übersetzer Petro Rychlo, die Lektorin des Suhrkamp Verlages Katharina Raabe und andere berichteten uns von ihren praktischen Erfahrungen mit den regionalen Literaturen. Im historisierenden Überblick über die Imaginationen Mitteleuropas haben wir eine Sensibilisierung für die sprachlichen und kulturellen Besonderheiten Mittel- und Osteuropas gewonnen. Bei mir sind am Ende des Semesters mehr offene Fragen als fertige Antworten geblieben, aber das ist wahrscheinlich der Sinn einer reflexiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Im Anschluss an seine Seminare bot Jurij Andruchovyč eine Studienreise in die Ukraine an. Ich habe mich ohne zu zögern für die Reise entschieden.
Die Studienreise führte uns in einer Woche in drei ukrainische Städte und war durch die Teilnahme unserer Seminargruppe „erfundene DichterInnen“ am literarischen Festival Meridian Czernowitz strukturiert. Das Festival wurde vor fünf Jahren in Czernowitz ins Leben gerufen, und findet seither stets in mehreren Ländern Mitteleuropas statt. Diesmal, 2014, in der Ukraine, Polen und Deutschland. Ein reisendes Festival war für mich eine Entdeckung. Es inspirierte mich ganz besonders beim Nachdenken über Fragen, die ich mir immer wieder stelle, Fragen bezüglich einer gemeinsamen ost- und mitteleuropäischen Identität und dementsprechenden literarischen Praxis. Jurij Izdryk hat Serhij Žadans Prosa „unendlicher Road-Movie, berauschtes Treiben“ genannt. „Du kannst auf einer beliebigen Seite sein Werk aufschlagen, und das wird richtig sein.“ Ohne die Metaphern der Bewegung lässt sich die transformierende ost- und mitteleuropäische Literatur nicht beschreiben.
Czernowitz. Zarte Provinzstadt bezaubert und bewirtet mich mit einem Übermaß an Licht. Ich atme ein neues Versmaß. Das ist das Wesentliche, was ich mitbringen werde. Meine eigene Stimme und die Fähigkeit zu schreiben. Die Straßen sind mit der frühseptembrischen, transparenten und geschmeidigen Luft überfüllt. Mein verstauchter Fuß grüßt, aber ich gehe weiter, weg von der festlichen Fußgängerzone der Kobyljanska-Straße, in die golden-grauen Seitenstraßen mit zerbrochenem Asphalt und verstaubten Fassaden, Säulengänge im Jugendstil, ich kann nicht wegschauen, kann nur staunen und mich verlaufen. Passanten erklären mir den Weg. Es entstehen Gespräche über Gott und den Krieg, über Poesie und Kunst, mit ganz unbekannten Menschen beim Einkaufen. Die Gespräche entstehen aus der Luft. Die Begegnungen lösen sich genauso schnell auf. Die Gespenster der „Erfundenen DichterInnen“ begleiten uns von Stadt zu Stadt. Und ich glaube daran, dass sich irgendwo in der Nähe eine Aussicht aufs Meer eröffnet. Da, wo jetzt die Karpaten sind, war vor vielen Millionen Jahren ein Meer.
Die Frage, ob es eine besondere mittelosteuropäische literarische Darstellung oder Wahrnehmung der Landschaft gibt, erscheint mir am Ende der Reise überflüssig. Jurko Prohas’ko hat das so treffend formuliert: Jede Stadt erfährt ihre Einzigartigkeit durch ihre Ähnlichkeit mit anderen Städten. Nur im Vergleich entsteht ein Bewusstsein für die Maßstäbe, Farben und Klänge der Orte. In anderen Seminaren habe ich gelernt, dass Orte durch menschliches Handeln konstruiert werden. In einem Traum auf dem Rückweg sehe ich einen Text, der „Migrantische Geopoetik: erfundene Orte“ heißt. Ich wache auf.
2. Über den Kellner in L’viv
Der letzte Abend in L’viv, unsere bunte Gruppe, Berliner Studierende, „erfundene DichterInnen“, und echte junge DichterInnen aus der Ukraine, die wichtigen Bekanntschaften dieser Reise, trinken im Café „Dzyga“ Kaffee und Glühwein. Der Abschied steht bevor, der Herbst macht sich schon ein wenig bemerkbar, manche kuscheln sich in Decken. Aber wir lachen und unterhalten uns lautstark in mehr oder weniger gebrochenem Englisch: über Reisen und Schreiben, über unsere Träume. Als wir bezahlen wollen, sagt der Kellner, dass es unterschiedliche Kunden gibt: solche, die ihm die Laune verderben, solche, die nicht in Erinnerung bleiben, und solche, die die Stimmung aufhellen und ihn bei der Arbeit erheitern, und dass wir eben solche sind. Dann schüttelt er jeder/m von uns persönlich die Hand und bedankt sich. Auf dem Weg zum Hostel frage ich eine junge ukrainische Dichterin, ob das eine neue witzige PR-Methode ist, und sie sagt: eigentlich nicht. „Menschlichkeit“ flammt es in mir auf und ich bin so gerührt, dass ich losheule, als wir uns verabschieden.
3. Für die Erfindung der Dichter
Schau mal – wir stehen auf der Bühne, ich und du – einfache Studentinnen, die gewiss heimlich Texte produzieren, aber noch nie auf so einer Bühne standen. Das ist ein bisschen wie Prüfung und ein bisschen wie Triumph. Für mich gibt es auch etwas Revolutionäres darin: junge Frauen, die noch keine „richtigen“ Publikationen haben, stehen plötzlich auf einer erwachsenen Bühne mit berühmten DichterInnen.
Das Projekt Erfundene DichterInnen hat sich aus der Luft herauskristallisiert. Gespenster der DichterInnen ließen sich beschwören, als ob es nicht schon genug real vorhandene, jedoch nicht anerkannte AutorInnen gäbe. Während eines Treffens ist die Idee entstanden, die „Erfundenen Dichter“ in „Gefundene“ bzw. „Vergessene“ umzubenennen, damit das Geheimnis nicht allzu schnell verraten wird. Aber ich finde den Gedanken, von Anfang an mit offenen Karten zu spielen, eigentlich sehr spannend. Bereits im Titel des Projekts über die Reflexivität des Projekts zu sprechen, ist das nicht lustig? Die Technik der Parodie hat viele AutorInnen aus kreativen Krisen gerettet. Zudem ist es etwas Postmodernes, fast Sorokinsches – Stimmen der Klassiker nachzuahmen. Und gleichzeitig stellen wir unseren Lernprozess bloß. Denn keine/r von uns ist bekannt und anerkannt. Dafür leitet Jurij Andruchovyč die Gruppe. Und sein postmodernes Spiel baut eigentlich darauf auf, die (bisher) unbekannten fremdsprachlichen Stimmen ins Ukrainische zu übersetzen. Somit unterläuft das Projekt „Erfundene DichterInnen“ die Idee von autorisierter Kunst, indem es die literarische Übersetzung, die phantasievolle Erfindung und die präzise Arbeit mit Literaturgeschichte sich in einem kreativen Zusammenspiel begegnen lässt.
4. Mehrsprachigkeit: zwischen Trauma und Utopie
Kurtzschluss
von Gefühlen
gegen alles
was Menschen trennt
Dragica Rajčič
Russische Propagandasendungen beschwören das Bild von einer russophoben ukrainisch-nationalistischen Ukraine, in der sich die russischsprachige Bevölkerung in Gefahr befindet. Teile der deutschen Linken übernehmen dieses Denken. Es gibt tatsächlich Nationalismus in der Ukraine, aber es müsste unterschieden werden zwischen einem Nationalismus in einem besetzten Land und einem kolonisierenden Nationalismus. Komplexität der sprachlichen Situation in der Ukraine und die Differenzierung zwischen ethnischen Selbstbezeichnungen, der Muttersprache, der Sprache der alltäglichen Kommunikation und politischen Ausrichtungen werden leider selten von westeuropäischen Medien erfasst. Andrij Portnovs Seminar zu Stadtmythologien der Ostukraine, das er im Wintersemester 2014/15 an der Humboldt-Universität abhält, ist da sehr hilfreich für mich, wo das Zusammenspiel von Kultur- und Sprachgrenzen anhand symbolischer, aber auch statistischer Karten nachvollzogen werden kann. Was ist Sprache? In welcher Relation steht sie eigentlich zur Kultur? Und wie hängt Sprache mit nationalen Zugehörigkeitsgefühlen zusammen?
Mir, die ich in der Ostukraine geboren und dann als Schulkind mit den Eltern nach Deutschland ausgewandert bin, hat die Studienreise mit Jurij Andruchovyč einen ersten wichtigen Einblick in die Verhältnisse der Ukraine als einem mehrsprachigen Land gegeben und geholfen, einen Eindruck von den tatsächlichen sprachlichen Besonderheiten zu bekommen.
Auch in das Seminarprojekt „Erfundene DichterInnen“ war Mehrsprachigkeit als ein wichtiger Aspekt involviert: auf der Ebene der erfundenen DichterInnen selbst und auf derjenigen der studentischen TeilnehmerInnen. Ukrainische, polnische, tschechische, russische, deutsche, türkische und lettische DichterInnen wurden erfunden. Die Übersetzung der im Seminar entstandenen Texte ins Ukrainische, aber auch die Reise und Präsentation der studentischen Werke durch einen renommierten Autor war eine Art von karnevaleskem Spiel mit der Sprache und Hierarchie. Unsere fiktiven Charaktere hatten gemeinsame Geschichten und waren intertextuell verbunden. Viele von ihnen hatten jüdische Vorfahren, einige gelten als spurlos in fremden Ländern verschwunden. Es wäre keine vage Spekulation zu sagen, dass diese Tendenzen die persönlichen Hintergründe der Studierenden, wenn auch verzerrt, reflektieren.
Mehrsprachigkeit aber ist für mich der Schlüssel zum Projekt und zu der damit verbundenen Studienreise.
Als das Festival Meridian Czernowitz vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde, sollte Czernowitz als mehrsprachiges Zentrum mitteleuropäischer Literatur, dessen Tradition und Gedächtnis durch den Holocaust und die nachfolgende sowjetische Zeit praktisch gelöscht oder wenigstens vollkommen überdeckt worden war, nicht nur erinnert, sondern auch wiederbelebt werden. Historisch wurde Czernowitz von Deutsch, Rumänisch, Polnisch, Russisch, Jiddisch und Ukrainisch geprägt und behält diese Spuren in ihrem Gesicht. Die habsburgische Urbanität lasst die Stadt vielfältig und doch zugleich harmonisch erscheinen. Durch das Festival sollte es von Neuem zum Ort des kulturellen und literarischen Austauschs zwischen ukrainischen und internationalen LiteratInnen werden. Von Anfang an war „der Meridian“ mehrsprachig wie die Stadt selbst.
Wir haben das Festival in vieler Hinsicht als mehrsprachige und multikulturelle künstlerische Begegnung erlebt: Jüdische Geschichte konnten wir auf der Führung durch den jüdischen Friedhof, einen der größten jüdischen Friedhöfe in Europa, mit dem Übersetzer Petro Rychlo erfahren. Es gab ein Konzert mit jüdischer Musik. Der Sohn von Paul Celan hielt seine Begrüßungsrede auf Französisch. Die_der dänische Künstler_in Nielsen sang ihre_seine Lieder auf Englisch Gendernormen wurden durch den Auftritt von Nielsen gebrochen, die_der in einem Kleid herzzerreißende Lieder über den Frieden singt, eine Schleife mit der Aufschrift „Miss World“ trägt und sich für einen Engel hält. Ein wahrer Lebenskünstler, der sich gegen Identität positioniert und dessen Passfoto eigentlich eines von Andy Warhol ist. Bukowinische und galizische Lyrik in den jeweiligen regionalen Dialekten des Ukrainischen wurde teilweise ins Deutsche übersetzt. Aber manchmal auch ohne Übersetzung belassen. Denn intuitives Empfinden der Lyrik auf Gehör ist auch eine Art des Verstehens. Literarisches Hochrussisch und Suržik – die Mischsprache aus Russisch und Ukrainisch waren auf dem Festival auch zu hören. Auch Variationen der deutschen Sprache wurden präsentiert: deutsches und österreichisches Deutsch und kroatisches Schweizerdeutsch. Eine der wichtigsten Begegnungen auf dem Festival war für mich Dragica Rajčič: eine Autorin, die auf „Gastarbeiterdeutsch“ (Selbstbezeichnung) ihre Texte verfasst. Ich verstehe es als ein ganz klares politisches Projekt, dass Rajčič ihre migrantische Stimme sichtbar macht. Dabei gelingen ihr ungewöhnlich scharfe, zugleich satirische und rührende Texte. Rajčič macht aus den grammatikalischen Fehlern Metaphern, verfremdet die Sprache selbst, macht ihre Schwäche zu ihrer Stärke, und bleibt so in Erinnerung. Auf dem Meridian wurde nun ein Band mit Originaltexten und Übersetzungen ins Ukrainische und Russische präsentiert.
Auch in medialer Hinsicht fiel das Festival durch „Mehrsprachigkeit“ auf: Wenn der Nationaldichter number one (Serhij Žadan) in Begleitung punkiger Ska-Musik anarchistische Texte rappt, oder Lyriklesungen in einer Box-Sporthalle oder vor der Tür eines Supermarktes durchgeführt werden, entstehen daraus ebenfalls spannende multimediale und multilinguale Begegnungen.
Natürlich, Festivals sind immer Utopien. Aber Meridian war keine Fusion, kein Burning Man. Hier wurde die Praxis der Koexistenz der diversen künstlerischen und persönlichen Hintergründe und Zugehörigkeiten und ihre Problematisierung geübt, erfahren und reflektiert. Das Ukrainische aber fungierte während des Festivals als lingua franca: Die meisten Texte und Veranstaltungen waren auf Ukrainisch. Während des schwelenden Krieges in der Ostukraine hatte dies eine besondere Bedeutung.
Ich selbst konnte mich während der ganzen Reise mit Übersetzungen amüsieren: die ukrainischen Speisekarten für meine deutschsprachigen Freunde übersetzend, die Gesten und Blicke für meine neuen ukrainischen Freunde übersetzend, mich selbst dabei ertappend, fragmentiert und zerstreut zu sein und aus verschiedenen Sprachen und Kulturen gleichzeitig zu bestehen. So verwandelte sich für mich migrantische Erfahrung zum ersten Mal aus dem Trauma, das sie bislang immer irgendwie war, in einen Schatz, der künftig – ich fühle es – zur Quelle von Energie und geistiger oder literarischer Kreativität werden kann.
von Maria Beketova (Studentin der Gender Studies und der „Kulturen Mittel- und Osteuropas“ an der HU Berlin. Maria Beketova hat ihre Kindheit in Charkiv verbracht und war jetzt zum ersten Mal im westlichen Teil der Ukraine)
V. Der Krieg – so fern und doch so nah. Eine Begegnung in Czernowitz
Ich treffe Konstantin, kurz Kostja genannt, am zweiten Tag unseres Aufenthalts in Czernowitz. Als ich morgens mit dem Wasserregler der Dusche kämpfe und auf Russisch verzweifelt „Verdammt, gibt es hier etwa kein heißes Wasser?!“ ausrufe, unterbricht er sein Frühstück und eilt mir zur Hilfe. Ich halte ihn sofort für jemanden vom Hostelpersonal. Wie sich herausstellt, funktioniert der Wasserregler in unserem Like Hostel andersherum als gewöhnlich. Mir ist die Situation ein bisschen peinlich. Wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen, den Hahn in die andere Richtung zu drehen?
Abends kommen wir ins Gespräch. Ich leiste ihm beim Abendessen Gesellschaft. Er würde sonst alleine in der kleinen Hostel-Küche sitzen. Er stellt mir viele Fragen zum Leben in Deutschland und bittet mich, ihm ein paar Phrasen auf Deutsch beizubringen. Er finde den Klang der deutschen Sprache so schön, sagt er und lächelt. Dabei verengen sich seine braunen Augen und werden ganz klein. Er löffelt dünne Suppe, von der er einen riesigen Pott für die ganze Woche gekocht hat. Am nächsten Tag wird er sie auch zum Frühstück essen. Ich finde das befremdlich. Er findet es hingegen befremdlich, dass man in Deutschland AbendBROT isst.
Wenn sich hier alles geregelt habe, werde er anfangen, Deutsch zu lernen. Das hätte er schon so lange vorgehabt. Sein Arbeitgeber sei ja auch Deutscher. Ich höre Stolz in seiner Stimme. „Alles“ bedeutet: Wohnsituation klären, Arbeit behalten, ein paar Dinge anschaffen (Hemden für die Arbeit zum Beispiel), Alltag einkehren lassen.
Ich finde heraus, dass er doch nicht zum Hostelpersonal gehört, sondern eigentlich illegal auf dem harten Sofa im Gemeinschaftsraum schläft. Im Like Hostel dürfen sich in jenen Tagen nämlich nur Teilnehmer des Literaturfestivals Meridian Czernowitz aufhalten. Doch das tatsächliche Hostelpersonal hat es wohl nicht übers Herz gebracht, ihn vor die Tür zu setzen. Solidarität in Zeiten des Krieges.
Konstantin ist 24 und hat bereits zwei Abschlüsse – einen als Lebensmitteltechniker und einen als Informatiker. „Aber ich habe noch keine Bescheinigung, die mir die zweite Ausbildung offiziell nachweist“, ärgert sich Kostja. Sein zweiter Studienabschluss fiel mit dem Kriegsbeginn zusammen. Die Bescheinigung interessierte da niemanden mehr. Zum Glück kann er jetzt in Czernowitz trotzdem als Programmierer arbeiten. „Die Bescheinigung werde ich mir aber noch ausstellen lassen! Die brauche ich doch!“, sagt Kostja mit fester Stimme und erklärt mir, dass dies vielleicht in einer Filiale seiner Universität in L’viv möglich sein werde. „Das werde ich aber dann klären, wenn hier alles geregelt ist.“
Zum Zeitpunkt unseres Treffens, liegt Kostjas Flucht aus dem knapp 1000 Kilometer entfernten Donezk in der umkämpften Ostukraine zwanzig Tage zurück. Wahrscheinlich wird er sich sein Leben lang an das genaue Datum erinnern: 17. August 2014. Sein Studienfreund war schon einige Wochen zuvor nach Czernowitz gekommen. Er hatte schnell einen Job im Restaurant und eine bezahlbare Wohnung gefunden. Er rief Kostja an und forderte ihnn auf, nachzukommen. Er musste nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. „Was sollte ich denn auch in Donezk machen, außer den Schüssen und Explosionen zuzuhören?“ Zwei Tage reichen zur Vorbereitung. Dann packt er eine Handgepäck-große Reisetasche, auf der das Logo der Fußballeuropameisterschaft prangt, die zwei Jahre zuvor in der Ukraine stattgefunden hatte, setzt sich in den Zug und macht sich auf den Weg ins Ungewisse. Peinlich berührt stelle ich fest, dass er wesentlich weniger Gepäck für einen Umzug auf unbestimmte Zeit dabei hat als ich für meinen 7-Tage-Trip.
In Donezk lässt er seine Mutter, seine Schwester und seinen kleinen Neffen zurück. „Niemand hat noch Arbeit in Donezk – außer meine Mutter, denn sie ist Rettungsärztin. Ja, sie hat zur Zeit mehr als genug Arbeit.“ Kostja klingt nicht verbittert oder traurig, wenn er das sagt. Er erzählt mir vom Schusslärm und den Explosionen, die er miterlebt hat, im gleichen Ton wie von der Tatsache, dass er nicht gerne Süßigkeiten isst. Ich frage mich, ob er das Erlebte tatsächlich so cool wegsteckt oder ob er so tun muss als ob, damit es ihn nicht fertig macht. Damit er sich die Kräfte aufspart, die er für das neue Leben, das er aufzubauen versucht, braucht.
Mit seiner Familie telefoniert er einmal die Woche. Er sagt seiner Mutter nicht, dass er solange im Hostel wohnt, bis sich die Wohnungsfrage geklärt hat. Die würde sich nur unnötig Sorgen machen. Sie denkt, er sei bei dem Freund untergekommen. Kostja versichert seiner Mutter, dass alles gut sei und spricht über das schöne Wetter. Seiner Schwester erzählt er das Gleiche. Fragt nach seinem siebenjährigen Neffen, der am 1. September eingeschult worden wäre, wenn in Donezk normaler Schulbetrieb herrschen würde. Seine Schwester wird ihn jetzt erst einmal zu Hause unterrichten. Kostja verabredet sich mit ihr zu einem Skype-Gespräch am Ende der Woche, damit sie sich einmal kurz sehen und davon überzeugen können, dass es dem jeweils anderen gut geht. Wann sie sich tatsächlich wiedersehen werden, weiß keiner von beiden. Später wird Kostja mir verraten, dass er nicht mehr nach Donezk zurückkehren wolle. Er kann sich dort kein Leben mehr vorstellen.
Als ich Kostjas Gespräch mit seiner Familie mithöre, frage ich mich, wie in einem Teil des Landes das Leben weitergehen kann, wie wir ein paar Momente zuvor die Fußgängerzone entlang spazieren und Eis essen konnten, während das Leben in dem anderen Teil des Landes komplett still steht. Nein, vielleicht eher: komplett auf den Kopf gestellt ist.
Ich rufe meine Familie einmal aus der Ukraine an. Mein Vater sagt, allen gehe es gut und es gebe soweit nichts Neues. Meine Schwester erzählt mir von ihrer Klassenfahrt nach Wangerooge. Ich schaue Kostja kurz durch meine Sonnenbrille an und beginne, mich für dieses banale Telefonat zu schämen.
Während mein neuer Freund mich durch seinen neuen Wohnort führt, den er selbst nur minimal besser kennt als ich, erzählt er mir nichts über Czernowitz, sondern ganz viel über seine Heimatstadt Donezk. Czernowitz sei ja ganz schön, aber nicht mit Donezk vergleichbar. Donezk sei größer, quirliger, aufregender. Dort geäbe es alles. Dort würde man sich an einem Sonntag nicht langweilen. Es sei eine schöne Großstadt. War. Der Bahnhof, erst vor Kurzem zur Fußball-EM restauriert – zerbombt. Auch das Fußballstation von Schachtar Donezk, die Donbas Arena, schwer beschädigt.
Auf der malerischen Flaniermeile in Czernowitz, der Olga-Kobyljanska-Straße, die bis heute das geschlossene Straßenbild der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewahrt, kann man gegen eine Spende Bilder in ukrainischen Nationaltrachten machen. Ich oute mich als Touri und zerre Kostja vor die Linse. „Es ist unser letzter gemeinsamer Tag. Wir müssen doch ein Bild zur Erinnerung machen!“ Nach unserem kleinen Fotoshooting, das wir mit einer Spende von zwanzig Griwni bezahlen, erklärt Kostja mir, dass das Geld für die chronisch unterfinanzierte ukrainische Armee gesammelt werde. In der ganzen Ukraine gebe es Aktionen wie diese. Solidarität in Zeiten des Krieges. Und im gleichen Atemzug weisßt er lakonisch auf die Paradoxie der Situation hin: „Vielleicht habe ich gerade Geld für die Zerstörung meiner Heimatstadt gespendet…“ Und mich überfällt schon wieder die Scham.

Ekaterina und Konstantin
von Ekaterina Feldmann (Studentin des MA-Studiengangs „Kulturen Mittel- und Osteuropas“. Ekaterina Feldmann hat wie Lina Zalitok und Masha Beketova einen russischsprachigen familiären Hintergrund. Sie war zum ersten Mal in der Ukraine)