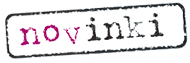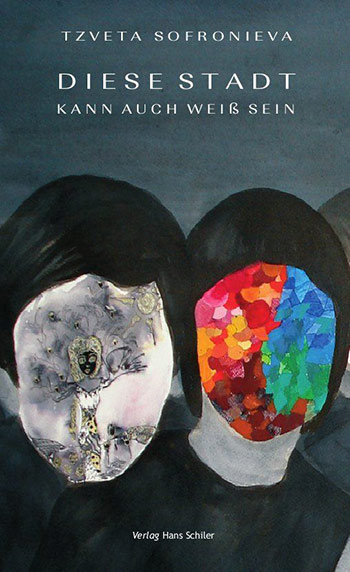 Die bulgarischstämmige Autorin Tzveta Sofronieva hat sich bislang vor allem durch ihre Lyrik und ihre Literaturinstallationen einen Namen gemacht. 2009 wurde sie anlässlich der Publikation ihres ersten komplett deutschsprachigen Gedichtbandes „Eine Hand voll Wasser“ für ihr deutschsprachiges Gesamtwerk mit dem Adalbert-von-Chamisso-Förderpreis ausgezeichnet.
Die bulgarischstämmige Autorin Tzveta Sofronieva hat sich bislang vor allem durch ihre Lyrik und ihre Literaturinstallationen einen Namen gemacht. 2009 wurde sie anlässlich der Publikation ihres ersten komplett deutschsprachigen Gedichtbandes „Eine Hand voll Wasser“ für ihr deutschsprachiges Gesamtwerk mit dem Adalbert-von-Chamisso-Förderpreis ausgezeichnet.Der 2010 im Hans Schiler-Verlag erschienene Erzählband „Diese Stadt kann auch weiß sein“ versammelt einen Großteil ihres bisherigen deutschsprachigen Prosaschaffens. Die kurzen Geschichten und Fragmente wurden während der letzten zehn Jahre in verschiedenen Anthologien publiziert und für die Neuauflage überarbeitet sowie durch drei bisher unveröffentlichte Texte ergänzt.
In 15 Episoden entführt Tzveta Sofronieva die Leserin ins Vitoscha-Gebirge und auf die staubigen Landstraßen zwischen Plovdiv und Sofia, in den verschneiten Park einer deutschen Kleinstadt, ins Pioniercamp am Schwarzen Meer und in ein Schloss namens Einsamkeit. „Ich mag über das Dokumentieren von Erforschtem und nicht vom Erlebten schreiben.“, bekennt die Autorin und so halten Sofronievas Figuren selten still. Zahlreiche Protagonistinnen und einige Protagonisten wandern, reisen, lieben und zweifeln und sind ErforscherInnen eines poetischen Universums, in dem die großen Fragen nach Identität und Herkunft, nach Alleinsein, Frausein und dem überhaupt Sein, manchmal in Gestalt einer bemitleidenswert unbehausten Nacktschnecke oder der ruhelosen Seelen der Urgroßmütter auftreten.
Liest man die Texte in der Reihenfolge ihrer Entstehung, die grob der Anordnung im Band entspricht, dokumentieren sie den Aneignungs- und Befreiungsprozess einer Autorin, die sich Schritt für Schritt ihren Weg in eine neue Schreibsprache bahnt. In dem Maße, wie Sofronievas Sprache an Tiefe gewinnt, wird sie zugleich uneindeutiger, geheimnisvoller – eine Bewegung des „Unheimischwerdens“, die Paul Celan einst in das Paradox „wirf sie weg, wirf sie weg/dann hast du sie wieder“ fasste und die ihre Figuren einer immer stärkeren Unsicherheit und Uneindeutigkeit aussetzt.
Konnte sich die Protagonistin des ersten Textes „Birgit oder die Kunst des Führerscheinerwerbs“ noch klar zwischen einem „hier“ und einem „daheim“ verorten und unbedarft Wörter wie „normalerweise“ verwenden, so ist die vielnamige Protagonistin des letzten Textes nunmehr „eine und viele, eine rund um die ganze Kugel“ - die vermeintlich eindeutige Identität ist ins Wanken geraten; Herkunft, Sprache, sexuelle Ausrichtung - nichts ist unveränderbar. Kein Stein bleibt auf dem anderen; am Ende ist alles anders - und alles gut.
In den frühen Texten Sofronievas suchen die Sätze noch den späteren, eigenen Rhythmus. Man versteht, warum die Lyrik für die Autorin „fließt“ und in den Gedichtbänden immer wieder das Sinnbild des Wassers heraufbeschworen wird, während sie Prosa als eine „Auseinandersetzung mit der festen Materie“ begreift, die „Sturheit, Beharren, Langsamkeit und Nichtaufgeben“ erfordert. Treffenderweise ist der Schnee eines der Leitmotive des Bandes.
In einem Gespräch beschrieb die Dichterin, wie sie in diesem Band in der deutschen Sprache Kind gewesen sei, dann jugendlich und irgendwann erwachsen. Mit der Kindern eigenen Direktheit werden in den frühen Texten Stereotype aufgegriffen und genussvoll ausbuchstabiert. Bestechlichkeit, Alkoholismus und Chauvinismus, aber auch die Herzlichkeit und zwischenmenschliche Beständigkeit ihrer Heimat setzt die Protagonistin in „Birgit oder die Kunst des Führerscheinerwerbs“ gegen die für sie unverständliche Korrektheit, Arbeitsamkeit und emotionale Distanz, die sie erfährt, als sie in Deutschland angekommen, ihre Führerscheinprüfung wiederholen muss.
„Birgit wollte keinen Wodka. Ich meine, nicht nur während der Fahrstunde, was normal ist, sie wollte auch keine Flasche Wodka am Ende der Stunden haben, wie es sich normalerweise gehört. Birgit schien immer nur mit der Fahrerei beschäftigt zu sein. Das war die reine Langeweile – man erfuhr kaum etwas Persönliches über sie.“
Interkulturelle Clasherfahrungen sind dominierendes Thema der frühen Geschichten, in denen die Sphären unvereinbar bleiben und die Protagonistinnen und ihre Mitmenschen mehr trennt als eine Sprachbarriere. Der Plan, die Fahrlehrerin Birgit als „erste wirkliche Freundin hier“ zu gewinnen, scheitert an deren professioneller Distanz – so wie andersherum die Idee, die eigene Tochter Birgit zu nennen, verworfen wird, denn Birgits gibt es „dort, wo ich geboren bin, nicht und meine Tochter sollte sich dort heimisch fühlen.“
Auch die Protagonistin des Textes „Diese Stadt kann auch weiß sein“, dem ersten auf deutsch geschriebenen Prosastück der Autorin, welches dem Band seinen Namen gibt, scheitert an der Unmöglichkeit, die essentielle Freude über den in der fremden Stadt so seltenen Schnee mit den Spaziergängern im Park zu teilen. Dabei bleibt es interessanterweise auch für den Leser vage, was genau die emotionale Gravität des Schnees ausmacht - in ihm scheinen sich die Fluchtlinien einer märchenhaften Heimat und kindlicher Geborgenheit zu treffen:
„Auf jeden Fall haben die Hunde in meiner Stadt wie verrückt im Schnee gespielt. Es gab dort viel mehr Schnee, Schnee auf den Straßen und Häusern, auf den Gehwegen und auch auf den Bänken im Park.“
Winter und Schnee tauchen leitmotivisch in weiteren Geschichten des Bandes auf, die genau wie die Malerei oder die Problematik der Grenzkriege die Texte, die sich gegenseitig zitieren, zu einem Netz spinnen. Dieses intertextuelle Verfahren, das auch für Sofronievas Lyrik prägend ist, stellt Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart her und ermöglicht es, die Figuren und ihre Biographien über Zeiten und Orte hinweg nebeneinander zu lesen.
Als „Klonen“ bezeichnet Sofronieva das Verfahren, mit dem ihre Gedichte manchmal als parallele Versionen gleichzeitig in mehreren Sprachen entstehen. In ihrer Prosa scheint sich die Autorin in vielen Texten selbst zu „klonen“ und Erzählinstanzen zu schaffen, die nicht nur wesentliche biographische Merkmale mit ihr teilen, sondern sich durch verdeckte Hinweise im Text als Autorin selbst zu erkennen geben - ein Vorgehen, das die Grenzen der Fiktionalität in Frage stellt und eine starke Unmittelbarkeit erzeugt. Indem die Erzählinstanz oder einzelne Figuren den Namen der Autorin tragen, wird beim Leser automatisch biographisches Hintergrundwissen über diese aktiviert. Dieses vermeintlich autobiographische Schreiben erweist sich jedoch als Hinterhalt, wird durch Übertreibung und Stilisierung konterkariert und verweigert sich somit einer Haltung der Zeugenschaft, die gerade in Bezug auf die Debatte um „Migrantenliteratur“ in der Vergangenheit eine wichtige Rezeptionskategorie war. Durch das „Verwirrspiel der Identitäten“ verhindert die Autorin eine Lektüre, die ihren Texten eine Brückenfunktion zuschreibt, sie als authentische Darstellung einer Kultur oder die Illustration kultureller Unterschiede sehen will.
Wie verwickelt dieses Spiel mit der Identität sein kann, offenbart der 1998 zuerst veröffentlichte Text „Frau T.“. Nicht nur, dass das eigenwillige Namenskürzel an Kafkas „K.“ erinnert und damit zugleich als Alter Ego der Dichterin gelesen werden kann; Frau T. wird von der Ich-Erzählerin paradox beschrieben, dass am Ende völlig unklar ist, ob diese Figur nur in ihrer Phantasie existiert, ob sie über sich selbst oder noch schlimmer über die Autorin spricht. Frau T. materialisiert sich genau dann in dem morgendlichen Café, in dem die Erzählerin nichtsahnend sitzt, als diese besonders intensiv an sie denkt und löst sich just in dem Moment wieder in Nichts auf, als diese sie begrüßen will. Der Text kommentiert sich augenzwinkernd selbst, wenn er vermeintliche Gespräche von Erzählerin und Frau T. zitiert, in denen es um „geklonte Lebewesen, Beziehungen zwischen Doppelgängern und Zwillinge aus tiefgefrorenen Embryos“ ging. Die Selbstparodie findet ihren Höhepunkt in den Überlegungen der Erzählerin zum Namen von Frau T.:
„Ich weiß auch nicht, ob ihr Name von ihrem Vater kam, von den Vorfahren ihrer Mutter oder aus der Familie eines Ehemanns, und ob die ihn tragende Familie etwas mit dem Herrn auf dem berühmten Bild Rembrandts gemein hat. Vielleicht war der Name auch ein von ihr gewähltes Pseudonym, Ausdruck einer empfundenen Verwandtschaft.“
Das Verwirrspiel der Identitäten, bei dem sich die Autorin durch allerhand verdeckte Hinweise in ihre eigenen Texte einschreibt, findet sich in zunehmendem Maße in den späteren Texten.
Der Miniaturbriefroman „Briefe einer Blumenfrau an einen Fahrradhändler“ erzählt in elf Briefen eine Liebesgeschichte – eine halbe Liebesgeschichte eigentlich, denn es handelt sich nur um die Briefe der Blumenfrau, deren Berufsbezeichnung erneut die Dichterin selbst parodiert, deren bulgarischer Name Tzveta übersetzt „Blume“ heißt. Eine unterhaltsame Anatomie des richtigen Küssens wird entworfen - offen bleibt, ob die Romanze letztendlich am falschen Kuss scheitert:
„Sehr geehrter Herr!
Schön ist es, wenn ein Kuss zu mir passt und ich zu ihm, wenn die Lippen mehr als die Zähne beißen, und die Zähne mehr als Zunge streicheln, wenn die Zunge weniger als die Lippen will, und alles ist angenehm und einfach.“
In „Violas Gehschichten“, dem letzten Text des Bandes, wird Identität als abgeschlossenes Konzept schließlich zu Gunsten einer Dynamik abgeschafft, die es der Erzählinstanz und den Figuren erlaubt, sich immer wieder neu zu erfinden. Der Ich-Erzählerin Viola, einer neuerlichen „Tzveta“, die im Text an die fünfzig verschiedene botanische Namen erhält, wird bewusst, dass „eine Blume ein Ort ist und ich selbst ein Ort bin“. Damit ist die Affirmation einer positiv gewendeten Ortlosigkeit vollzogen, sind die Grenzen des Ichs überwunden und die Sprachbarrieren eingerissen:
„Temenuzhschka ist eine Viola ist ein Veilchen ist eine Menexes ist eine Ljubicasta ist eine Orvokki ist eine Fialka, ist eine Olopu ist eine Nuscha, ist eine Pamakani, ist eine Sigliah ist eine Vijolica ist eine und viele, ist eine rund um die ganze Kugel.“
Sprache, das wird aus dem erstaunlichen Fortgang der Texte deutlich, ist nicht das Werkzeug, das man bis zur Perfektion beherrscht, und ein Sprachenwechsel ist nicht zu vergleichen mit einem Musikinstrumentenwechsel. „Die Sprachen sind die Noten, nicht die Instrumente.“ schreibt Sofronieva in ihrem metapoetischen Text „…und am Ende unterschreiben“ – und findet damit Worte für die einzigartige, intime Verquickung von Sprache und Aussage, von Form und Inhalt und der Körperlichkeit des Schreibens, dieser „masochistischen wunderbaren Orgie des Entdeckens.“
Sofronieva, Tzveta: Diese Stadt kann auch weiß sein. Tübingen: Verlag Hans Schiler, 2010.
Weitere Informationen unter: www.tzveta-sofronieva.de