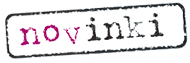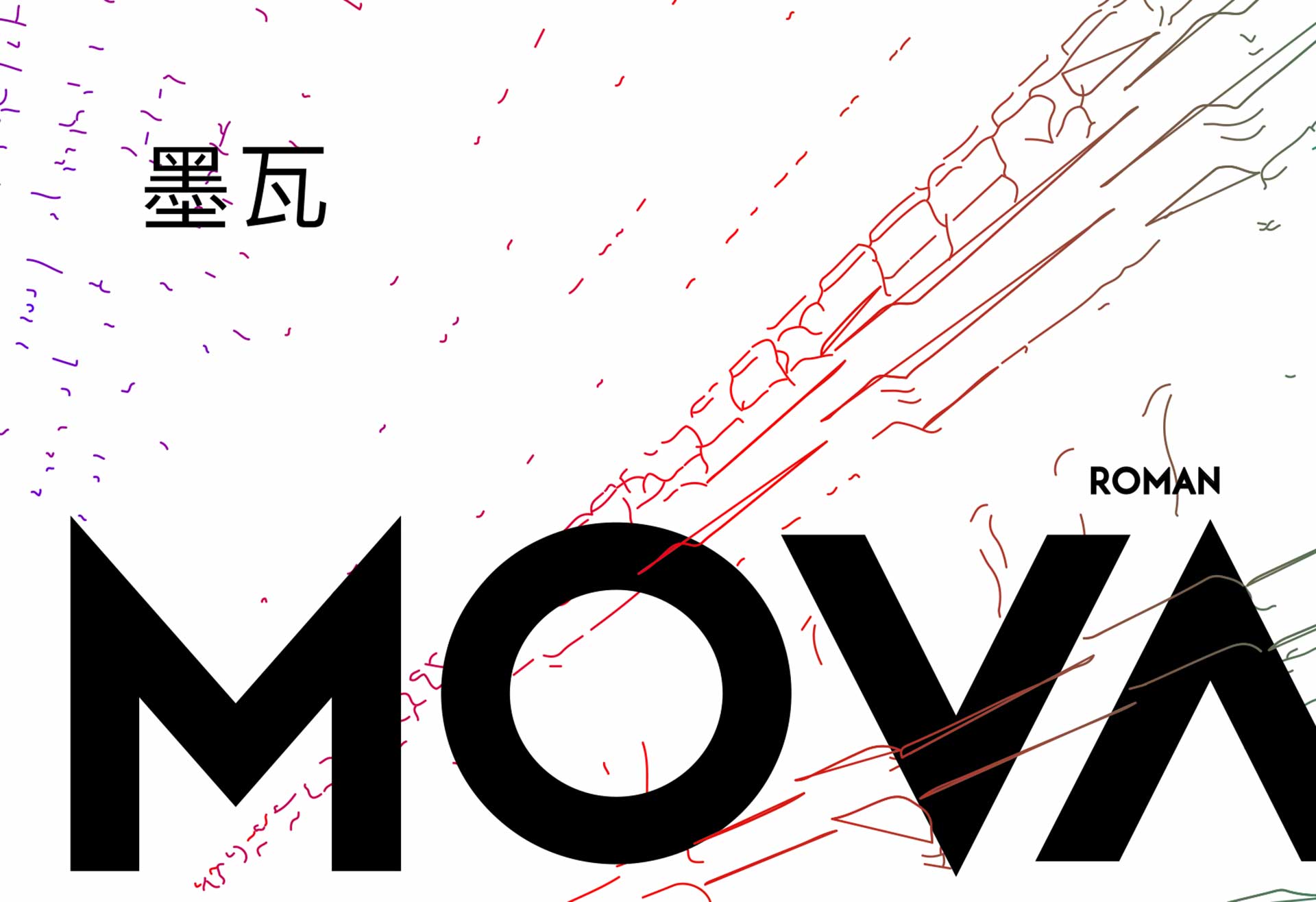Wir schreiben das Jahr 4741 chinesischer Zeitrechnung. Minsk, eine abgelegene Stadt in der nord-westlichen Provinz des chinesisch-russischen Unionsstaates, bietet ein augenscheinlich stabiles Leben. Der Wohlstand ist gesichert, alle gehen ihrer Arbeit nach, Demonstrationen stehen nicht auf der Tagesordnung. Nur eines scheint nicht in das System des Staates zu passen – Mova.
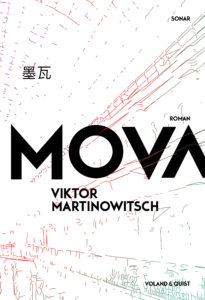 Wie bereits in seinem ersten Roman Paranoia thematisiert der belarussische Schriftsteller und Journalist Viktar Marcinovič nun auch in Mova den repressiven Einfluss der Staatlichkeit auf das Leben der Bevölkerung. Dabei verbindet er dystopische Elemente, die stark an George Orwells Roman 1984 und Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451 erinnern, mit einer sprachpolitischen Thematik. Es ist nicht von ungefähr, dass Marcinovič diesen Roman, im Gegensatz zu Paranoia und anderen Werken, auf Belarussisch schrieb. Im Vordergrund steht nämlich die Droge „Mova“, das belarussische Wort für Sprache, deren Konsum verboten ist. „Mova“ sind kleine Zettel mit Worten oder einzelnen Buchstaben, die einen Rauschzustand bei ihren Leser_innen auslösen. Das Besondere an der Droge ist jedoch, dass sie ihre Wirkung nur bei Menschen aus dem ehemaligen Belarus entfalten kann.
Wie bereits in seinem ersten Roman Paranoia thematisiert der belarussische Schriftsteller und Journalist Viktar Marcinovič nun auch in Mova den repressiven Einfluss der Staatlichkeit auf das Leben der Bevölkerung. Dabei verbindet er dystopische Elemente, die stark an George Orwells Roman 1984 und Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451 erinnern, mit einer sprachpolitischen Thematik. Es ist nicht von ungefähr, dass Marcinovič diesen Roman, im Gegensatz zu Paranoia und anderen Werken, auf Belarussisch schrieb. Im Vordergrund steht nämlich die Droge „Mova“, das belarussische Wort für Sprache, deren Konsum verboten ist. „Mova“ sind kleine Zettel mit Worten oder einzelnen Buchstaben, die einen Rauschzustand bei ihren Leser_innen auslösen. Das Besondere an der Droge ist jedoch, dass sie ihre Wirkung nur bei Menschen aus dem ehemaligen Belarus entfalten kann.
Willkommen im Tal der Verwirrung
„Mova macht nicht abhängig. Das ist medizinisch erwiesen. Fragt einen Arzt eurer Wahl außerhalb der lauschigen vier Wände seiner Praxis, wo die medizinische Aufsicht alles mitschneidet, und er wird es euch unter vier Augen erklären. Mova geht direkt auf die Psyche, ohne Umweg über den Körper, deshalb sind Vergiftungserscheinungen ausgeschlossen“, so der selbsterklärte Junkie und Minsker Intellektuelle, der Ich-Erzähler des Romans. Seinen ersten Trip hat er in einem Klub im Szeneviertel der Stadt. Eine Frau flüstert ihm, wie er findet, urwitzige Worte ins Ohr und nimmt ihn mit auf die Toilette. Dort konsumieren sie „Mova“. Sergej wiederum, Typ „Schwiegermutters Liebling“, klein, unauffällig, wie er sich selbst beschreibt, steht in einer ganz anderen Verbindung zur Droge. Er konsumiert sie nicht, er verkauft sie. So begibt er sich ins ferne Warschau, um einen „Rucksack bis oben hin voll mit diesen Papierchen hochwertigen erstklassigen Stoffs, der stärker ist als LSD – mit Mova“ zu besorgen. Der Dealer kennt das staatliche System, weiß, wann und wie er schmuggeln kann. Der Intellektuelle wiederum kennt alle sprachlichen Feinheiten und die Geschichte dieser Droge. Alles nimmt seinen Lauf, bis beide Protagonisten in das Netz des Widerstands und damit auch der staatlichen Behörden geraten.
Trotz der klaren Erzählperspektiven durch die zwei Protagonisten und der Verortung des Plots in Minsk als Provinzstadt, stiftet die Handlung mehr Verwirrung, als dass sie Klarheit schafft. Sobald man beim Lesen ansatzweise ein Verständnis für eine räumliche Situation oder eine Person entwickelt, wird es durch Geschehnisse oder Ortswechsel innerhalb der Stadt gebrochen. Hegt man Sympathie für eine Figur, so wandelt sich deren Charakter im nächsten Moment ins Gegenteil. Zudem ist man sich nie sicher, ob die zwei Protagonisten nicht doch ein und dieselbe Person sind. Marcinovič erklärt diese Struktur in seinem Interview mit novinki wie folgt: „Aber dann gehen sie auseinander. Mehr noch: Einer ermordet den anderen. Ich glaube, das Wichtigste hier ist das Fixieren des für mich wichtigen Gefühls, dass die Freundschaft und sogar die Liebe in der heutigen Gesellschaft nach dem Schema ,Drogendealer-Junkie‘ funktionieren. Wir verkaufen einander alle Arten von Rausch. Und wir kommunizieren mit dem anderen nur, solange er das für uns wichtige Rauschmittel besitzt. Wir wollen uns alle grundsätzlich nur vergessen – im Sex, im Alkohol, im ständigen Konsum .“ Und das macht diesen Roman so spannend. Die Handlung ist so berechnend unvorhersehbar.
Die Sprache als Politikum
Viktar Marcinovič spielt mit gesellschaftspolitischen Bezügen auf die aktuelle Situation des Landes an und warnt gleichzeitig davor, einen Zusammenhang zwischen der Erzählung und eben dieser Gegenwart herzustellen. Fraglich ist, ob Leser_innen ohne Ortskenntnisse einen Zusammenhang zur Gegenwart von Belarus herstellen (können) werden. Eingeweihten drängt sich indessen einerseits eine Verbindung zwischen Erzählung und gegenwärtiger Sprachsituation in Belarus geradezu auf, andererseits auch der intertextuelle Bezug zu Vladimir Sorokins Dramolett Dostojewskji Trip, in dem die russische Literatur als Droge fungiert, deren Konsum die rauschartige Suche nach der eigenen kulturellen Identität befördert.
Dem Übersetzer Thomas Weiler, der unter anderem Werke von Al’herd Bacharėvič und auch bereits Paranoia von Marcinovič übersetzt hat, ist seine Aufgabe mit großem stilistischen Feingefühl gelungen. Die in den Text eingefügten „Zettelchen“, Ausschnitte aus Werken der belarussischen Literaturgeschichte, werden in deutscher und belarussischer Fassung wiedergegeben, so dass sich interessierte Leser_innen auch ein Bild von der stilistischen Vielfalt des Belarussischen machen können. Vor allem für Leser_innen mit gewissen Vorkenntnissen ist dieses Format sehr hilfreich und lädt zur eigenständigen Auseinandersetzung mit Land und Sprache ein.
Obwohl der Roman Paranoia in Belarus nur unter der Ladentheke zu kaufen ist und sich auch bei Mova mögliche Repressalien abzeichnen, manifestiert sich in Marcinovičs neuem Romaneine Haltung, die der junge Autor vom Vater der zeitgenössischen belarussischen Literatur Janka Kupala übernehmen konnte:
Unsterbliches Wort, du, heimisches Wort!
Du überwandest Unrecht und Unwahrheit;
Obwohl man dich verfolgte, dir Fesseln anlegte,
War es umsonst: Du lebst, so wie du gelebt hast.
Martinowitsch, Viktor: Mova. Aus dem Belarussischen von Thomas Weiler. Dresden/Leipzig: Voland & Quist, 2016.
Marcinovič, Viktar: Mova. Minsk: Knigazbor (belarussisches Original); Minsk: Lohvinaŭ (russische Übersetzung); Pjaršak (elektronische Herausgabe), 2014.
Die russischsprachige Version des Romans steht hier zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Weiterführende Links:
novinki-Interview mit Viktar Marcinovič vom 08.08.2015: „Mein Buch ist wie eine Art Stromschlag, der die ganze Stadt erfasst“.
Kurzbiographie beim Voland & Quist Verlag.
Weitere bisher erschienene Romane von Viktar Marcinovič:
In deutscher Übersetzung:
Martinowitsch, Viktor: Paranoia. Aus dem Russischen von Thomas Weiler. Dresden/Leipzig: Voland & Quist, 2014.
Erstveröffentlichungen auf Russisch/Belarussisch:
Martinovič, Viktor: Paranojja. Moskva: AST, 2009.
Marcinovič, Viktar: Scjudzeny vyraj. Minsk: Pjaršak (elektronische Herausgabe, Belarussisch), 2011.
Marcinovič, Viktar: Sfagnum. Minsk: Knigazbor (belarussische Übersetzung), Pjaršak (elektronische Herausgabe, Originalversion Russisch), 2013.