

Ende der Geschichte, vorrübergehend ausgesetzt
Maša Gessen [Masha Gessen] hat über Pussy Riot, Putin und den Mathematiker Perelman geschrieben. Für die New York Times berichtet sie regelmäßig über ihre russische Heimat, aus der sie zwei Mal emigrierte. Nun hat sie ihre Erfahrungen und Enttäuschungen literarisch verarbeitet. Dafür wurde sie in Leipzig mit dem Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet.
Dieses Buch über Russland will den ganz großen Bogen spannen: Vom beginnenden Zerfall der Sowjetunion, über die chaotischen Neunziger, hin zur schleichenden Rückkehr des Autoritarismus unter Vladimir Putin. Eine Referenz an Francis Fukuyamas Ende der Geschichte darf dabei nicht fehlen. Das hat sich wohl auch der Suhrkamp-Verlag gedacht, als er die Rückseite von Maša Gessens epochalem Werk mit eben jenem so oft zitierten und nicht minder häufig widerlegten US-Philosophen schmückte. Dieser hatte nach dem Niedergang des sowjetischen Staatskommunismus den weltweiten Siegeszug der freiheitlichen Demokratie prophezeit.
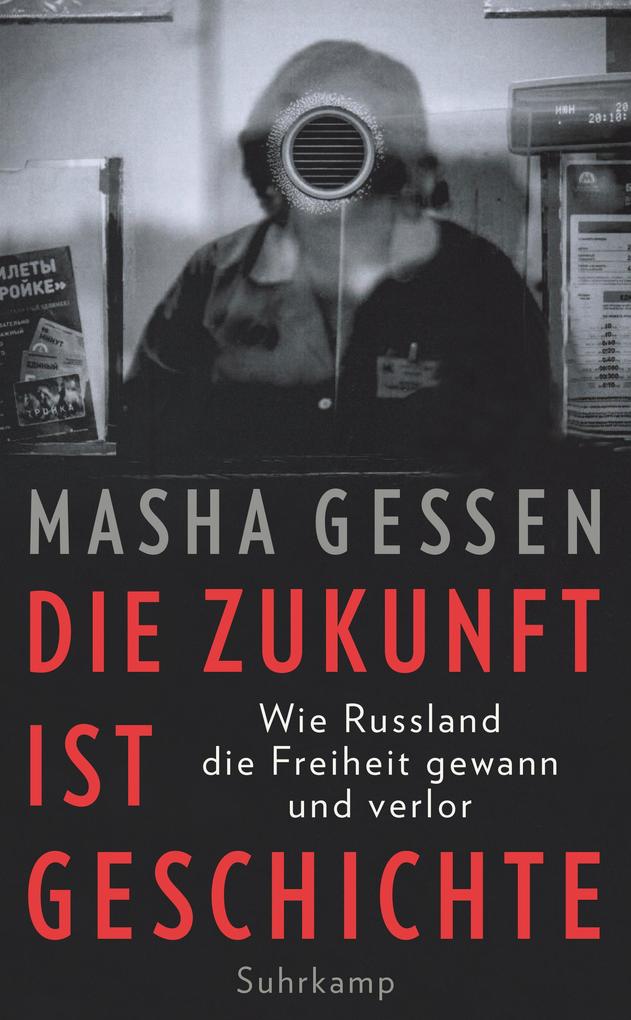
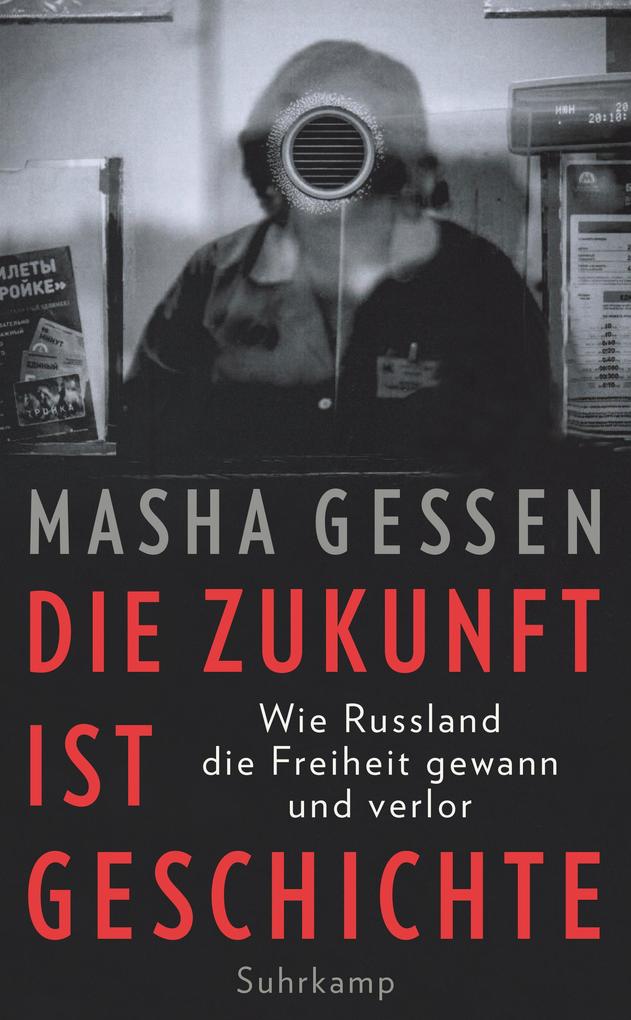
Maša Gessens Antwort auf Fukuyama trägt den Titel Die Zukunft ist Geschichte. Es ist eine Abrechnung mit Russland geworden. Eine Abrechnung mit dem Land, in das ihre Familie einst voller Hoffnung zurückkehrte und das Maša Gessen wieder verließ, als der Hass auf Minderheiten zu groß wurde. Heute kommentiert die offen lesbisch lebende Journalistin das politische Geschehen in ihrer Heimat für die New York Times. Ihren kritischen Blick als Außenstehende und Betroffene zugleich nutzt sie nun, um anhand von vier Lebensgeschichten, die in den Jahren der Perestroika beginnen, das Portrait einer Generation zu zeichnen, die sich auch dreißig Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs noch immer auf der Suche nach der eigenen Identität befindet.
Hähnchengrüße aus Washington
Eine dieser Biographien ist die von Lëša [Ljoscha]. Für Lëša beginnt der Aufbruch in die von Fukuyama beschriebene, neue freie Welt und ihr Wohlstandsversprechen mit Kernseife. Kernseife, die seine Mutter Galina stapelweise gegen ihre Zuteilungskarten eintauscht, weil sie sich zur Körperpflege ebenso gut eignet wie zum Waschen der Wäsche, zum Kurieren von Erkältungen oder zur Entfernung von Warzen. Gleichzeitig sorgt ein Handelsabkommen zwischen den Präsidenten Gorbačëv [Gorbatschow] und Bush dafür, dass der Mittagstisch mit minderwertigen Hähnchen-Restbeständen („Bush-Schenkel“) aus den Vereinigten Staaten aufgewertet wird.
Der neue Geist und die Freiheit des Einzelnen, für Lëša verkörperte er sich im Fernsehen. Während die Nachbarkinder Hunde jagen und sexuelle Dienstleistungen für ein paar Rubel anbieten, bewundert er Lëna Golubkov [Ljona Golubkow], die Heldin einer Werbekampagne für ein Schneeballsystem, das viele russische Kleinstsparer_innen um ihre Rücklagen betrügen wird. Szenen wie diese zeigen die erzählerische Stärke des Textes. Wenn Maša Gessen die Grotesken des Alltags in vollkommen nüchterner Sprache zusammenträgt und aufzeigt, wie sich der Schatten der großen Politik darüberlegt, werden auch für die Leser_innen die Irrungen und Wirrungen dieses ersten Jahrzehnts nach dem Ende des Kalten Krieges erfahrbar.
Und es ist viel passiert: Das Auseinanderbrechen der Sowjetunion, der Putschversuch gegen die Regierung Jel’zin [Jelzin], Schüsse aufs Parlament, zwei Tschetschenienkriege. Das alles unter den Vorzeichen eines entstehenden „Mafia-Staates“, der sich die Überforderung der Bevölkerung mit der neugewonnenen Freiheit zu Nutze macht, um ein autoritäres Regime zu installieren, das dem alten im Kern nicht gar so unähnlich ist. Doch wie konnte es soweit kommen?
Totalitäres Trauma
Zur Beantwortung dieser Frage führt Gessen eine dritte Ebene ein und zeichnet auch die Geschichte der russischen Wissenschaft nach. Genauer gesagt der Psychologie und Soziologie, denen erst im Reformeifer der Gorbačëv‑Jahre Relevanz verliehen wurde. Fachrichtungen, die sich explizit mit dem Seelenheil des Individuums beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen „Ich“ – für den „Homo Sovieticus“ bis dato undenkbar. „Homo Sovieticus“, so lautet die vom Dissidenten Aleksandr Zinov’ëv populär gemachte Polemik über den vorherrschenden, opportunistischen Menschentypus in der Sowjetunion. Er zeichnet sich durch einen Anpassungsmechanismus an den totalitären und kollektiv ausgerichteten Unrechtstaat aus, den George Orwell bereits in seinem dystopischen Klassiker 1984 als „Doppeldenk“ postuliert hat: „Bewusst die Unbewusstheit herbeizuführen und sich dann wieder des eben vollbrachten Hypnoseakts unbewusst zu werden.“
Der Soziologe Lev Gudkov [Lew Gudkow] und das Levada-Zentrum [Lewada-Zentrum] machten sich den Begriff zu eigen, um den Wandel im Denken der Bürger_innen, ihre Ängste und Sorgen nach dem Zerfall des Sowjetstaats zu ergründen. Die Ergebnisse der in den Folgejahren fortgesetzten Studien des Levada-Zentrums liefern Gessen die Grundlage, um mit spielerischer Leichtigkeit eine Einführung in die Ideengeschichte des Totalitarismus bereitzustellen. Der Aufstieg des Biedermanns Vladimir Putin an die Spitze der Macht erklärt sich so fast von selbst. Seine vordergründige Eigenschaftslosigkeit bietet die ideale Projektionsfläche für ein Land, das sich nichts sehnlicher wünscht als Stabilität und glaubt, diese in den Übeln der Vergangenheit zu finden.
Wie aus Journalismus Literatur wird
Mit Blick auf die politische Landkarte nach der europäischen Parlamentswahl und die jüngsten Umfrageergebnisse kurz vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland erweist sich „Zukunft ist Geschichte“ als würdiger, ja logischer Empfänger für den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Dabei sollte jedoch nicht unterschlagen werden, dass es auch kritische Stimmen gibt. Denn so sehr sich die Autorin auch bemüht, ihre eigene Wertung im Text zurückzuhalten – sich darauf beschränkt, Meinungen und Beobachtungen gegenüberzustellen und sorgfältig abzuwägen – am Ende bleibt es doch die Geschichte, die Maša Gessen uns erzählen möchte. Denn natürlich ist es vermessen anzunehmen, dass vier ausgewählte Biographien das umfassende Bild einer Gesellschaft bieten könnten. So unterschiedlich die Ausgangspunkte im Leben für Lëša, Maša [Mascha], Serëža [Serjosha] und Žanna [Shanna] auch gewesen sein mögen, repräsentieren sie doch alle eine bildungsbürgerliche Elite, deren Weltanschauung nicht allzu weit entfernt von der Maša Gessens liegen dürfte. Der gesetzte Rahmen der Erzählung bleibt dadurch bewusst eng. Doch das muss nicht zwangsläufig ein unlauteres Mittel sein. Es ist sogar legitim, zumal Maša Gessen ihr Vorgehen durch einen ausführlichen Prolog und Epilog jederzeit kenntlich macht. Das Buch besticht zudem durch einen mit Anmerkungen versehenen Quellennachweis, der den viel gescholtenen Spiegel-Dokumentaren Tränen in die Augen treiben müsste. Denn anders als Claas Relotius hat Maša Gessen erkannt, dass Journalismus nur dann zu großer Literatur werden kann, wenn man sie aus den Fakten herausgräbt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Maša Gessens Geschichte endet in den Protesten nach der Duma-Wahl von 2011. Als es für einen kurzen Moment so schien, als könnte sich die erste postsowjetische Jugend aus der Umklammerung der Vergangenheit befreien. Sie findet ihren tragischen Höhepunkt mit der Kulmination des Staatsterrors und buchstäblichen Ermordung der Opposition in Gestalt von Boris Nemzov [Boris Nemzow].
Es ist ein trauriges Ende. Ein Ende, das wenig Raum für Hoffnung lässt und das sich eine resignierte Autorin nur noch mit der umstrittenen Todestrieb-Theorie von Sigmund Freud erklären kann. Oder, wie es die Psychoanalytikerin Marina Arutjunjan auf den letzten Seiten formuliert: „Dieses Land wollte sich selbst töten. Alles Lebendige – die Menschen, ihre Worte, ihr Protest, ihre Liebe – rief hier Aggressionen hervor. Die Lebensenergie war dieser Gesellschaft unerträglich geworden. Sie wollte sterben; das Leben war ein ausländischer Agent.“
Es sind bestürzende Sätze, die Maša Gessen ihren Leser_innen zum Schluss mit auf dem Weg gibt und man kann nur hoffen, dass sich Geschichte 30 Jahre nach Fukuyama wiederholt und eine These widerlegt wird. Anzeichen der Hoffnung gibt es: Zur Stunde scheint es so, dass die Wut über die unrechtmäßige Festnahme des Journalisten Ivan Golubov der Zivilbevölkerung neues Leben eingehaucht hat. Der Journalist ist frei, die Proteste gehen weiter.
Gessen, Masha [Gessen, Maša]. Die Zukunft ist Geschichte. Wie Russland die Freiheit gewann und verlor. Aus dem amerikanischen Englisch von Anselm Bühling. Berlin: Suhrkamp, 2018.


