

Von Briefen in Keilschrift und schwarzweißen Lämmern


Der Roman fächert sich nicht nur in eine Vielzahl verschiedener narrativer Formen auf, sondern vereint auch mehrere Erzählstränge, die auf Seiten der tschechischen Kritik zu den unterschiedlichsten Lesarten und Interpretationen Anlass gaben. Im Mittelpunkt steht das komplizierte und schmerzbehaftete Dreiecksverhältnis von Josef, Květa und Hynek. Während erstere kurz nach ihrer Heirat Anfang der 50er Jahre durch die zehn Jahre währende politisch motivierte Inhaftierung Josefs getrennt werden, macht Hynek Karriere beim tschechischen Staatssicherheitsdienst. Hynek, der mit der Untersuchung von Josefs Fall betraut ist, nutzt Květas Notlage und ihre Sorge um den Ehemann schamlos aus und drängt sie zu einer von Abhängigkeit und gleichzeitiger Anziehung getragenen Beziehung. Er droht ihr, ihren Mann für immer verschwinden und ihre Tochter in ein Heim bringen zu lassen, falls sie ihm nicht zu Willen ist. Bleibt Květa zu Beginn keine andere Wahl, beginnt sie später paradoxerweise den Schmerzen, der Erniedrigung immer mehr abzugewinnen. Hynek ist sich dessen bewusst – und genießt die Kontrolle, die er durch abwechselnde Zuwendung und Bestrafung über Květa gewinnt. Ihre Kontakte enden erst mit Josefs Entlassung im Jahr 1960. Die Eheleute versuchen, ihr gemeinsames Leben wieder aufzunehmen, aber als Josef durch einen anonymen Brief erfährt, dass seine Frau, während er im Gefängnis saß, ausgerechnet mit seinem Peiniger ein jahrelanges Verhältnis geführt hat, kommt es zum endgültigen Bruch. Er kann seiner Frau nicht verzeihen. Über Jahre hinweg verharren beide im sprachlosen status quo, er lebt im Wochenendhaus der Familie und die Tochter und später der Enkel werden zum einzigen Verbindungsglied zwischen ihm und seiner Frau. Erst ein Liebesbrief in Keilschrift, den die Tochter nach dem Tod Josefs in dessen Hinterlassenschaften entdeckt und von einem Spezialisten entziffern lässt, offenbart, dass er trotz seines beharrlichen und verletzten Schweigens all die Jahre hindurch eine tiefe Liebe für seine Frau empfunden hat. Dieses Produkt seines einzigen Hobbys, nämlich der Beschäftigung mit unbekannten Schriftsystemen, wird so zur Chiffre für die Unmöglichkeit, seine Gefühle verständlich mitzuteilen, geschweige denn, dem Verlangen nach Versöhnung nachzugeben.
Zmeškal zeichnet das Eindringen des politischen Systems ins Private stellenweise mit kaum zu ertragender Genauigkeit. Der Masochismus, der die Beziehung zwischen Květa und dem Schergen ihres Mannes prägt, illustriert die P e r v e r s i o n d e r M a c h t – die Staatsgewalt macht nicht einmal vor den intimsten Lebensbereichen des Einzelnen halt. Auf fast pornographische Art und Weise erzählt er, wie das System sexuelle Abhängigkeiten schafft, um Menschen politisch gefügig zu machen, wie sich die Opfer am Ende selbst schuldig fühlen für das, was ihnen widerfahren ist. Dabei ist Zmeškal klug genug, nicht einer simplen Personifizierung des Bösen auf den Leim zu gehen – denn immer haben die Peiniger neben ihren politischen und ideologischen auch ganz banale, persönliche Motive.
Die Geschichte von Josef und Květa wird durch weitere, lyrisch-reflexive Erzählstränge ergänzt. Die Art und Weise, wie Zmeškal Elemente in den Text einflicht, die vermeintlich nichts mit der eigentlichen Handlung oder dem Figurenensemble zu tun haben, erinnert dabei fast an die Romane Milan Kunderas. Dort sind philosophische Erörterungen, ja ganze Essays oder Musikstücke in die Romanhandlung integriert – man denke nur an das „Kleine Verzeichnis unverstandener Wörter“, von dem Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins immer wieder unterbrochen wird. Im Liebesbrief in Keilschrift findet sich eine Erzählung über einen Freund Josefs und Květas, einen Psychiater, der die Ursachen menschlicher Grausamkeit erforscht. Sie werden ergänzt von biografischen Abhandlungen oder psychiatrischen Fallstudien. Großen Raum nehmen etwa die wahnhaften Visionen eines Mannes ein, der sich als genetischer Zwilling Adolf Hitlers betrachtet und der Meinung ist, Opfer eines psychologischen Experiments zu sein, mit dem die Rolle der Erbanlagen bei der Entstehung des Bösen untersucht worden sei. Die unzähligen historischen, literarischen, psychologischen und philosophischen Anspielungen und Verweise, die vor allem diese Erzählstränge prägen, erschließen sich unter Umständen erst bei der zweiten oder dritten Lektüre.
All diese einzelnen Elemente verbindet Zmeškal zu einer labyrinthischen Erzählung. Beständig breitet der Text neue Fragen aus, mit deren Beantwortung er sich zumeist viel Zeit lässt. Von der ersten Seite an legt Změškal dabei falsche Fährten, erweckt den Eindruck, jeweils gerade die Geschichte zu erzählen, um die es ihm eigentlich geht – nur um den Leser wenige Seiten später erkennen zu lassen, dass es sich erneut um eine Sackgasse gehandelt hat. Auch wenn das Buch streckenweise stark durchkomponiert wirkt, bleibt der Text doch stets spannend – denn auch noch die letzte Seite ist notwendig, um den Roman als Ganzes verstehen zu können. Erst nachdem man Zmeškals Irrgarten vollständig durchlaufen hat, begreift man die Bedeutung seiner einzelnen Bestandteile. Wie Květa, die den Brief ihres Mannes erst entziffern lassen muss, ehe sie ihn versteht, so muss auch der Leser den komplizierten Aufbau des Romans gewissermaßen dekodieren, um hinter das Geheimnis von Zmeškals erzählerischer Methode zu kommen.
Wovon sich die Kritiker angesichts der Biographie Zmeškals gleichermaßen fasziniert wie irritiert fühlten, war neben der für einen Erstling besonderen Reife des Romans (für die er 2008 den Josef-Škvorecký-Preis für das beste Debüt erhielt) vor allem die völlige Abwesenheit von Exotik und Außenseitertum in seinem Erzählen. Erst das Erscheinen von Zmeškals zweitem Roman, Životopis černobílého jehněte (Lebenslauf eines schwarzweißen Lamms) beantwortete die Fragen der Kritik teilweise mehr als eindeutig: Zum einen stellte sich heraus, dass Zmeškal dieses zweite Buch lange vor dem Liebesbrief in Keilschrift geschrieben hatte. Bei seinem Erstling handelte es sich also eigentlich um sein zweites Werk. Zum anderen schien diese zweite Veröffentlichung die Forderungen der Kritiker nach dem besonderen, dem anderen Blickwinkel, den sie von Zmeškal erwarteten, einzulösen. Doch dieser begnügte sich in Lebenslauf eines schwarzweißen Lamms nicht damit, seine eigene Biographie in den Roman einfließen zulassen, sondern er machte das Anderssein an sich zum Thema.
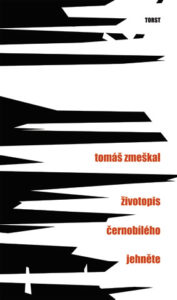
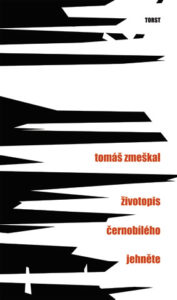
Lucie erfährt die Diskriminierung weniger institutionalisiert und direkt. Je älter sie wird, desto mehr misstraut sie den Menschen in ihrer nächsten Umgebung. Sie glaubt, die Männer, die mit ihr zusammen seien, betrachteten sie als Trophäe an ihrer Seite und als besonders wirksamen Ausdruck der eigenen Unangepasstheit an die unter der sowjetischen Besatzung erstarrte Gesellschaft. Als sie den Kontakt zu anderen Menschen sucht, die ihre Erfahrungen des Nichtdazugehörens teilen und in den Semesterferien als Betreuerin in einem Sommerlager für Roma-Kinder arbeitet, heißt es, eine Schwarze wie sie sei für diese das falsche Vorbild und für eine solche Tätigkeit nicht geeignet.
Beide, Václav und Lucie, begegnen diesem alltäglichen Rassismus seltsam passiv. Als könnten sie der Ablehnung der anderen nichts entgegensetzen, ziehen sie sich völlig zurück. Während Lucie an dieser selbstgewählten tatenlosen Isolation zugrunde geht, bedeutet sie für Václav einen Ausweg aus der Gesellschaft, die ihn nicht annehmen will. Auch wenn die Passivität der Hauptfiguren kaum zu begreifen und bisweilen schwer zu ertragen ist und das Buch sich gerade in der Schilderung der Kindheitsjahre oft belanglosen und langatmigen Schilderungen hingibt, bezieht es seine besondere Kraft gerade daraus, dass es diesen Rückzug absolut konsequent inszeniert. Die Szenen, die Václavs Aufenthalt in der Psychiatrie beschreiben, wohin er sich durch die Simulation einer endogenen Depression vor dem Militärdienst flüchtet, gehören zu den besten des Buches. Freilich, es ist kein neues Motiv, dass sich gerade unter den vermeintlich Geisteskranken die Einzigen finden, die sich einen klaren Blick auf die gesellschaftliche Realität erhalten haben, aber dennoch ist es ein überaus schlüssiges Bild, dass das Irrenhaus bei Zmeškal der einzige Ort ist, an dem Václav nicht auffällt und behandelt wird wie jeder andere.
Ein wenig bedauerlich ist, dass Zmeškal seine zum Teil überaus interessanten Nebenfiguren so nachlässig behandelt, dass manche im Laufe des Romans einfach verloren gehen. So wäre etwa die Geschichte der Mutter der Zwillinge eine, die das zuweilen etwas eindimensional auf die Hauptfiguren konzentrierte Romangeschehen um eine Dimension hätte erweitern können, die den Rahmen des Privaten überschreitet. Wie die beiden nämlich im Alter von 15 Jahren erfahren, ist ihre Mutter nicht bei einem Unfall verstorben, sondern hat, nachdem sie die Feindseligkeit, die ihre Umgebung ihr und ihren beiden dunkelhäutigen Kindern entgegen brachte, nicht mehr ertragen konnte, die ganzen Jahre über ebenfalls in einem Pflegeheim für psychisch Kranke gelebt. Und doch verschwindet sie auf merkwürdige Weise aus dem Roman; der Leser erfährt nach einer einzelnen Begegnung zwischen ihr und ihren Kindern nie wieder etwas über ihren Verbleib oder auch nur darüber, das sich die Zwillinge mit dieser Begegnung auf irgendeine Art und Weise beschäftigen. Das gleiche Schicksal ereilt auch einige andere Familienangehörige, die in den ersten Kapiteln des Buches eine nicht unbedeutende Rolle spielen, dann aber nie mehr Erwähnung finden. Dabei hätten auch diese Figuren das Potenzial, die passive Haltung der Geschwister gegenüber der Intoleranz ihrer Umgebung möglicherweise in Frage zu stellen: da sind die Figuren zweier Onkel, einer ist homosexuell, der andere ist gelähmt und sitzt im Rollstuhl. In beiden Fällen wird angedeutet, dass diese Figuren sich gegen die Diskriminierung, die sie erfahren, zur Wehr setzen und dass sie für ihre Interessen zu kämpfen bereit sind. Dennoch verschwinden auch diese potenziellen Vorbilder im Laufe des Romans. Die merkwürdige Larmoyanz und Untätigkeit der Hauptfiguren gipfelt schließlich darin, dass – und hier löst sich auch der ungewöhnliche Titel des Buches ein – Lucie gewissermaßen zum Opferlamm werden und sich selbst das Leben nehmen muss, um Václav endlich aus seiner Passivität zu reißen und zur Emigration zu bewegen.
Dennoch können diese Inkohärenzen und die manchmal unverständliche Haltung der Protagonisten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei Lebenslauf eines schwarzweißen Lamms um ein besonderes Buch handelt. Außergewöhnlich ist in erster Linie, dass es ein, in der tschechischen Literaturszene bislang kaum präsentes Thema anspricht: In einem Land, in dem rassistische Haltungen gegenüber Roma oder Vietnamesen auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs an der Tagesordnung sind, gibt es so gut wie keine literarischen Werke aus der Feder von Personen, die von diesem Phänomen selbst betroffen sind. Wie ungewöhnlich eine solche Perspektive noch immer ist, zeigt etwa die Affäre um den Roman Bílej kůň, žlutej drak (Weißes Pferd, gelber Drache), das 2009 unter dem Namen einer jungen, in Tschechien aufgewachsenen Vietnamesin erschien. Das Buch erregte großes Aufsehen und wurde als erster tschechischsprachiger Roman aus der Feder einer Autorin mit Migrationshintergrund gefeiert. Die Enthüllung, dass sich hinter dieser Kunstfigur ein etablierter tschechischer Autor verbarg, beschäftigte im vergangenen Jahr die Feuilletons aller namhaften Tageszeitungen und Zeitschriften.
Vor diesem Hintergrund kann man Zmeškal für die Entscheidung, seinen Lebenslauf eines schwarzweißen Lamms nicht als sein erstes Buch zu veröffentlichen, nur gratulieren. Denn andernfalls wäre über der Diskussion um den Gegenstand des Buches und die Biografie seines Autors sicherlich übersehen worden, dass es sich bei Zmeškal um einen außergewöhnlichen Erzähler handelt. Indem er jedoch den literarisch sicherlich ausgereifteren Liebesbrief in Keilschrift zuerst veröffentlichte, konnte er vermeiden, dass sein Werk allein auf autobiografische Aspekte reduziert wurde.
Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem (Liebesbrief in Keilschrift), torst, Praha, 2008
Ders.: Životopis černobílého jehněte (Lebenslauf eines schwarzweißen Lamms), torst, Praha, 2009


