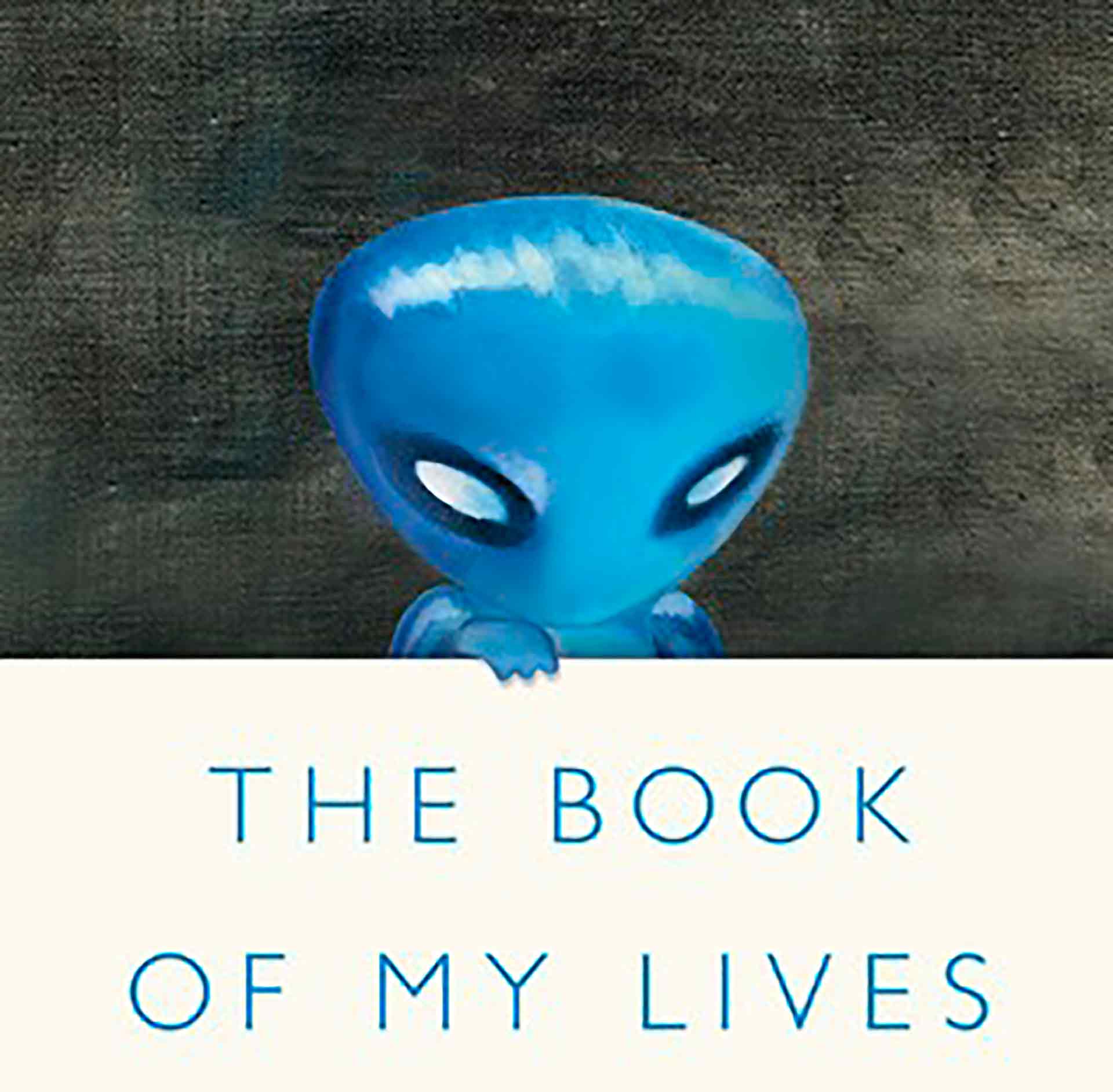
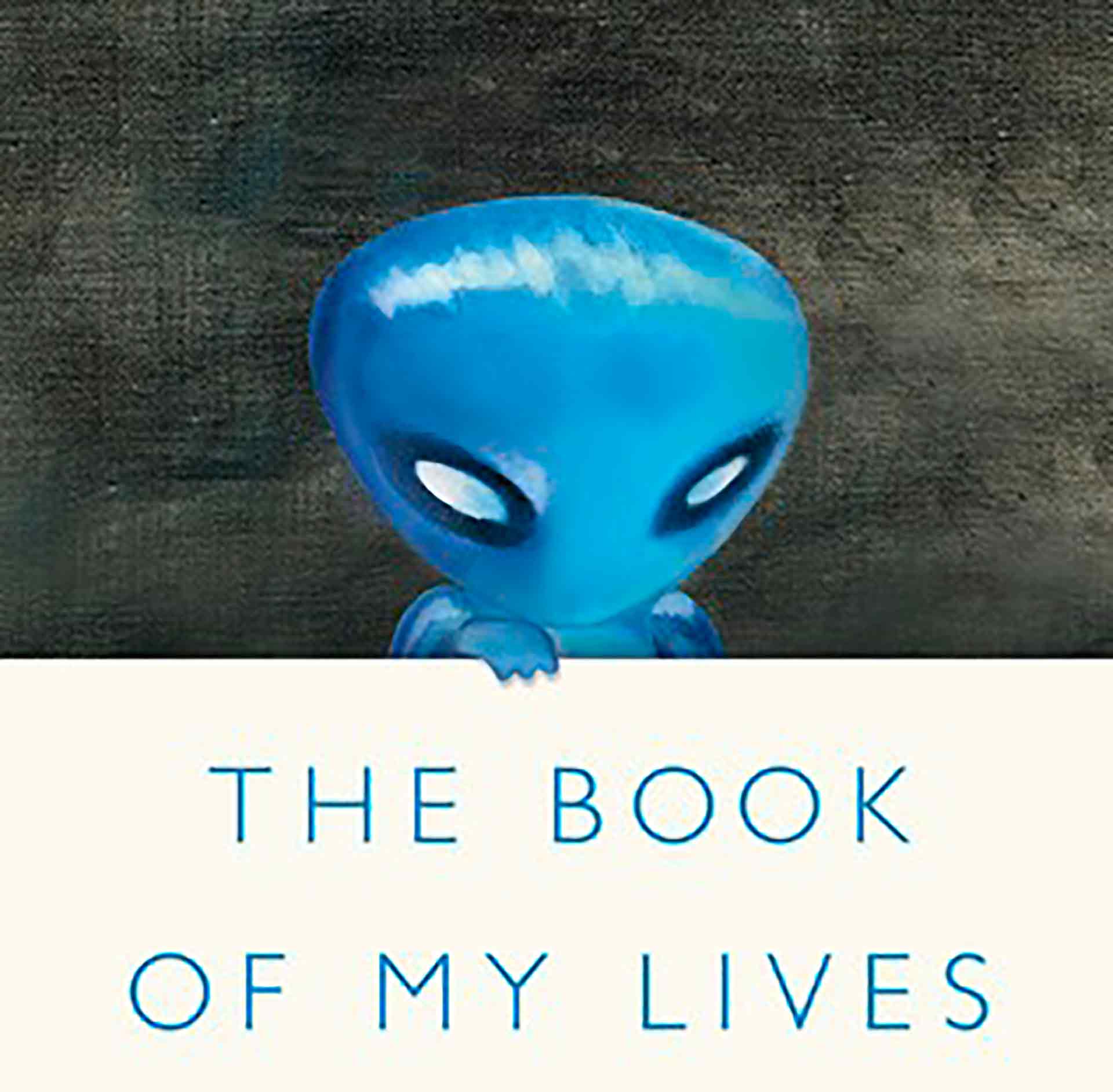
Keine einfache Partie, aber angenehm unbequem. Aleksandar Hemons Buch meiner Leben
Aleksandar Hemons erstes autobiografisches Werk ist eine spannende Partie. Eine, bei der nach dem Schlusspfiff die Halbzeitpause kommt und die auf mehreren Plätzen zugleich gespielt wird. In kurzen Episoden erzählt er von Fußball und Schach, Sarajevo und Chicago, Unbequemem und manchmal Unerträglichem – oder enttarnt ganz nebenbei die westliche Selbstgefälligkeit unter dem Deckmäntelchen multikultureller Öffnung.
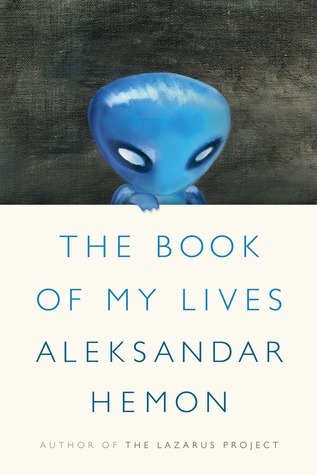
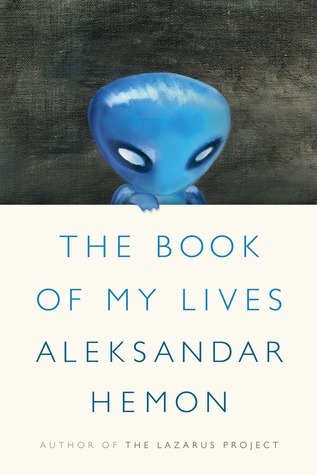
Von Hauptnebensachen in inneren städtischen Landschaften
Zwei Städte sind die Hauptaustragungsorte der Leben, die Hemon den Leser_innen in diesem Buch in kurzen Episoden zugänglich macht: Sarajevo, wo er, geboren 1964, aufwächst. Die Stadt, in der er Anfang der 1990er Jahre einen Krieg herannahen sehen wird, auch wenn er und seine Freund_innen sich mittels Drogen, Sex und exzessiven Parties in einen Zustand „hysterischen Vergessens“ zu versetzen versuchen, um ihn nicht sehen zu müssen. Und Chicago, die Stadt, in der er ab Anfang 1992 lebt, und die erst fünf Jahre später eine persönliche Geografie für ihn haben wird, als er nach seinem ersten Nachkriegsbesuch in Sarajevo realisiert: „Weite Teile von Chicago hatten sich in mir niedergelassen. Jetzt gehörten sie mir. Ich sah Chicago mit den Augen des Sarajevoers, beide Städte bildeten eine komplizierte innere Landschaft, in der Geschichten entstehen konnten.“
Einige Geschichten liegen nun neu verbunden, überarbeitet und erweitert im Buch meiner Leben vor. Über einen Zeitraum von dreizehn Jahren hinweg sind sie entstanden. Sie handeln von Nebensachen – manchmal, die vielleicht aber auch gar keine Nebensachen sind. Vom Fußball zum Beispiel, und mit ihm vom „wunderbare[n] Gefühl, mit etwas verbunden zu sein, das weit über mich hinauswies, ein Gefühl, das all jenen fremd ist, die meinen, im Fußball gehe es um Fitness und Entspannung.“ Vielleicht doch keine Nebensache also? „Ohne Fußball fühlte ich mich orientierungslos, seelisch und körperlich“ – und drei Jahre dauert es, bis Hemon nach seiner Ankunft in Chicago wieder Fußball zu spielen beginnt, obwohl er das zuvor in Sarajevo schon „seit Ewigkeiten“ getan hatte… Die Geschichten handeln auch von Hemon – vielleicht: „Zunächst ein paar Worte zu mir, obwohl es hier nicht um mich geht“, so steigt er in eine von ihnen ein. Wenn Hemon von sich erzählt, so tut er dies, ohne selbstdarstellerisch oder selbstgerecht zu werden. Eher attestiert er sich selbst im Rückblick eine „schmeichelhafte Form von Selbstmitleid (als ob es eine andere gäbe)“. Immer wieder handeln sie auch vom gesellschaftlichen Mainstream – und wenden sich insbesondere gegen jegliche Formen von Nationalismus und Rassismus.
Zum Glück schmerzhaft kompliziert
Auch für den gegenwärtigen gesellschaftlichen Kontext in Deutschland klingt Manches an Hemons Rückschau nur allzu erschreckend aktuell. Kaum etwas scheint sich verändert zu haben, seit Hemons flüchtende Eltern Anfang der 1990er in ihrer Zwischenstation Novi Sad Bekannten aus Bosnien Unterschlupf gewährten, „bis die Unglücklichen es nach Deutschland oder Frankreich oder in ein anderes Land schafften, wo sie nicht erwünscht waren und es nie sein würden.“ Klar benannte Zustände – für scheinheilige Multikulti-Toleranz-Rhetorik ist bei Hemon kein Platz. Kurzerhand skizziert er diese als Marketing-Trick und als neoliberale Fantasie, die auf der vermeintlichen Überlegenheit westlicher Demokratien beruht.


Unerträgliches ertragen
Andersherum betrachtet, sind Leben jedoch manchmal so glatt, dass Schlittern, Stürzen und Schreien unvermeidlich dazu gehören. Denn es gibt zum Beispiel Vojislav Šešelj, „der versprochen hatte, kroatische Augen mit rostigen Löffeln auszukratzen”, was Hemon trocken und das Grauen doch voll erfassend kommentiert mit: „Normale Löffel reichten ihm offenbar nicht.” Es gibt auch Professor Koljević, eben jenen Professor Hemons, der sich schließlich für Radovan Karadžićs Seite entscheidet, und es gibt die „heftige Abscheu gegenüber bürgerlichem Geschwafel“ und den „hilflosen Zorn“, die Hemons Schreiben seither durchziehen und die er nicht loswerden kann.
Und es gibt den Hirntumor von Hemons neun Monate alter Tochter Isabel, ihren Tod. Es nicht zu schaffen, darüber zu schreiben, so sagt Hemon in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, „hätte mich als jemanden entlarvt, der nur über Dinge schreibt, die nicht allzu ungemütlich sind. Dies stünde jedoch in einem vollkommenen Gegensatz zu meiner Überzeugung, dass die Literatur dazu da ist, all das zu thematisieren, was die menschliche Existenz schwer und mitunter unerträglich macht.” Er schreibt also darüber, auch wenn der Schmerz durch jede Zeile dringt. Verwehrt sich gegen Plattitüden. Fehlt es an Worten, wenn ein Baby einen Hirntumor hat? Nein, schreibt Hemon, im Gegenteil, es gibt zu viele Worte, zu schwer und zu spezifisch, um sie anderen überzustülpen, und deshalb leben seine Frau und er während der Krankheit ihres Kindes isoliert wie in einem Aquarium. Sind Leiden und Tod letztlich auch erhebende, erhellende Erfahrungen? Nein, schreibt Hemon, diese Erfahrungen waren für niemanden und nichts gut, absolut nicht, zurück ließen sie nur eine mit nichts zu füllende Leere. Das Buch meiner Leben ist Isabel gewidmet, „die für immer an meiner Brust atmet“ („forever breathing on my chest“) – so wie sie, so erinnert sich Hemon, auch kurz nach der Diagnose an seiner Brust atmete, damit ihren Vater beruhigte, sich um ihn, den viel Älteren, kümmerte. Schade, dass Matthias Fienbork, der das Buch ins Deutsche übertragen hat, diese Widmung lediglich mit „Für Isabel, unvergessen“ übersetzt hat – wie auch sonst so einige Nuancen von Hemons unaufdringlichem sprachlichen Geschick in der Übersetzung ins Deutsche leider verloren gegangen sind.
Trotz großen Schmerzes erdrückt das Buch seine Leser_innen nicht mit Schwere. Zu verdanken ist dies Hemons scharfen Beobachtungen, unverstellten Reflexionen und auch seinem Humor, einem Humor, mit dem er sich nicht gemütlich an die Oberfläche der Dinge zurückzieht. Mögliche Aktivitäten für die Zeit nach der Lektüre dieses Buches also: Vielleicht die gewohnten Publikumstribünen verlassen und sich Fußballpartien mal aus verschiedenen Blickwinkeln zugleich anschauen. Oder sich gleich an ganz neue Spielregeln heranwagen, z.B. bei einer Runde Bujrum-Schach, einer Variante, in der es darum geht, die gegnerische Seite möglichst schnell gewinnen zu lassen. Oder die Schachfiguren ins Stadion versetzen und während des Anpfiffs zum ersten Zug die Gleichzeitigkeit des Widersprüchlichen aushalten, vielleicht sogar genießen. Und darüber später etwas erzählen, etwas Vorläufiges, Unabgeschlossenes – denn Leben sind nun einmal nicht unkompliziert.
Hemon, Aleksandar: The Book of my Lives. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2013.
Hemon, Aleksandar: Das Buch meiner Leben. Aus dem Amerikanischen von Matthias Fienbork. München: Albrecht Knaus Verlag, 2013.
Weiterführende Links:
„Erst im Erzählen wird das Leben Wirklichkeit.“ Aleksandar Hemon im Gespräch. Interview in der Neuen Zürcher Zeitung vom 22.4.2014.
Weitere Literatur von Aleksandar Hemon:
The Question of Bruno. New York: Nan A. Talese, Doubleday, 2000. [dt.: Die Sache mit Bruno. München: Albrecht Knaus Verlag, 2000.]
Nowhere Man. New York: Nan A. Talese, Doubleday, 2002. [dt.: Nowhere Man. München: Albrecht Knaus Verlag, 2003.]
The Lazarus Project. New York: Riverhead Books, 2008. [dt.: Lazarus. München: Albrecht Knaus Verlag, 2009.]
Love and Obstacles. New York: Riverhead Books, 2008. [dt.: Liebe und Hindernisse. Stories. München: Albrecht Knaus Verlag, 2010.]
The Making of Zombie Wars. New York: Picador, 2015. [dt.: Zombie Wars. München: Albrecht Knaus Verlag, 2016.]


