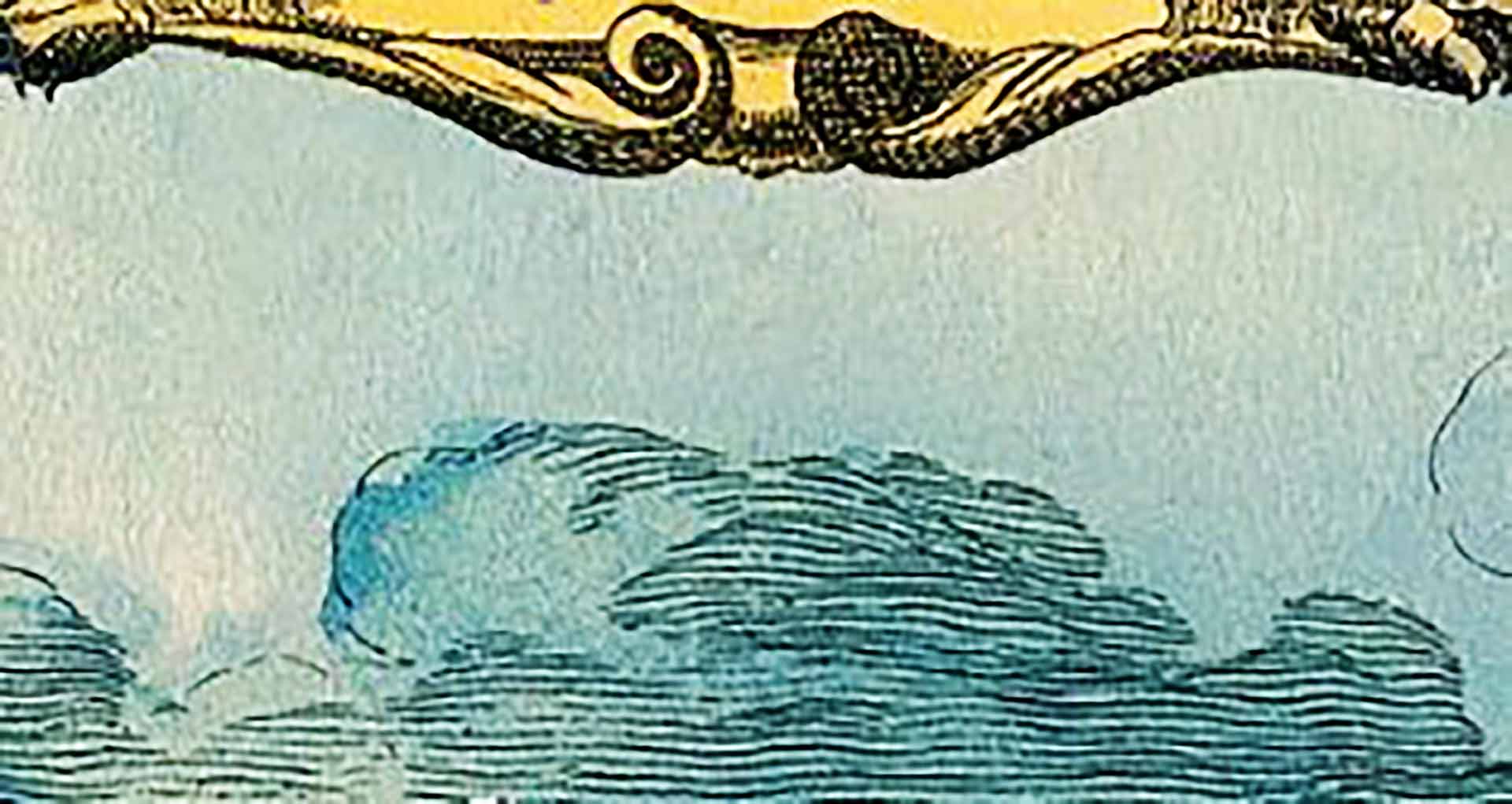
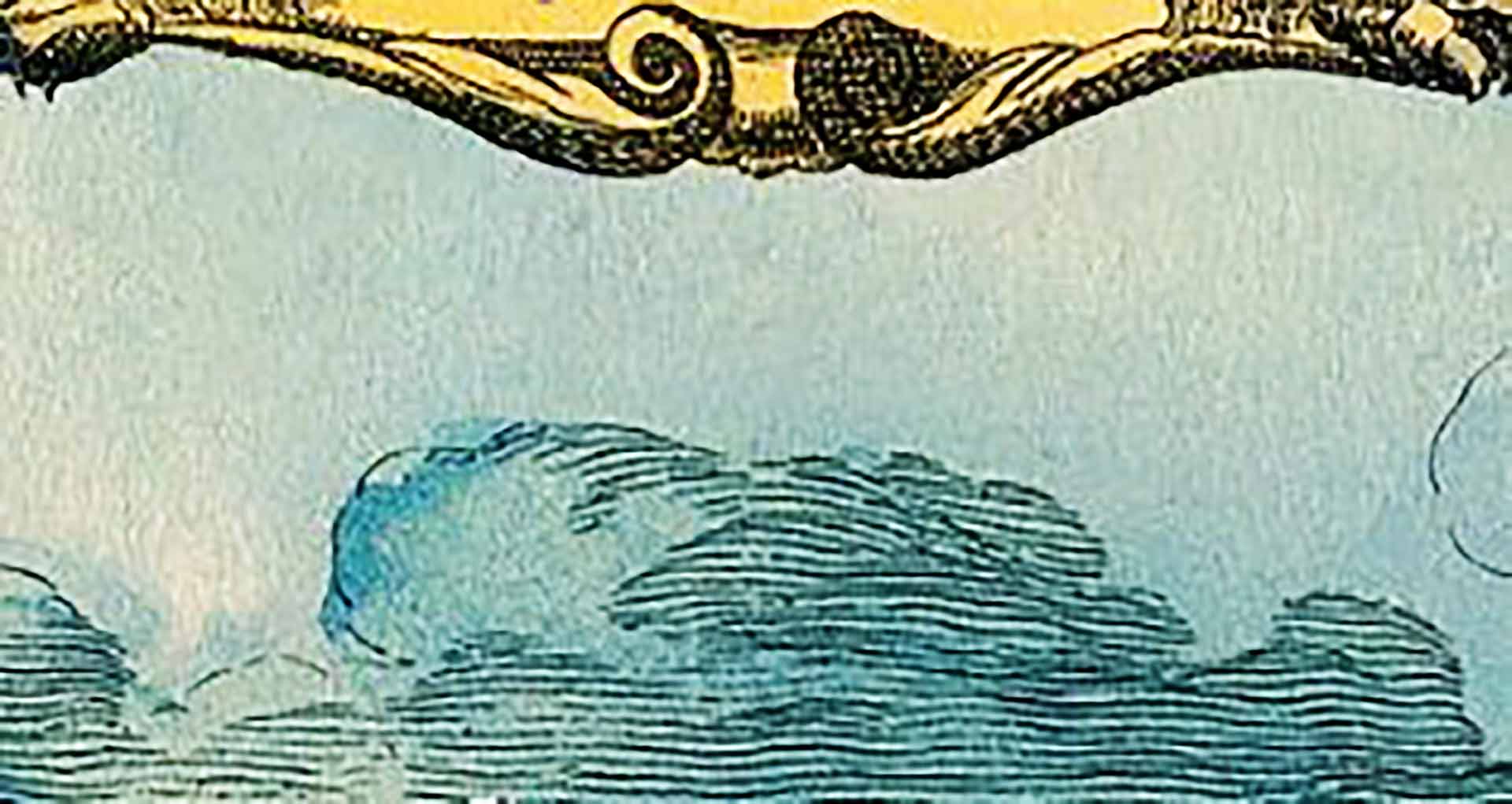
Leuchtender Solitär
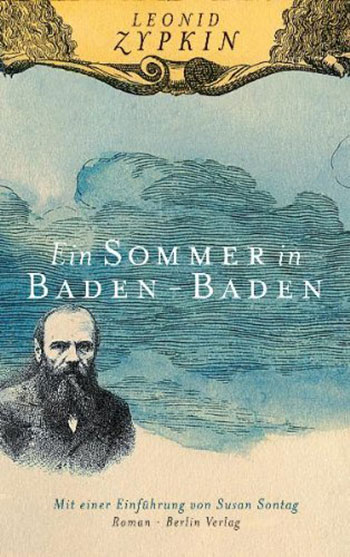
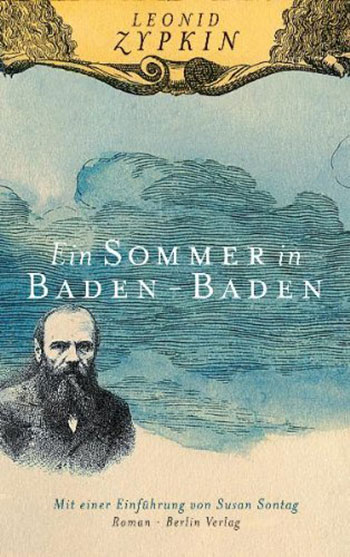
Jähzornig, eifersüchtig und besessen vom Roulette taumelt der große Schriftsteller mit seiner Anna in den finanziellen Abgrund, immer auf den großen Gewinn am Spieltisch hoffend.
Mit schier uferloser Detailfülle – dem Leseertrag eines ganzen Lebens – hat Cypkin ein Porträt dieses Schwierigen, wie viel Geliebten geschrieben, das völlig abseits aller Zirkel und Strömungen des Samizdat oder gar der offiziellen Literatur Sowjetrusslands entstanden ist.
Dieser einzige Roman des Mediziners Cypkin, den er 1980 knapp zwei Jahre vor seinem frühen Tod abgeschlossen hatte, und seine umwegige Reise zu den Lesern grenzen an ein Wunder. Mühsam hat er seinen stilistisch und thematisch so freien Text in langen Jahren niedergeschrieben, neben seiner Arbeit an einem virologischen Institut in Moskau, der beachtlichen Produktion wissenschaftlicher Aufsätze und ohne Hoffnung auf Veröffentlichung – als Jude, der offen über Dostoevskijs Antisemitismus nachdachte.
Gelungen ist ihm ein solitärer Vorläufer der Biofiction, anspielungs- und kenntnisreich, ein poetisches Gewebe, dessen Grundstoff, „der verblüffende Cypkinsatz“ (S. Sontag), nicht mehr an die Linearität alles Geschriebenen gebunden zu sein scheint.
Im Erzähler begegnet uns Cypkin selbst, der sich im Zug nach Petersburg sitzend in eine zerlesene Tauwetterausgabe des Tagebuches von Anna Grigor’evna vertieft – „herausgegeben in einem liberalen Verlag, wie sie zu der Zeit noch existierten“ – und sich wegzuträumen beginnt, denn im selben Satz befinden wir uns plötzlich bei den Dostoevskijs und ihrer ersten Reisestation in Wilna. Ein leidenschaftlicher Erzählstrom setzt ein, in einer Art zeitlosen Gegenwart wechseln sich die fixen Ideen und Zwangsvorstellungen von Fëdor Michajlovič mit Fantasien und Reflexionen des Erzählers ab oder werden von Annas nüchterner, aber mitleidender Sicht kontrapunktiert. Während sich Cypkin auf Wallfahrt zu authentischen Orten befindet – er erstellte im Lauf seines Lebens eine große Zahl an Fotografien von Originalschauplätzen aus den Romanen oder von Wohnorten Dostoevskijs, die er schließlich dem Dostoevskij-Museum überließ – reist das Paar durch ganz Deutschland, um überall nur von unverschämten und dummen Deutschen geplagt zu werden.
Entlang der Aufzeichnungen von Anna Grigor’evna richtet Cypkin sein Objektiv unbestechlich auf diesen dramatischen Beginn einer Ehe, die sich später zu einem äußerst glücklichen und produktiven Gespann entwickeln sollte. Immer begrenzt durch ein strenges Rollenverständnis, versteht sich, dass es ihr überließ sich um die täglichen Sorgen und Nöte, vor allem Geldnöte zu kümmern, während er ganz Großschriftsteller sein durfte.
Spürbar bleibt, wer die Kamera in der Hand hält, denn Cypkin spricht dazwischen und lichtet sich mit ab, wenn er wieder einen bissigen Kommentar über seinen traurigen Helden und dessen einfallslos-dümmlichen Judenhass fallen lässt. Im indiskreten Ehealbum gerät sich der Erzähler aber nicht nur selbst in den Blick, es tauchen auch andere Gestalten auf, die sich en passant von den Rändern in die Mitte drängen, Solženicyn etwa und seine epigonenhafte Rolle im neu-alten Konflikt zwischen Westlern und Slavophilen. Und immer wieder nahtlos Fantastisches auf Faktisches in diesen seitenlangen, sorgfältig arrangierten Sätzen: alltäglichste Streitereien zwischen Anna und Fedor erweitern sich plötzlich zur Figurenrede Dostevskij’scher Helden, dazwischen lediglich ein Bindestrich.
Um den Vordenker fremdenfeindlicher und nationalistischer Theoreme flicht der Holocaustentkommene keine weiteren Genie- und Wahnsinnsmythen, stattdessen ist sein Blick präzise und unverstellt auf die Wunden und Demütigungen gerichtet, die der einstmals beinah kritische Geist vom immer schon brutalen Machtarm aus Moskau empfangen hat.
„Es gab nur einen Ausweg: diese Erniedrigungen als verdient anzusehen.“ Und so ist Dostoevskij in eine Reihe gestellt mit zahllosen späteren Opfern des Gulagsystems in Sibirien, von denen mancher die Rute zu küssen begann und sich nicht selten schon während seiner Lagerhaft in einen Claqueur des Systems verwandelte, was es – zu einem schrecklichen Preis – ermöglichte, einen Weg zurück in die Sowjetgesellschaft zu finden, ohne für immer Paria zu sein oder schlichtweg wahnsinnig an der Willkür des Terrors zu werden.
Solch essayistische Explikation benötigt Cypkin allerdings selten, er setzt seine unheimliche Imaginationskraft ein, um die Traumata seines gequälten Dostoevskij zu bebildern: biedere Museumswärter, vor denen Dostoevskij in lächerlichster Weise den Unbeugsamen und Überlegenen zu demonstrieren versucht, verwandeln sich vor seinen Augen in den prügelnden Platzmajor aus der Lagerzeit, der ihn wieder und wieder in Abgründe der Scham stürzen lässt. Beim Spaziergang durch Baden-Baden sieht er sich von hämisch-überheblichen Literatenzirkeln umgeben, um sich – Erinnerung oder Wahnbild? – plötzlich selbst in ihrem Kreise als den verzweifelt um Anerkennung bettelnden, unwürdig um Turgenev herumschwänzelnden Parvenü zu sehen, dessentwegen sich alle vielsagende Blicke zuwerfen.
Mal opportunistisch, mal hysterisch – der große Nationaldichter mit heiliger christlicher Mission scheint seinen jüdischen Knallchargen allzu ähnlich – Ljamšin aus den Brüdern Karamasov etwa, oder dem lächerlichen, aber eingebildeten Bumštejn, in den Aufzeichnungen aus dem Totenhaus. Mit seinen Szenenmontagen bereitet Cypkin schließlich die eindeutige Parallelisierung vor: Der Wucherer Issaj Bumštejn starrt Dostoevskij aus dem Spiegel entgegen.
Nicht ganz originell vielleicht, aber bis dahin ist alles neu und tief. Die beschriebene Szene ist kurz und unauffällig in den Text integriert, denn nirgends stampft dieses Buch auf einfache, von Anfang an gewusste Antworten zu.
Rätselhaft ist Cypkin seine Liebe zu Dostoevskij, wie auch uns die tiefe Liebe Annas zu ihrem unberechenbaren Gatten, der selbst schon ohne Mittel, auch noch ihr Erbe verspielt. Dann kommt er auf Knien, küsst ihren Rocksaum: Du bist alles was ich habe, verzeih, verzeih, mein Engel, mein Alles. Die Auf und Abs, dann schon den freien Fall, nimmt sie gefasst als, nun ja, schmerzliche Unvermeidlichkeiten. Immer sieht sie in ihrem Gatten den unglücklichen Kranken, den guten Menschen, dessen Leben so freudlos und bitter verlaufen war. Trotz düster frömmelndem Blick, von Anna erhält Dostoevskij die Barmherzigkeit, die er so predigt (und von der er abhängt), und Cypkin würdigt sie darin. Er lässt die Liebe des Paares nicht erschöpft sein in Annas naiver Hingabe oder der Erotomanie Dostoevskijs.
Im Laufe des Buches schiebt sich dieses Thema vor den Basso Continuo der aggressiven Reizbarkeit Fëdor Michajlovičs, der in seiner Umwelt immer nur die feindliche erblickt. Zart verflochten mit Annas leidgeprüfter Haltung scheint auch die Cypkin’sche Verehrung etwas durchsichtiger zu werden.
Recht bald nach dem frühen Tod Cypkins, er starb 1982 an seinem 56. Geburtstag, eine Woche nachdem es ihm gelungen war, wenigstens einen Teil des Romans in einer russischen Exilzeitschrift in New York zu veröffentlichen, erschien sogar eine Übersetzung ins Deutsche beim Roitman Verlag. Die gut gemeinten, aber verstümmelnden Eingriffe in das Textgefüge, nahmen dem Büchlein des unbekannten Russen noch die letzte Chance auf Beachtung. Die absatzlangen Konstruktionen waren ohne Gespür für ihre stilistische Besonder- und Schönheit in standardlang(weilig)en, deutschen Sätze wiedergegeben worden. Erzählerrede wurde zur weiteren Orientierung kursiv abgesetzt. Ganze Absätze oder gar Seiten waren, aus heute wohl schwer nachvollziehbaren Gründen, gestrichen worden. Spekulationen Cypkins über die Neigung Dostoevskijs zu präpubertären Mädchen etwa, die er sich mit immer wiederkehrenden Lüstlingen bis hin zu Lustmördern in seinen Büchern aus dem Leib geschrieben haben könnte. Gerüchte darüber kursierten allerdings schon zu Lebzeiten Dostoevskijs. Ideologische Gegner hatten immer wieder verbreitet, dass der Autor so verkommen wie seine Sujets sei.
Wo Cypkin die Dostoevskijs wenig zimperlich über Polacken und Jidden schimpfen lässt, wird auch das – aus beschönigender Liebe zu Dostoevskij gar? – geglättet wiedergegeben. Die rahmende Fahrt des Erzählers nach Sankt Petersburg wird schlussendlich derart gekürzt, dass das ganze Buch aus dem Gleichgewicht kommt.
Dass jetzt eine deutsche Neuausgabe beim Berlin Verlag vorliegt, die von Alfred Frank sensibel aus dem Russischen übertragen wurde, ist noch Susan Sontag zu verdanken, deren Vorwort nun untrennbar zum Buch gehört. Selbst schon wieder so romanhaft, dass man es kaum glauben mag, fiel ihr Sommer in Baden-Baden in einem Flohmarkt auf der Londoner Charing Cross Road in die Hände. Sie entdeckte in ihm eines der „schönsten, anregendsten und originellsten Werke des vergangen Jahrhunderts“. Dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen.
Leonid Zypkin: Sommer in Baden-Baden. Mit einem Vorwort von Susan Sontag. Aus dem Russischen von Alfred Frank. Berlin Verlag. Berlin 2006.


