

The Importance of Being Shuty
Sławomir Shuty: Ruchy (Regungen)
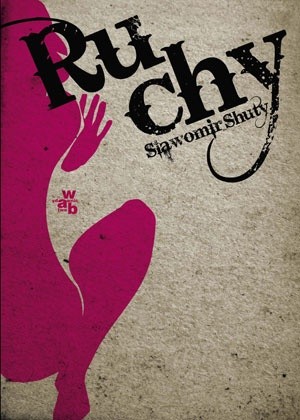
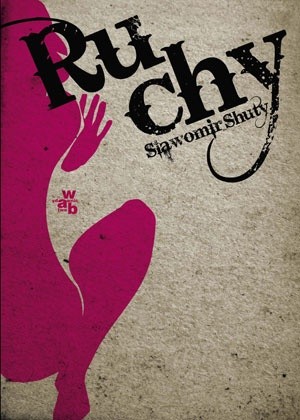
Recht monoton, mit einem urbanen Panorama, das man in Polen vielerorts zu sehen bekommt, beginnt der neue Roman des Schriftstellers Sławomir Shuty. Der Mann ist in Polen auch als Fotograf, Regisseur von Undergroundfilmen und Aktionskünstler in Erscheinung getreten. Hinter dem Pseudonym „Shuty“ verbirgt sich ein Hinweis auf seine Wurzeln: Er hat seine Kindheit als Sławomir Mateja in der sozialistischen Reißbrett-Stadt Nowa Huta verbracht, und die Selbstbeschreibung „z Huty“ – aus Huta – wurde zum Künstlernamen „Shuty“. Die Verortung der Handlung von Ruchy in einem ihm bekannten Umfeld ließe auf ein autobiografisch gefärbtes Buch schließen, so wie es bei seinem großen Erfolg, dem preisgekrönten Zwał (Halde, 2004), der Fall war. Doch weit gefehlt.
In Halde verarbeitete Shuty seine Erlebnisse als Angestellter einer Bank, dessen Leben sich abspielt zwischen dem Hamsterrad eines geradezu stachanowschen Leistungspensums und der Freizeit, die sich in Alkoholexzessen und im Konsum medialer Volksverdummung erschöpft. Der Roman wurde wegen seiner treffenden Beschreibung der Arbeitsumstände in der jungen polnischen Marktwirtschaft schnell zur Bibel der polnischen Antikonsumbewegung. Seine amüsant-groteske Sprache trat dabei in den Hintergrund. In seinem neuen Buch scheint Shuty sich für ein Allerweltsthema entschieden zu haben, um von seiner sprachlichen Brillanz nicht abzulenken. Die von postsozialistischer Verwahrlosung entstellte Stadttopografie mag im Hintergrund auf Biografisches verweisen. Vordergründig geht es um sprachlich exzessiv und stellenweise ekelerregend dargestellten Sex.


Die Handlung des anekdotenhaft erzählten Romans ist eher simpel: Gestrandete Existenzen haben eine heruntergekommene Diskothek zum Lebensmittelpunkt erwählt und geben sich dort regelmäßig einem Balzritual hin, wobei einige in die Jahre gekommene C‑Prominente dabei die Feder führen. Allerdings erweist sich die Hoffnung auf das Auffinden der vom Verlag im Klappentext versprochenen „verborgenen Ganzheit“ der Handlung als trügerisch. Die Figuren erschrecken durch ihre Plattheit, ihre Beschreibung geht oft über Nennung von Pseudonymen nicht hinaus. Ihr Sinn erschöpft sich in der Teilnahme an den „Regungen“ – was im Roman sowohl für das mechanisch und einstudiert ablaufende Anmachen im Lokal steht, als auch für den enthemmten, weil folgenlosen Sex. Da wären Ślęk, dem das ständige Onanieren dabei hilft, seinen Frust über Misserfolge bei den „Schnitten“ zu verarbeiten; Kacha, eine Nymphomanin, die mit nahezu jedem männlichen Wesen in der Nachbarschaft im Bett war („Mit allen möglichen Kerlen habe ich es gemacht und an allen möglichen Orten, hört mich an, dann erzähle ich euch alles, und spannend sind die Geschichten allemal.“); Bulsza und Lilka, ein im Umfeld der Tanzbude zusammengekommenes Paar, das an der Anziehungskraft des Rituals scheitert – um nur einige zu nennen. Wer mit wem, wann und unter welchen Begleitumständen – wer dafür kein Interesse aufbringen kann, lernt immerhin den Reichtum der polnischen Sprache in Hinblick auf den Beischlaf kennen.
Denn in dieser Hinsicht hat der Roman sehr viel zu bieten. Auch diesmal verwebt Shuty unterschiedliche, auf den ersten Blick nicht zusammenpassende Stile miteinander. Die Narration wie auch die Dialoge kleiden sich in eine vom Pathos überladene, gleichzeitig aber auch ironisch-naive Sprache. Als Leser fühlt man sich ständig zwischen romantischen Gedichten und der Poetizität öffentlicher Aborte hin- und hergerissen: „Eines Tages, ich war gerade heftigst auf Schnackseln aus, ging ich in der Hoffnung auf eine Runde Doktorspiele zu einer gut gebauten Verkäuferin, von der es heißt, sie gehöre zu denen, die den Teufel im Leib haben. (…) In ihrem Gesicht stand geschrieben: Ich will mich im Schlamm suhlen, das Alphaweibchen sein, ich will Pudding über meinen Körper… Nicht gleich was fürs Leben, aber einmal kurz einparken – wieso nicht?” Die Handlung interessiert in diesem reißenden Wortstrom nur am Rande, während das dem Slang polnischer Betonwüsten eigene Prinzip, mit besonders originellen und derben Sprachbildern zu punkten, an ihre Stelle tritt. Es ist spannend zu beobachten, wie viel schöpferische (oder eher destruktive?) Energie in manche Textstellen gepumpt wird. Soll man dahinter allein „das kranke Hirn des Autors“ vermuten, wie von manchen polnischen Rezensenten behauptet?
Nach einer Weile wird klar, dass Shuty nichts anderes macht, als den Mann von der Straße zu zitieren. Die angeführte Sprache dürfte einem Großteil der potenziellen Leser in Polen bekannt sein. „Ihm war danach zu wichsen, die Schlange zu würgen, mit der Palme zu wedeln, den Biber zu melken, den Dolch zu schärfen, zu keulen, zu jodeln, zu pellen, zu noggern“ – welchen Sinn sollen diese lexikonartig aufgezählten Fäkalwendungen sonst haben, außer den der Demonstration?
Doch man muss sich im Falle dieses Buches schon weit aus dem Fenster lehnen, um dem Autor gesellschaftskritische Absichten zuzugestehen. Gäbe es nicht den Erfolg von Halde und das daraus erwachsene Image, hätte man gar keine Grundlage für solche Annahmen. Das aktuell vorgelegte Werk hat überhaupt nichts zu erzählen, und wer etwas über den polnischen Fäkalwortschatz erfahren will, der braucht dafür kein Lexikon in Prosaform. Der Verlag W.A.B., in dem das Buch erschienen ist, hat sich in der Vermarktung denn auch vor allem auf die Person Shuty gestützt. Aber wie soll man die Entstehung eines solchen Unfalls wie Ruchy aus der Feder des Hoffnungsträgers Shuty nachvollziehen? Grundlage des Romans sind einige Kurzgeschichten, die offensichtlich in Eile zu einem Roman zusammengebastelt wurden. Unfertig wie er war, wurde der Text auf den Markt geworfen. Mit der Schande muss der Autor nun alleine klarkommen.
Shuty, Sławomir: Ruchy. Wydawnictwo W.A.B. Warszawa 2008.
Shuty, Sławomir: Zwał. Wydawnictwo W.A.B. Warszawa 2004.


