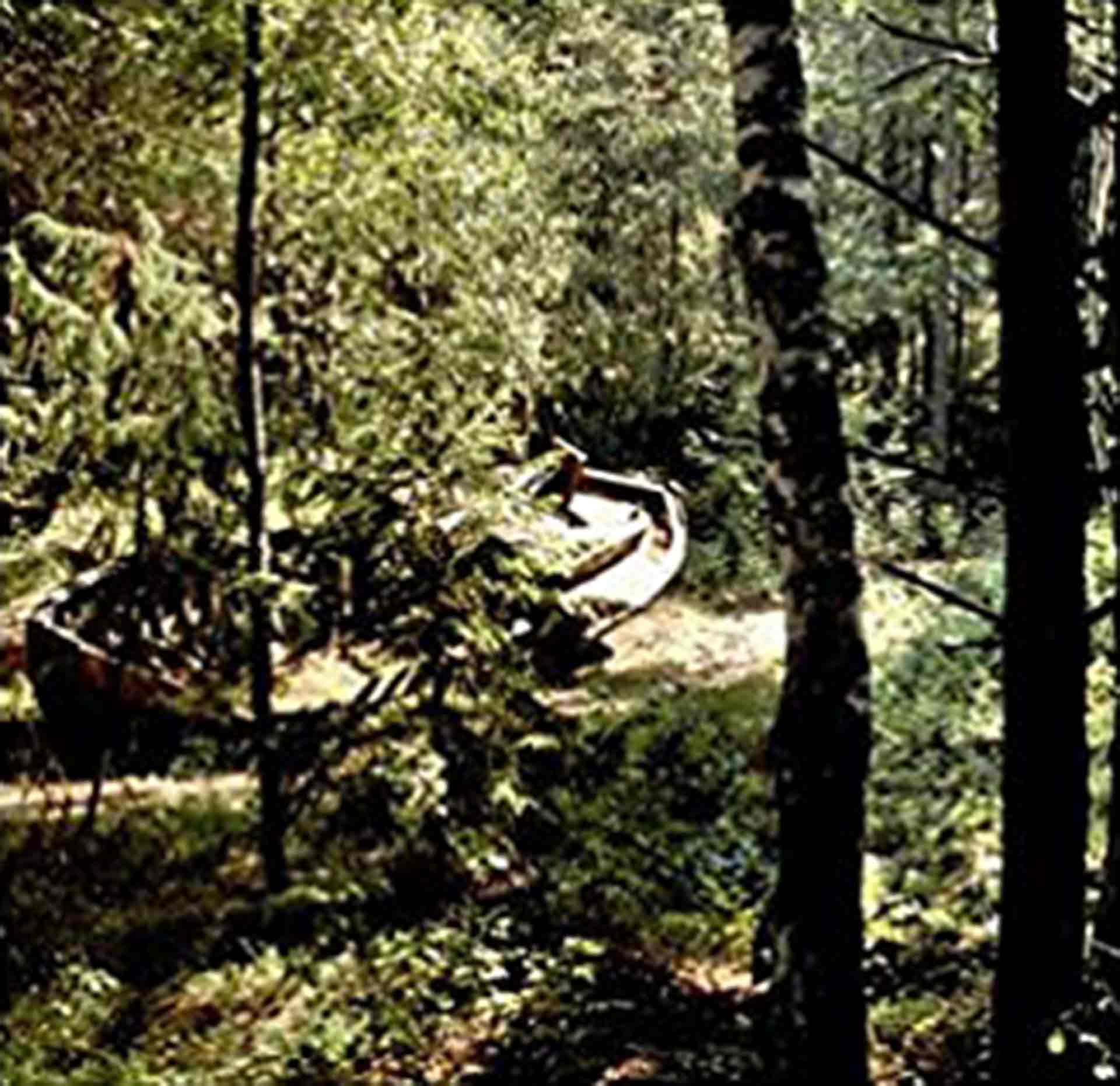
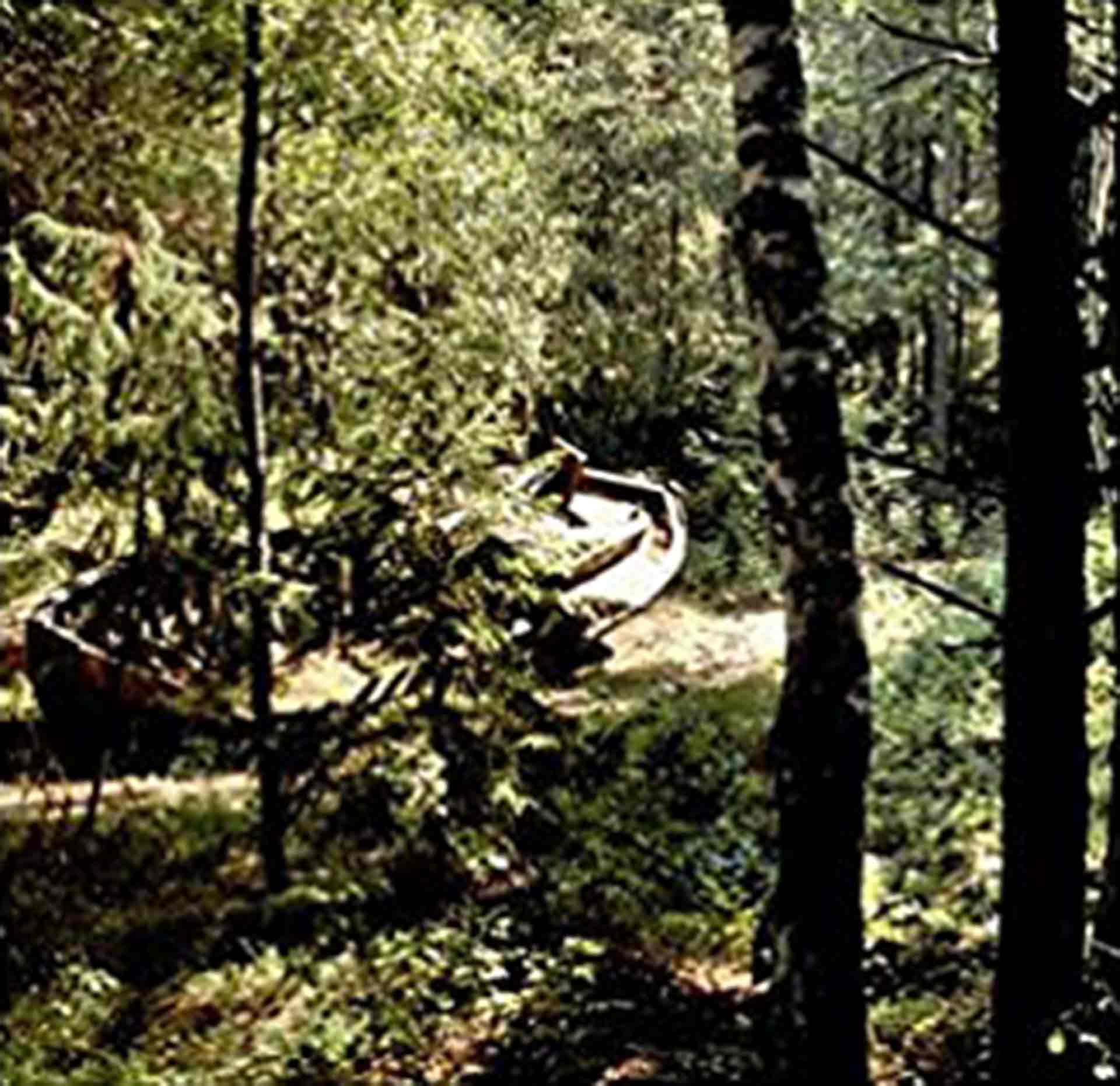
Ein Leben, ein Jahrhundert auf dem Silbertablett.
Arsenij Tarkovskijs Gedichte auf Russisch und Deutsch,gestern und heute
Meiner Unsterblichkeit mag ich mich nicht verwehren
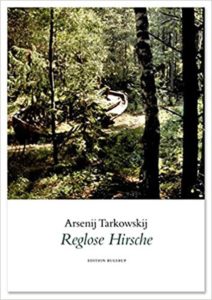
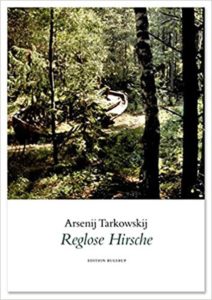
Schimmernde, trübe Vergessensflüsse, hetzender Regen, zerspringende Hagelkörner, treibende Nebel, tropfenschwerer Tau – alles fliesst in Arsenij A. Tarkovskijs [Tarkowskijs] Dichtung, so wie für ihn das Dasein als eine Flut der Poesie erscheint.Sich dieser Flut hinzugeben, lädt die Herausgeberin und Übersetzerin von Tarkovskijs Gedichten, Martina Jakobson, ein. Aus den politischen und kulturellen Wirrungen Russlands letzter Dekaden holt sie die fast in Vergessenheit geratenen Texte hervor und präsentiert sie dem Leser auf dem Silbertablett: in einem schlicht daher kommenden, zweisprachigen Gedichtband, das russische Original neben der deutschen Übersetzung. Es handelt sich um ausgewählte Lyrik, die ein ganzes Leben durch die Schatten eines Tod bringenden Jahrhunderts wieder aufleuchten lässt.
Der Lyriker und Übersetzer Arsenij Tarkovskij, 1907 in Elizavetgrad (heute Kirovohrad in der Ukraine) geboren, überlebt die Schrecken der Oktoberrevolution, zweier Weltkriege, stalinistischen Terrors, eine schwere Kriegsverletzung, bei der er ein Bein verliert, Hunger und Not der Nachkriegszeit in der Sowjetunion. Zu treuen Gefährten der physischen Entbehrungen gesellen sich Einsamkeit und Verachtung – ihnen bleibt ein anders denkender Idealist in einem totalitären, auf Zukunftsverheissungen und kollektiven Aufbruch fixierten System, unweigerlich ausgeliefert.
Schon nach den ersten Gedichtpublikationen, die ihm Anfang der 1930er Jahre den Vorwurf des Mystizismus einbringen, ist der Dichter angesichts der um sich greifenden stalinistischen Repressionen zum Schweigen verurteilt. Zumindest für die Öffentlichkeit. Ein Glück, dass Arsenij Tarkovskij nicht gänzlich verstummt, sondern im Stillen, zurückgezogen in einem Dorf, seine Gedichte weiter flüstert. Was Tarkovskij in der Ausgrenzung und Isolation zu dichten antreibt, ist sein Glaube an die conditio humana, den Menschen und seine Verortung in der irdischen Existenz, der Kultur, der Metaphysik.
Wer sich heute dem Sog der hektischen Multitasking-Welt entreisst und auf Tarkovskijs Poesie einlässt, erfährt unverhofft eine Entschleunigung und innere Einkehr, die den unsteten Blick für die alltäglichen Tiefen des Lebens schärft und auf leise Art zu berauschen weiss. Diese Verse wollen mehrmals gelesen werden. Man möchte die zwischen den Zeilen verborgenen, subtil angedeuteten Zusammenhänge fassen, die universellen Geschehnisse hinter den „grollenden Gewittern“ begreifen, mit dem lyrischen Ich zusammen nach dem Sinn des Lebens suchen und mit der Natur verschmelzen, die all den von Menschen verursachten Katastrophen unerschütterlich trotzt.
Martina Jakobson transportiert diese Intensität ins Deutsche, sodass man auch bei der Übersetzung länger verweilen und sich in immer tiefere Sphären vortasten möchte:
„Земля сама себя глотает,
И, тычась в небо головой,
Провалы памяти латает
То человеком, то травой.“
„Wo die Erde sich selbst ein Schlund ist,
ein Jungtier, am Himmel aufschürft den Kopf,
da hat sie ihre Gedächtnismulden, gleich Wunden,
mit Gras oder Menschen zugestopft.“
Der zweisprachige Band zeigt, wie unentbehrlich es ist, das Original und die Nachdichtung parallel lesen zu können – gemeinsam ergeben sie eine neue sinnlich-formale Einheit. Daher ist das Buch ohne Einschränkungen allen zu empfehlen, die gleichermassen Deutsch und Russisch lesen. Allerdings ist es fraglich, ob die Übersetzung für sich genommen der lyrischen Eigenart des Ausgangstextes gänzlich gerecht wird, wirkt sie doch zuweilen weniger zart und setzt ihre eigenen, überraschend interpretierenden Akzente.
Die Leistung der Übersetzerin und Herausgeberin bleibt enorm, beraubte doch das unausgesprochene Publikationsverbot von Tarkovskijs Texten eine ganze Generation dieser Lyrik, erst recht die deutschsprachige Leserschaft, die erst seit Ende der 1980er Jahre die Möglichkeit hat, diesen Dichter ansatzweise kennenzulernen. 1962 veröffentlicht Arsenij Tarkovskij einen weiteren Lyrikband. Bis dahin lebt er vom Übersetzen arabischer, armenischer und turkmenischer Lyrik. Der orientalische Einfluss macht sich unter anderem in der Beschreibung der Steppen- und Kurganlandschaften bemerkbar.
Arsenij Tarkovskij verlässt sehr früh seine erste Frau Marija Višnjakova für eine andere. Sein Sohn aus der ersten Ehe, der Kultregisseur Andrej Tarkovskij, leidet zeitlebens unter dem Verlust des Vaters und lässt sich dennoch – oder gerade deswegen – von der Ästhetik seiner Lyrik stark inspirieren. Die Heraufbeschwörung des künstlerischen Schöpfertums, das die Vergänglichkeit und die menschlichen Verwerfungen zu überdauern vermag, trägt dem Dichter innerhalb seiner auseinandergebrochenen Familie ihre Früchte: In den 1970ern verleiht Andrej Tarkovskij den stillen Versen seines Vaters eine deutliche Stimme und lässt ihn seine jahrzehntelang ungelesenen Gedichte wie Leben, Leben und Eurydike im Film Der Spiegel (Zerkalo, 1974) vor einem Massenpublikum vortragen. In dieser Verewigung der Stimme des Vaters über politische und familiäre Brüche hinweg scheint die Quintessenz von Tarkovskijs Lyrik ihre Erfüllung gefunden zu haben: die Würde und Selbstbehauptung eines Einzelnen vor dem Hintergrund einer Epoche der Willkür und der Gewalt.
„Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,
Жизнь – чудо из чудес, и на колени чуду
Один, как сирота, я сам себя кладу…“
„Ungezählt ist meine Zahl: Ich lebe, bin und werde.
Wunder und Geheimnis – Wandel des Lebens;
in seiner Hand mein einsames Ich, dies verwaiste Kind…“
Als melancholischer und erinnernder Dichter ist Arsenij Tarkovskij in einer Reihe mit seinen engen Freundinnen Anna Achmatova und Marina Cvetaeva zu sehen und zu entdecken. Seine Widmungen an diese Dichterinnen sind Zeugnisse kultureller Erinnerung im sogenannten „monologischen Dialog“ – einer Kommunikationsform, die unter damaligen politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen gepflegt worden ist und die von Arsenij Tarkovskij in seinen Gedichten auf besondere Art stilisiert wird.
Neben Widmungen und Erinnerungen an Menschen und Orte sowie irdischer Naturverbundenheit durchquert diese Zeit- und Raumachsen noch eine dritte Dimension, in der sich der Mensch bewegt: die der Technik. Gedichte wie Das Ende der Navigation reflektieren den menschlichen Ehrgeiz, das Universum durch den technischen Fortschritt zu bezwingen und die Grenzen, an welche die menschliche Existenz dabei zwangsläufig stösst:
„И если впрямь земля болеет нами,
То стала выздоравливать она –
Такие звезды блещут над снегами,
Такая наступила тишина.“
„Die duldsame Erde hält den rauen
Atem an, zumindest scheint
es so – dies Sternenflimmern über der Landschaft,
Stille kehrt jetzt ein.“
Diese Zeilen wurden vor vier Jahren in dem Dokumentarfilm Space Tourists (2009, Regie: Christian Frei) zitiert. Tarkovskijs poetisches Wort aus dem letzten Jahrtausend kommentiert den aufkommenden Weltraumtourismus sowie den Preis individueller Träume von gestern und von heute. Vielleicht ist es diese Aktualität, welche Martina Jakobson hin und wieder zu einer postmodern anmutenden Übertragung verleitet. Dies ist jedoch angesichts der zeitlosen Themen und der klaren Sprache Tarkovskijs nicht notwendig. Notwendig hingegen bleibt die Weiterentdeckung seiner Poesie.
Tarkowskij, Arsenij: Reglose Hirsche. Ausgewählte Gedichte. Herausgegeben und übersetzt von Martina Jakobson. Berlin / Hörby: Edition Rugerup, 2013.


