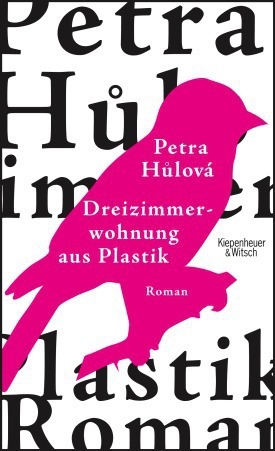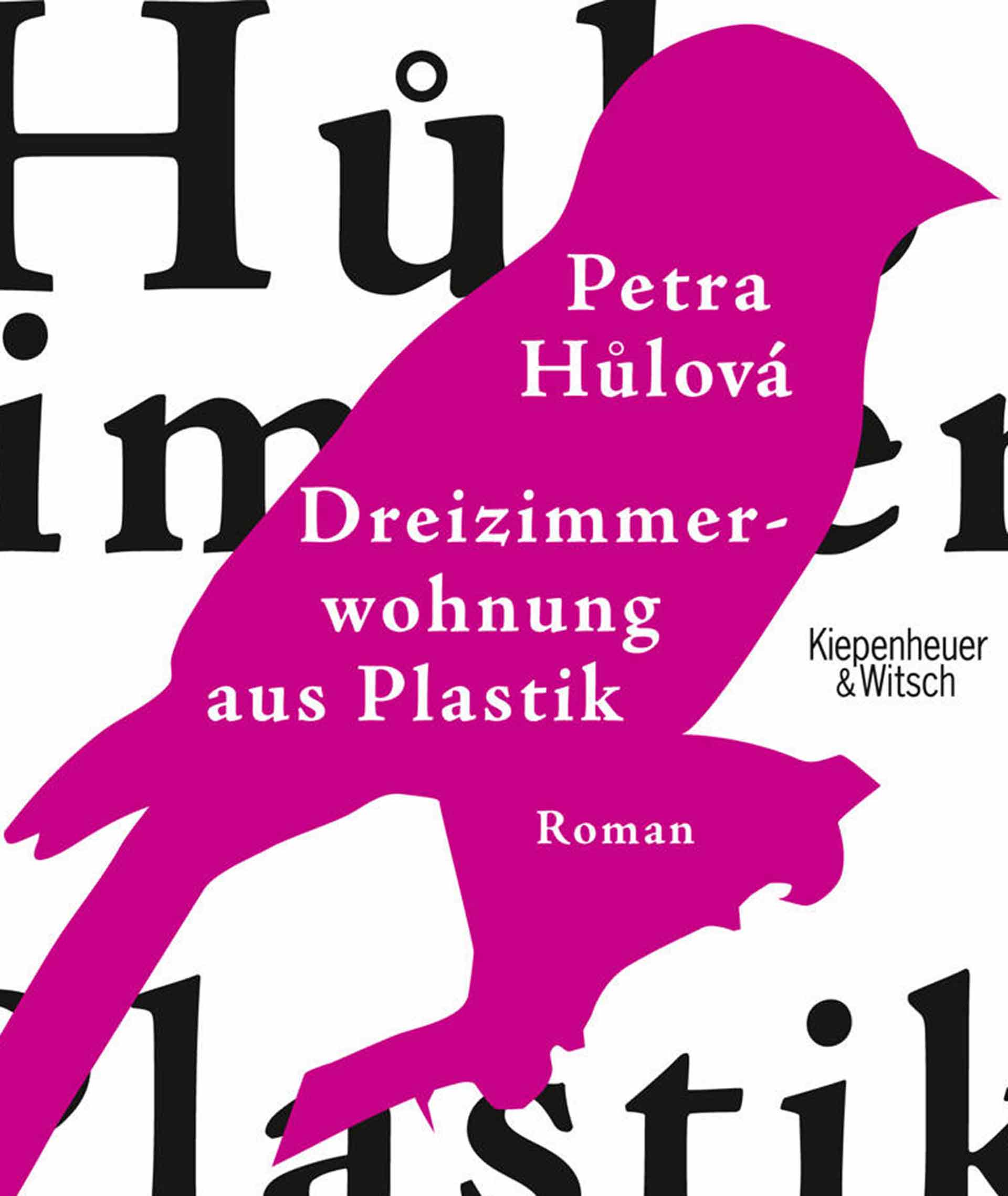
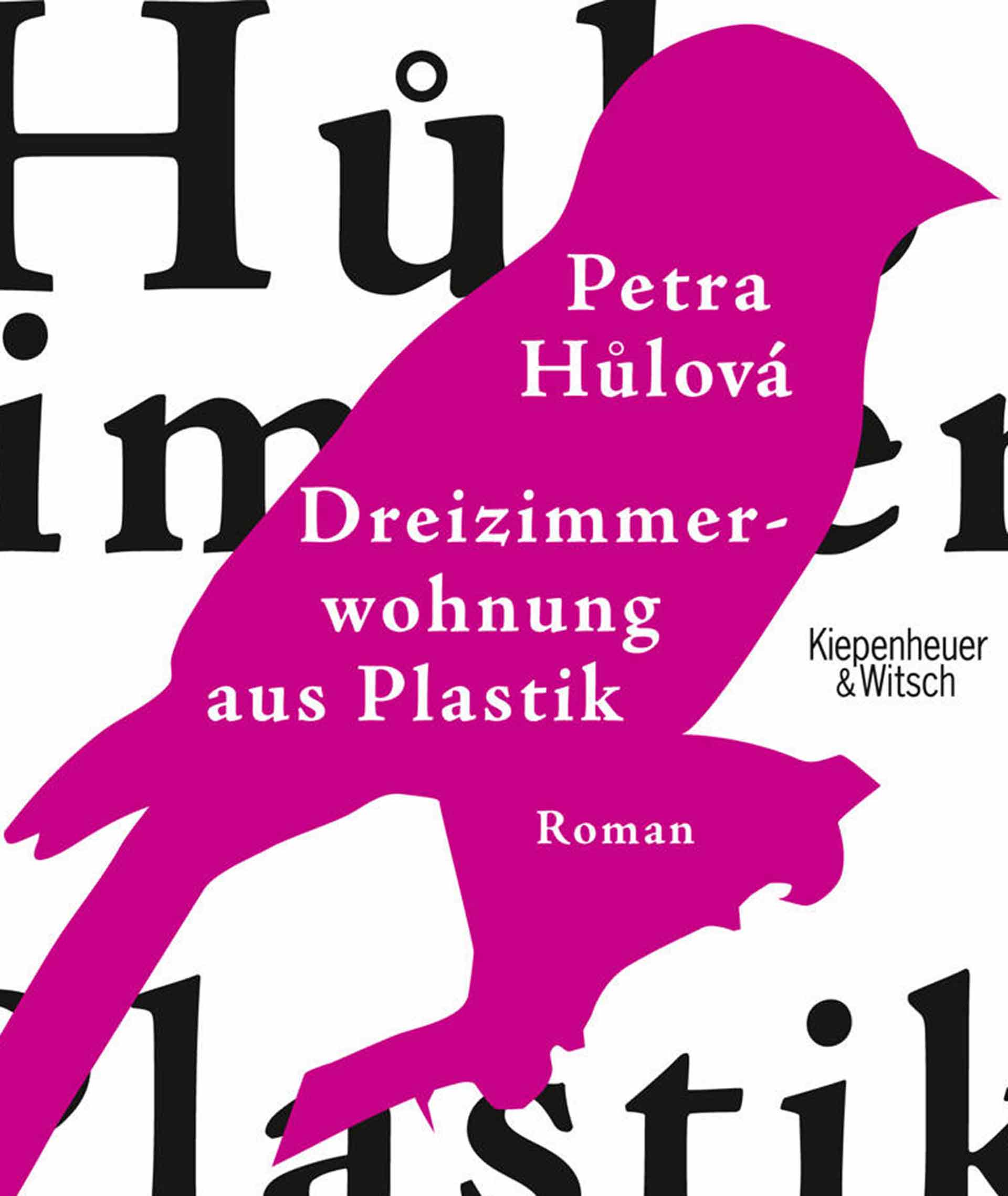
Das Erzählen als Lust, Provokation, Klage
In ihrem Roman „Dreizimmerwohnung aus Plastik“ („Umělohmotný Trípokoj“) taucht Petra Hůlová in die Welt einer modernen Prostituierten in Prag ein. Die Lektüre verspricht den Genuss sprachlicher Genialität und zugleich Schamesröte im Gesicht: Hůlovás Erzählerin bringt tiefste Intimitäten zur Sprache – und lässt kein gutes Haar am bürgerlichen Leben.
Es ist empfehlenswert, sich vor dem Lesen dieses Romans sorgfältig zu überlegen, ob man genug Atem für die Erzählung hat. Denn man kommt beim Lesen kaum zum Luftholen: Die Autorin hat ihr Buch in einem Rausch in sieben Tagen durchgeschrieben und auch die Erzählerin unterbricht ihren Strom von Geschichten, Phantasien und mitleidlosen Kommentaren nur mit kleinen Pausen zwischen den Kapiteln.
Die tschechische Schriftstellerin Petra Hůlová, von der bis heute sieben Bücher erschienen sind, gab diesen Roman schon 2006 heraus und wurde für ihn mit dem Jiří Orten-Preis ausgezeichnet. Wie sie in einem Gespräch gestand, liest sie aus diesem Roman nur selten in der Öffentlichkeit vor. Sie sei eine introvertierte Person und schäme sich. Da es sich um die Erzählung einer Prostituierten handelt, die in ihrer Dreizimmerwohnung Wünsche ihrer Kunden erfüllt, ist dieses Geständnis nicht überraschend. Auch beim Lesen schämt man sich mit und fühlt sich bei der Lektüre wie ein Kunde: etwas nervös wegen dieses außergewöhnlichen Ortes und seiner außergewöhnlichen Bewohnerin und gleichzeitig aufgeregt in Erwartung einer noch aufregenderen Fortsetzung, die ihren Höhepunkt in einer Pointe erreichen soll. Und auch der Leser bezahlt im Voraus.
Doch macht die Erzählerin einen Unterschied zwischen uns und den Kunden. Während sie sich in ihrer „kohlebringenden Zunft“ immer weiter verbessern möchte und sich deswegen überlegt, „wie man‘s dem Kunden nach Zuschnitt von ‘nem ganz und gar individuellen Plan am besten auf den Leib schneidern könnte“, benimmt sie sich dem Leser gegenüber viel böswilliger. Wenn sie in ihren „Schnickschnack, an den sie außerhalb der Arbeitszeit denkt“, und den sie uns erzählt, eine spannende Geschichte einfügt, zum Beispiel, was in einem Archiv der Abteilung vom Institut für orientalische Sprachen an der Akademie der Wissenschaften zwischen einer Archivarin, einer Frau im Regal und einem Mann passieren könnte, dann unterbricht sie den Leser mit dem schneller werdenden Atem mit einer zynischen und eiskalten Pointe. Sie arbeitet professionell: Nie sagt sie alles auf einmal und hinter der scheinbar zusammenhanglosen Wortäquilibristik verheimlicht sie die eigentliche Handlung, um uns bis zum Ende in Spannung zu halten.
Petra Hůlová debütierte 2002 mit einem Roman über Frauen einer mongolischen Familie, die ihr Leben zwischen Steppe und Stadt einrichten müssen und in beiden Sphären Fremde werden und bleiben. Hůlová selbst studierte an der Prager Karlsuniversität Mongolistik und Kulturwissenschaft und aus ihrem Studienaufenthalt in der Mongolei hat sie das Material für ihren ersten Roman geschöpft. Dieser Roman, Paměť mojí babičce(auf Deutsch unter dem Titel Kurzer Abriss meines Lebens in der mongolischen Steppe erschienen), wurde 2003 als Entdeckung des Jahres mit dem Preis Magnesia Litera ausgezeichnet. Auch Hůlovás weitere Romane (u. a. Cirkus Les Mémoires, dt. Manches wird geschehen, oder Stanice Tajga, dt. Endstation Taiga)spielen in der Fremde, der erste in New York, der zweite in der sibirischen Taiga. Mal ist es eine tschechische Fotografin und ein aus dem Nahen Osten kommender Artist, die sich auf einer Parkbank in New York begegnen, mal ein dänischer Forscher, der beim Drehen eines Dokumentarfilms in der sibirischen Eiswüste verschwindet und sechzig Jahre später von einem Anthropologie-Studenten selbst zum Forschungsobjekt erklärt wird. Während es Hůlová in diesen Romanen die Ferne, die Fremde und das Leben in anderen und zwischen den Kulturen angetan haben, lässt sie Dreizimmerwohnung aus Plastik in Prag spielen und taucht dabei in eine fremde Welt ganz anderer Art ein, in die Welt einer modernen Prostituierten.
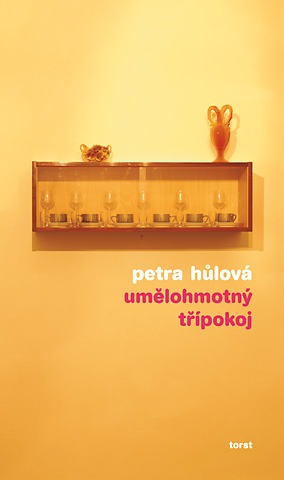
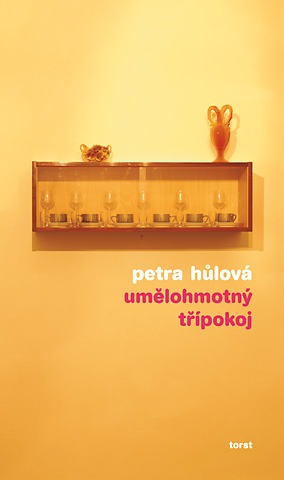
Das Tschechische ist für die innovative Umgangssprache, die ironischen Deminutive oder Slangabkürzungen ein ideales plastisches Material, und die Arbeit der Übersetzerin Doris Kouba verdient unsere Bewunderung. Eine wichtige Sache geht trotzdem im Deutschen verloren: Die Begriffe, mit denen die Erzählerin die Geschlechtsorgane benennt, verfügen in der Originalsprache über das der Geschlechtzugehörigkeit ihrer Besitzer gegensätzliche grammatische Genus. Dieses Wortspiel verdeutlicht die unnatürliche Beziehung zwischen dem Menschen und seiner Lustquelle und wird zu einer genialen Metapher, die uns daran erinnert, dass wir oft bei der Befriedigung der eigenen oder abgeguckten Sehnsüchte unsere Einheit und Authentizität vergessen. Wie die Erzählerin sagt: „der Kopf, das bin nicht ich, genauso wenig, wie ich das Reinstecksel bin.“
Dieser Text packt und fesselt mit seinen langen, dichten Sätzen voller phantastischer Bilder und Assoziationen, überrascht mit Alltäglichkeit in den unalltäglichsten Situationen und verstört mit seinen schmerzhaft genauen Kommentaren. Manchmal langweilt er auch, um jedoch anschließend mitleidlos aufzurütteln. Petra Hůlová hat ein listiges Buch geschrieben: Je mehr wir ihre sprachliche Genialität genießen, desto schmerzhafter ist es, wenn unsere sorgfältig versteckte Schwäche, tief vergessene Peinlichkeiten und die intimsten Geheimnisse nicht nur direkt ausgesprochen werden, sondern als bloßes Material für die Erzählung missbraucht werden, die wir nicht aufhören können weiterzulesen.
Hůlová, Petra: Dreizimmerwohnung aus Plastik. Aus dem Tschechischen von Doris Kouba. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2013.
Hůlová, Petra: Umělohmotný Trípokoj. Praha: Torst, 2006.