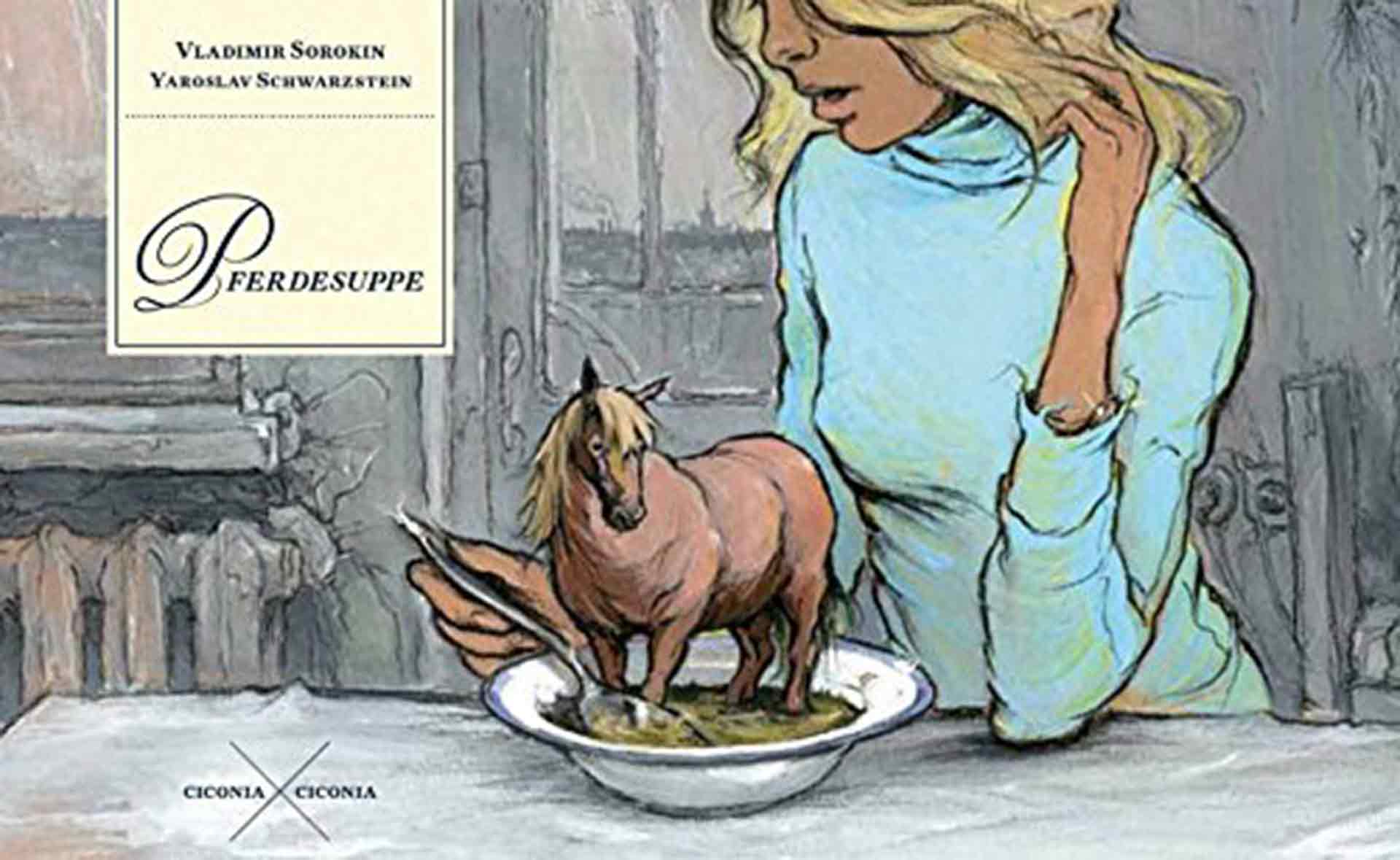
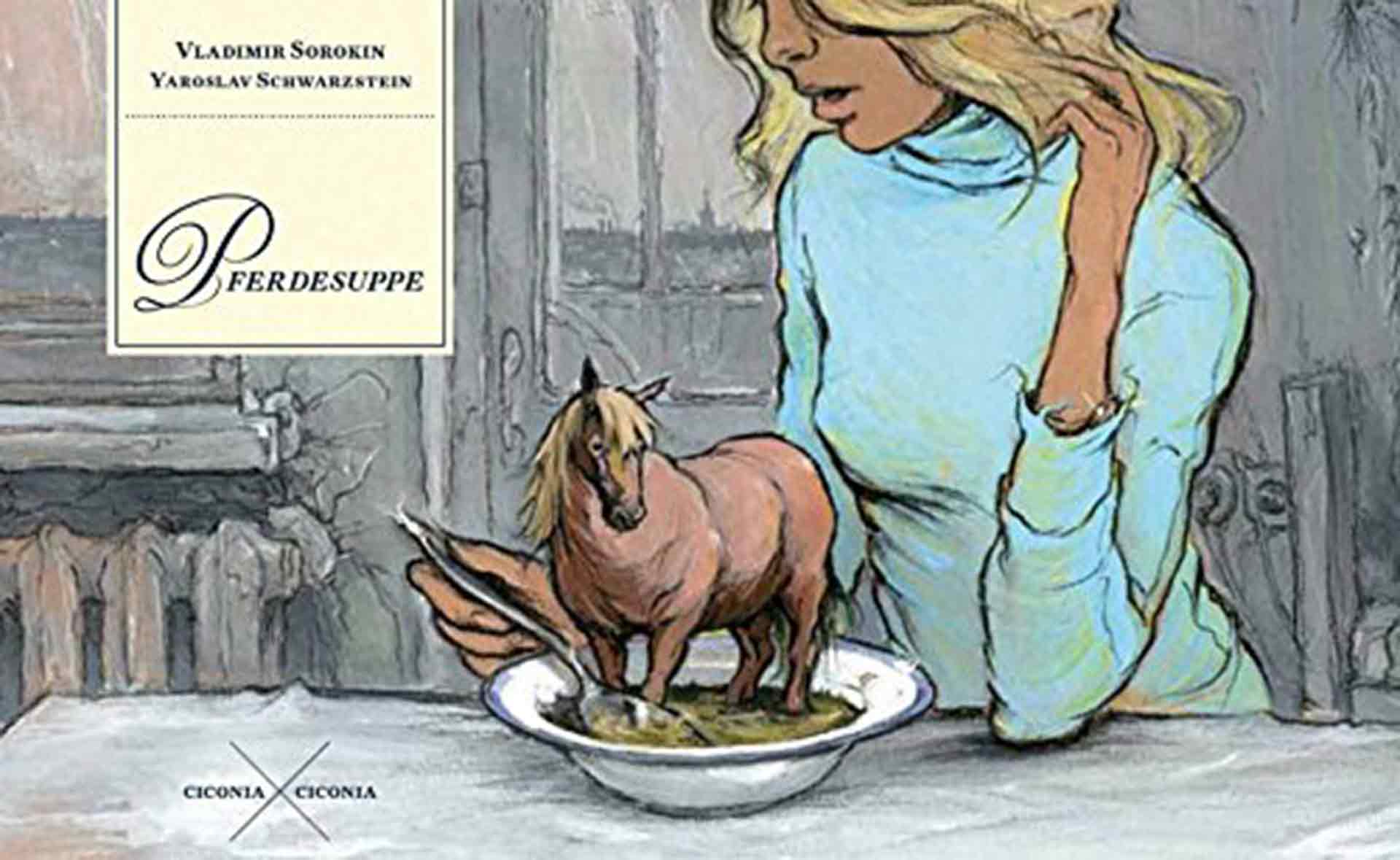
Der Mensch ist, wie er isst
Menschliche Essgewohnheiten spielen in Vladimir Sorokins neuem Werk eine Schlüsselrolle. Das sprengt in erfrischendem Maße die Grenzen des guten Geschmacks. Offenbar basiert „Pferdesuppe“ auf einem besseren Rezept als Pferde-Lasagne.
Boris Il´ič Burmistrov [Boris Iljitsch Burmistow] hat den Appetit verloren. Seit seiner Entlassung aus einem Straflager im kasachischen Niemandsland, wo der politische Häftling sieben Jahre am Stück, tagein tagaus, Pferdefleisch in sich hinein schaufeln musste, um zu überleben, scheint er sonderbare Ernährungsgewohnheiten entwickelt zu haben. Als er und Olja in einem Nachtzug der Route Moskau-Simferopol aufeinandertreffen, weiß er es sofort: Beider Schicksale werden von nun an eines sein. Wir schreiben das Jahr 1980. Die Weichen der Geschichte sind gestellt, die Sowjetunion steuert in das letzte Jahrzehnt ihrer Existenz. Olja und ihre Freunde sind verstört von der Erscheinung des „unscheinbar, alterslos“ wirkenden Mannes, der sich ihnen am Tisch des Zugrestaurants aufdrängt und nicht abschütteln lässt. Nicht bevor er Olja ein Versprechen abgenommen hat.
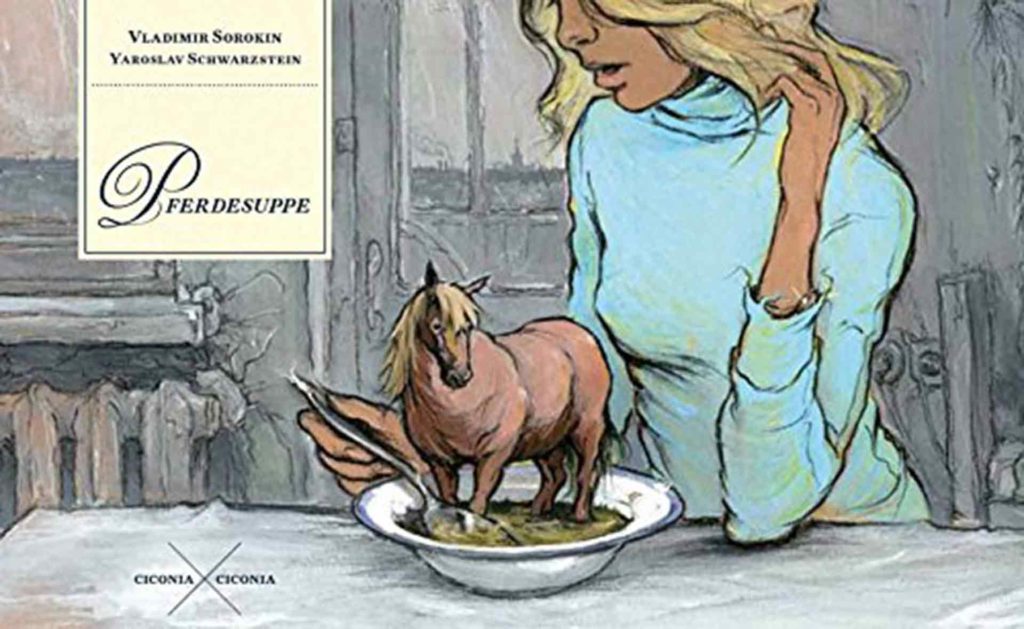
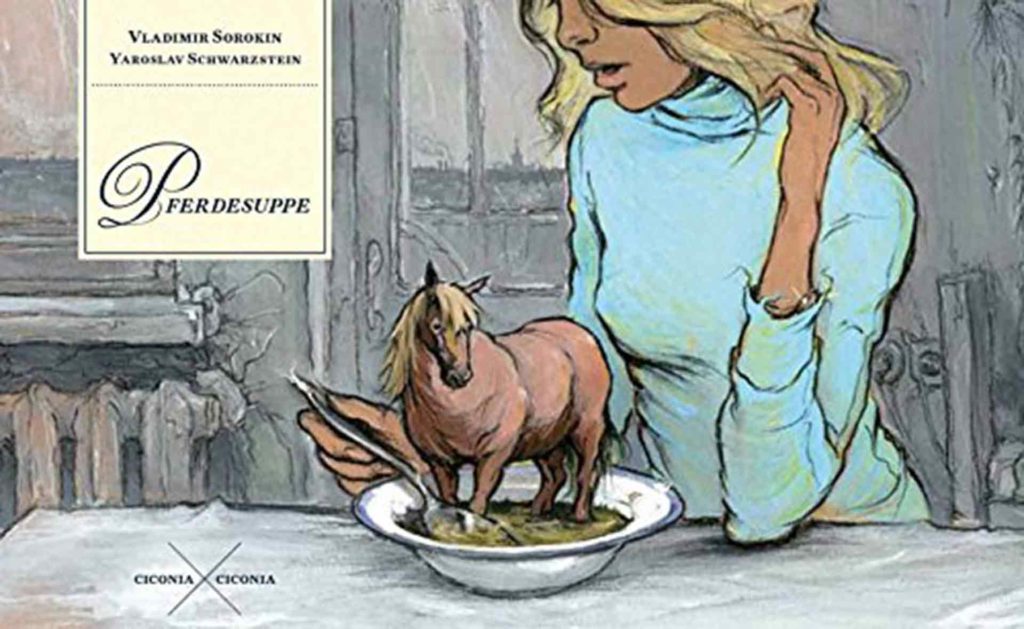
Wie Menschen essen, das wird in Pferdesuppe, Vladimir Sorokins neuem – ja, was denn eigentlich? Roman, Novelle, Graphic Novel? – unter dem Mikroskop beobachtet. Minutiös beschreibt er die Mahlzeiten seiner Helden. Diese Nahaufnahmen fördern Düsteres zu Tage: Auf den Tellern wartet der Tod. Einen Vorgeschmack auf das unappetitliche Ende dieser Geschichte erhalten wir schon ganz zu Beginn: Oljas Affäre Volodja etwa isst nicht nur einfach, er „rammte die Gabel in das harte Fleisch, schnitt ein ordentliches Stück ab“, währenddessen „durchbohrte“ Vitka am anderen Ende des Tisches „hastig ein paar widerspenstige Erbsen“, schließlich landet die Nahrung „zwischen eiergelben Lippen“. Lediglich Oljas Essgewohnheiten wirken grazil, beinahe unschuldig. Der Mensch ist, wie er isst, und „Olja aß gemächlich“. Womöglich ist das der Grund, weshalb Burmistrov am Ende dieser Zugfahrt vor ihr auf die Knie geht und sie anfleht, ihr von nun an einmal im Monat beim Essen zusehen zu dürfen.
Erinnerungsfetzen eines dahinsiechenden Bewusstseins
Jaroslav Švarcštejn [Yaroslav Schwarzstein] hat Sorokins Text mit Zeichnungen illustriert. Sie halten das Erzählte in Momentaufnahmen fest, die zwischen Pop-Art und Expressionismus mäandern, immer das Unangenehme, Unappetitliche im Menschen hervorhebend. Blutunterlaufene Augen, abstehende Strähnen, talgige, verschwitzte Wangen und Speichelfäden in den Mundwinkeln vor verschwommenem, braun-rötlichem Hintergrund. Die kantigen Gesichter sind nicht selten zu alptraumhaften Grimassen verzerrt, selbst dann, wenn sie lachen. Und wenn Olja träumt, ist plötzlich alles grau-blau. Das kontaminiert die Fantasie, bricht vielleicht sogar ein Stück weit die Illusion, ließe sich einwenden. Aber eine klassische Erzählung zu verfassen, war ganz offensichtlich nicht Sorokins Ziel. Dieser Eindruck stellt sich bereits ein, wenn man das klobige Exemplar der deutschen Ausgabe erstmals in den Händen hält, das wohl allein durch seine Form, ein unhandliches Rechteck-Format, ein Statement gegen Bus- und Bahnlektüre setzen will. Man könnte Jaroslav Schwarzsteins Illustrationen als vom Adrenalin zersetzte Erinnerungsfetzen eines dahinsiechenden Bewusstseins betrachten, in dem sich das Erlebte gleichsam in einer Wort- und Bilderflut auflöst. Realität und Traum verschwimmen miteinander in düsteren Farbimplosionen. Vielleicht also eine Neuauflage des literarischen Bewusstseinsstroms? Die schrillen Farben, die beinahe ins Absurd-Komische überspitzten Bilder der Gewalt, die Zeitsprünge – diese Geschmacksträger hinterlassen einen Hauch von Tarantino oder Frank Miller. Die Frage ist, ob diese Bildästhetik ohne Weiteres mit Literatur kombinierbar ist, ohne dass dabei ein Bilderbuch für den Tankstellen-Grabbeltisch herauskommt. „Pulp Fiction“ – ein Groschenroman eben.
Das Chaos auf den Tellern spiegelt das Chaos der Außenwelt
Folglich dürfte man die Beschäftigung mit „Pferdesuppe“ an dieser Stelle beenden, wäre das alles. Aber Sorokin hat noch ein wenig mehr „Meta-“ in petto. Seine Erzählung galoppiert durch die 80er und 90er Jahre wie eines jener kasachischen Wildpferde, überspringt Jahre in Zeilenkürze, und hält nur kurz zum Durchatmen inne, um sich den Treffen der beiden Protagonisten zu nähern, bei denen der Anblick Oljas beim Essen bei Burmistrov orgasmische Krämpfe auslöst. Bei keinem der beiden handelt es sich um den idealen Sowjetmenschen. Er hat wegen seines unternehmerischen Naturells eingesessen, sie strebt nach Status, kifft und erkundet ihre Sexualität. Der soziale Aufstieg der beiden Figuren entwickelt sich analog zum Abstieg des sozialistischen Systems. Es verwundert deshalb nicht, dass sie zu Beginn der Neunziger zum exklusiven Zirkel derjenigen Russen gehören, die aus dem Zusammenbruch zu profitieren wissen. Olja als Frau eines Beamtensohnes und Burmistrov als das, was sie in Russland wohl als „Vor“ (Dieb) bezeichnen würden.
Mit dem fortschreitenden Chaos in der Außenwelt, steigt auch das Chaos auf den Tellern. Einst sorgfältig nach Beilagen und Hauptgericht getrennte Speisen vermischen sich zu einem undefinierbaren Brei, werden weniger, bis Olja eines Tages nur noch Luft löffelt. Eine brillante Wendung der Erzählung zum modernen Märchen ergibt sich, als die von ihrem neuen Leben in der High Society geblendete, und von ihrem merkwürdigen Weggefährten gelangweilte Olja beschließt, ihre Treffen zu schwänzen. Stattdessen bricht sie zu einer Luxusreise mit Ehemann durch die Schweiz auf. Dort sitzt sie eines Nachts vor einem Hummer, und merkt, dass sie nichts mehr essen kann. Von den Tellern dünstet ihr nur noch Verwesung entgegen. Überstürzt macht sie sich auf den Rückweg, um Burmistrov zu finden.
Oljas Fluch ist der Fluch eines Staates
Solche Bilder lassen sich zu mächtigen Allegorien weiterspinnen. Ein wenig König Drosselbart steckt in der Geschichte, aber vor allem Sozialkritik. Oljas Fluch ist auch der Fluch eines Staates, dessen Bevölkerung während der 90er Jahre in tiefer Armut schmachtete, während einige wenige es durch den Ausverkauf staatlichen Besitztums zu absurdem Reichtum brachten. Fernsehbilder von sich prügelnden Menschenmengen vor ausverkauften Lebensmittelregalen nebst Cocktailpartys in Gold. Der fliegende Wechsel von kommunistischer Planwirtschaft und Helden der Arbeit zu Raubtierkapitalismus, Konsum als Statussymbol und marodierenden Verbrecherbanden dürfte nicht Wenigen als die endgültige Niederkunft des Nihilismus vorgekommen sein. Er blinzelt einem zuletzt aus den Zwischenräumen der Zeilen entgegen. Manche mögen sie gar bis in die Gegenwart verspüren.
Das sind schwer genießbare Zutaten. Aber Wladimir Sorokin versteht es, sie zu einem würzigen Süppchen aufzukochen. Man wünscht guten Appetit.
Sorokin, Vladimir, Švarcštejn, Jaroslav [Yaroslav Schwarzstein]: Pferdesuppe. Aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg. Berlin: Ciconia Ciconia Verlag, 2017.
Sorokin, Vladimir: Lošadnyj Sup. Moskva: Zacharov, 2007.


