

Über die Zukunft oder auch nicht: Vladimir Sorokins Roman Tellurija
Es bedarf Konzentration und einer ruhigen Hand. Ein fester geübter Schlag mit dem Hammer und der Tellur-Nagel gleitet in den zuvor sauber rasierten und desinfizierten Schädel. Danach ist man entweder tot oder wandelt auf langersehnten Pfaden der Glückseligkeit. Wie man sich vor allem Letzteres vorzustellen hat und wie unser Leben in Zukunft aussehen könnte, verrät Vladimir Sorokin in seinem neuesten Roman „Tellurija“.
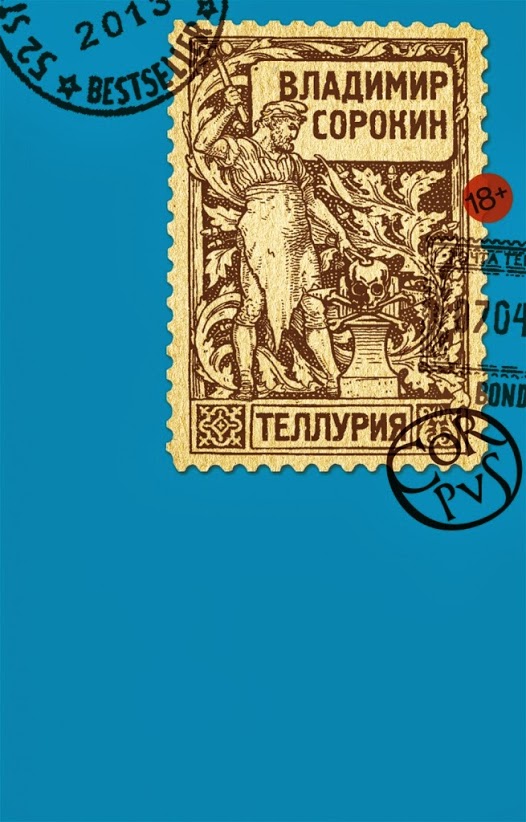
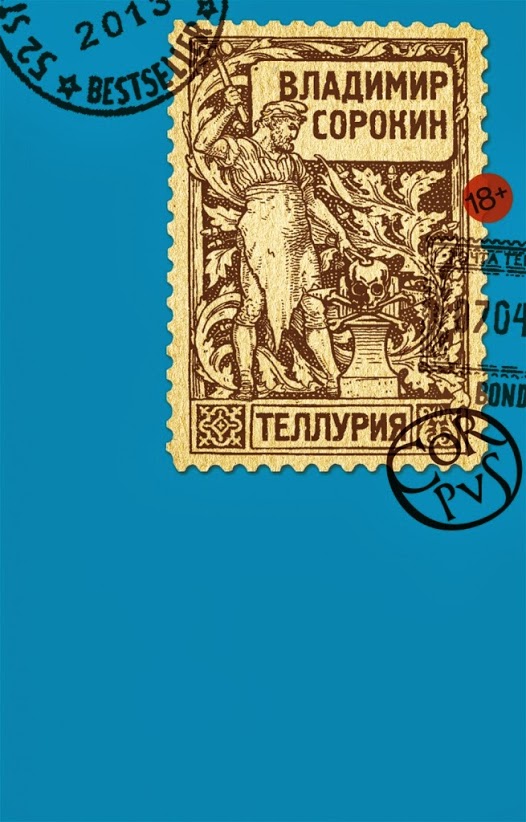
Die Vorgänger Tellurijas sind bekannt: Neben Metel‘ (Der Schneesturm) gehören Den‘ opričnika (Der Tag des Opritschniks) oder Sacharnyj kreml‘ (Der Zuckerkreml) längst zum zeitgenössischen Literaturkanon. Auch kennt man den Autor. Und wenn nicht wegen seiner Bücher oder Theaterstücke, dann als immer wiederkehrenden Namen, etwa in bekannten deutschen Tageszeitungen, wenn diese um Kommentare zu Literatur und zu Russland oder Putin bitten. Der fleißige Zeitungsleser weiß den Namen Sorokin dem Mann mit dem silbernen Haar, dem adretten Mittelscheitel samt obligatorischem Kinnbart treffsicher zuzuordnen.
Nun war bis dato die Auseinandersetzung mit dem politischen System und der Vergangenheit Russlands, getragen von ungewöhnlicher Sprachgestaltung sowie Spielereien mit menschlichen Ekel- oder Moralgrenzen oftmals das Herzstück literarischer Arbeiten Vladimir Sorokins. So ist auch das Konzept Tellurijas. Das Buch ist 2013 in Moskau erschienen und wird im August dieses Jahres in deutscher Übersetzung bei KiWi zu erwerben sein. Um der Vielstimmigkeit des Buches gerecht zu werden, arbeitet ein ganzes Kollektiv an Übersetzern an der Übertragung ins Deutsche. Tellurija gewährt einen Einblick in eine Zukunftsvision. Es ist ein Schlüsselloch, durch das man nicht nur einen Blick auf das künftige Russland erhaschen kann, sondern auch auf große Teile Europas in den noch vor uns liegenden Jahren des 21. Jahrhunderts.
Zu diesem Zeitpunkt haben Kriege einen Großteil der bekannten eurasischen Welt verwüstet und unzählige Brachen hinterlassen. Verstreute Brachen, die in einer reichen Vielfalt kleiner Königreiche, Fürstentümer, Republiken oder anderer Kleinststaaten aus den hinterlassenen Trümmern im Zeitalter eines neuen Mittelalters wieder aufgestiegen sind. Gegenwärtige Staatsgrenzen existieren nicht mehr. Stattdessen ähnelt der Kontinent einem Flickenteppich – geknüpft als Ergebnis von Bürgerkriegen in Russland und einem Salafisten-Überfall auf Europa.
So ist zum Beispiel Stockholm mittlerweile islamisch geworden, während von der Schweiz nichts als verbrannte Erde übrig geblieben ist. An Bayern grenzt ein Staatsgebilde namens Preußen und aus den südlichen Provinzen Frankreichs hat sich der neue Staat Languedoc formiert. Das war der wichtigste Punkt des europäischen Widerstandes gegen die islamischen Angreifer. Überquert man die Ruinen der großen russischen Mauer, die de facto nie fertig gestellt wurde, entdeckt man, dass Moskau jetzt die Hauptstadt Moskowiens ist, das von einem Fürsten im Kreml regiert wird. Ein beträchtlicher Teil Moskowiens wird dabei von Chinesen bevölkert. Wer Sehnsucht nach Väterchen Stalin hat, dem sei ein Besuch in der Stalinistischen Sowjetischen Sozialistischen Republik empfohlen. Diese wurde nach dem Zerfall des postsowjetischen Russland von drei Oligarchen und Sympathisanten des schnurrbärtigen Diktators gegründet.
Der Vielfältigkeit der Staatsgebilde entspricht das bunte Spektrum ihrer Bewohner, das sich, neben Menschen, aus Riesen und Zwergen, zoo- sowie anthropomorphen Wesen zusammensetzt. So begegnet man Zentauren, Männern mit Hunde- oder Frauen mit Eselköpfen. Hier und da spricht man auch neue Sprachen. Rauchende Schornsteine von Fabriken, die die Menschheit einst mit Massenproduktion versorgten, gehören der Vergangenheit an. Auch ist der ewige Schrei nach dem technologischen Fortschritt verstummt. Hier sattelt man wieder ganz traditionell das Hufgetier, denn desselben gibt es viel und variabel. Pferde, so groß wie zehnstöckige Häuser oder so klein wie Katzen. Das Motto „höher, schneller, weiter“ hat ebenfalls ausgedient und ist zu Gunsten der Erkenntnis gewichen, dass Konsum und Fortschritt nicht glücklich machen. Das Glück in dieser Welt verspricht etwas anderes: Tellur. Eine Droge, die aus der Republik Tellurija kommt und nach der ein Jeder und eine Jede die Hände ausstrecken. Verständlich, denn sie lockt mit dem Paradies.
Aufflackernde Neugier und Enttäuschung
Tatsächlich kommt dieser Droge eine doppelte Funktion zu. Sie ist das Bindeelement für die Menschen der Tellurija-Welt und macht sie glücklich. Allerdings macht Tellur auch den Leser glücklich, ist es doch der Klebstoff, d.h. der rote Faden, der die 50 titellosen, aber mit römischen Zahlen nummerierten Kapitel zusammenhält. Sie sind unterschiedlich lang, sie erzählen unterschiedlich von Unterschiedlichem. Die einzige Konstante ist die besagte Droge, nach der nahezu jede Figur des Buches, ganz gleich aus welchen Gründen, lechzt.
Darin tritt ein sehr kreatives Konzept zutage, ähnelt schließlich kein Kapitel dem anderen. Die einzelnen Figuren und ihre Geschichten entwickelt Sorokin stets nur auf wenigen Seiten. So spinnt er Erzählfäden, die jedoch gleich wieder fallen gelassen und später nicht wieder aufgenommen werden. Seine Leser versetzt er damit in einen Zustand immer wieder neu aufflackernder Neugier und unmittelbar darauf folgender Enttäuschung. Dabei ließe sich nahezu jedes dieser 50 Fragmente einzelner Schicksale zu einem ganzen Buch ausbauen.
Ähnlich verhält es sich mit der Sprache des Romans. Tellurija ist ein sich auf insgesamt 441 Seiten erstreckender Beweis für Sorokins Rhetorikkünste, der die Arbeit der Übersetzer nicht leicht macht. Zeile für Zeile und Wort für Wort demonstriert Sorokin sein virtuoses Können, indem er nicht nur immer wieder mit neuen Stilen und Genres spielt, große Autoren parodiert, Zitate und Verweise einflicht, sondern sogar neue Sprachen erfindet, wie im Falle des unglücklich verliebten Zentauren, der um seine Kolombina weint. Man lauscht den wohlartikulierten Phrasen intellektueller Denkarbeit, schmunzelt über den unbeholfenen Satzbau kleiner Dorfmädchen oder liest peinlich berührt über wortkräftige Vulgarismen hinweg. Es werden epische sowie dramatische Erzählweisen aufgegriffen. Dabei taucht man in Geschichten ein, deren Redekunst an Märchen, Gebete oder auch Zeitungsartikel erinnert.
Sorokins Wille zum Experiment in der formalen Struktur des Buches wird damit auf jeder Seite demonstriert. Zugegeben, es ist eine Leistung, die von kreativer Schöpfungskraft und Einfallsreichtum zeugt. An einigen Stellen wirkt diese sprachliche Komplexität jedoch stark überstrapaziert und etwas aufgesetzt.
Vladmir Sorokin zieht seinen Roman als Dystopie auf. Er lässt eine apokalyptische Welt aus Gewalt, Sex und Vergewaltigung, Drogen, Alkohol und politischer Polemik entstehen. Zwar geht es dem Autor dabei nicht um das blanke Darstellen dieser Szenarien, um des Horrors oder Ekels willen, sondern um einen darin subtil angesiedelten Kerngedanken des Buches, der dadurch zum Ausdruck kommen soll, doch genau das hatte die Kreml‘ nahe Jugendorganisation Iduščie vmeste (Die Gemeinsamgehenden) 2002 dazu verleitet, über hundert Bücher Sorokins zu verbrennen. Diesmal dürften die Streichhölzer allerdings in der Schachtel bleiben. Das provokante Element in seinen Texten wird per se beinahe erwartet. Denn es kehrt bei Sorokin stets wieder. Szenen mit Nymphomaninnen, die euphorisch nach Abenteuern mit fremden Männern suchen, haben auf diese Weise ihr Überraschungspotenzial eingebüßt. Und Homosexuelle, die bei dem Versuch sterben, im Drogenrausch Stalin zu begegnen, sorgen ebenso wenig für Verwunderung wie alkoholisierte Zwerge oder sprechende Phallusse. Der Entwurf eines muslimischen Europas wird jedoch im Hinblick auf die sich verbreitende Islam-Skepsis einige Leser gewiss zum Nachdenken anregen – nicht über die Zukunft, sondern über die Gegenwart.
Sorokin, Vladimir: Tellurija. Moskva: AST, 2013.
Weitere Literatur von Vladimir Sorokin:
Sorokin, Vladimir: Metel‘. Moskva: AST, 2010.
Sorokin, Vladimir: Der Schneesturm. Aus dem Russischen von Andreas Tretner. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2012.
Sorokin, Vladimir: Sacharnyj kreml‘. Moskva: AST, 2008.
Sorokin, Vladimir: Der Zuckerkreml. Aus dem Russischen von Andreas Tretner. München: Wilhelm Heyne Verlag, 2012.
Sorokin, Vladimir: Den‘ opričnika. Moskva: Zacharov 2006.
Sorokin, Vladimir: Der Tag des Opritschniks. Aus dem Russischen von Andreas Tretner. München: Wilhelm Heyne Verlag, 2009.


