

Die Hähnchenhälftenfrau
Über die Unschuld der Wörter, Metaphern und Portraits in Olga Martynovas neuem Roman Mörikes Schlüsselbein
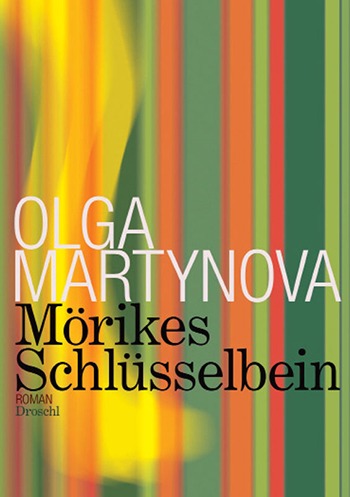
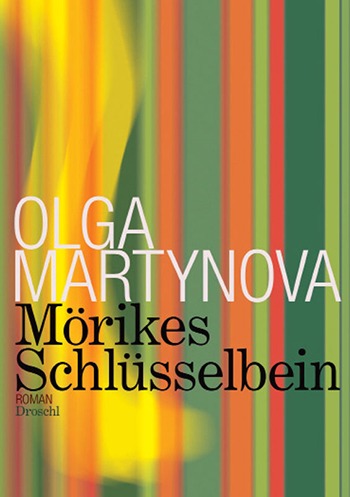
In diesem poetischen Bereich, wo kodifizierte Worte, Metaphern und Neologismen nahtlos ineinander übergehen, finden sich bei Martynova auch eine Fülle wunderbar einprägsamer, konzentrierter Portraits: Kennenlernen darf man zum Beispiel die “Krankenschwester, die kleine Russin mit Haar aus schwarzer Zuckerwatte”. Oder ein “Streichholzmädchen, mit langem Körper und rundem dunklem Kopf; mit etwas herabgelaufenem Schwefel am Nacken seines Zündkopfs: das dunkle Haar stramm zum Nacken gezogen.” Manchmal handelt es sich um stille, fotografische Bilder: “Viel Gesicht, dessen weiß-rosa Fleisch durch lächelnde Augen beseelt ist, auch der kleine Mund ist so anmutig, dass er zwischen der großzügigen Peripherie von Wangen und Kinn nicht verloren geht.” Manchmal sind es Bilder gedanklicher Konzentration: “Sein Gesicht war wie eine Winterlandschaft, die man früher als Sommerwiese gekannt hatte: vertraut, aber unzugänglich.” Und einmal beim Blick in den Spiegel: “ein noch nicht so alter Woody Allen, nur ohne Brille, eine traurige rothaarige Teekanne.” Dann wiederum Portraits geronnener biografischer Zeit: “Mr. White war einst ein Junge gewesen, der ausschließlich aus weißen Zähnen und schwarzen Wimpern zu bestehen schien. Die Zähne waren zwar immer noch weiß, die Wimpern lang und die Augen sehnsüchtig, aber er hatte unebene Wangen, eine schiefe Nase und ein schwammiges Kinn dazubekommen.”
Manchmal finden sich Neologismen, Metaphern und Menschen in einem einzigen Bild wieder: Etwa im Fall der immer wiederkehrenden “Hähnchenhälftenfrau”, oder bei einer anderen mit “Vogelknochenkörper”. Was zeigt sich in dem Zusammenspiel von Wörtern, Metaphern und Menschen? Vielleicht, dass Metaphern etwas sehr Menschliches sind, zumindest bei Martynova. Das wäre der utopische Aspekt ihres Schreibens, das durch ihr bedingungsloses Bekenntnis zum Literarischen beeindruckt. Oder sind doch eher die Menschen metaphorisch? Sie beziehen sich immer auf etwas anderes, das sie nicht sind und ohne welches sie nichts wären. „Die Wörter sind unschuldig“ hat Martynova in einem Interview kürzlich einmal gesagt. „Wir sind schuldig, wenn wir sie falsch setzen“. Unschuldig sind die Wörter scheinbar nicht zuletzt in ihrem Metaphorisch-Sein, von dem sie zu bewahren nicht der literarischen Ethik letzter Schluss sein kann. Gerade in ihrer unaufhörlichen Uneigentlichkeit halten die Wörter den Menschen scheinbar das Wesentliche bereit. In Martynovas neuem Roman Mörikes Schlüsselbein ist einmal die Rede von der „Gefahr, dass der Gedanke in einen falschen Körper hineinspringt. Die fertigen Sätze sind jederzeit bereit, einen frischen Gedanken zu verschlingen. Und eben darin besteht die Arbeit eines Dichters, die verbrauchten Schemen aufzuscheuchen. Sonst würden wir Gedanken denken, die nicht unsere sind; uns Gedanken unterwerfen, die nicht unsere sind; Gefühle empfinden, die nicht unsere sind.“ Durch die immer metaphorischen Wörter Mensch zu werden – das ist die poetische Vorstellung vieler kleiner, sich selbst produzierender homines fabri. Olga Martynovas neuer Roman Mörikes Schlüsselbein (Droschl, Graz/Wien 2013), der auch das Kapitel enthält, mit dem die Autorin im letzten Jahr den Bachmann-Preis gewonnen hat, knüpft nicht nur in der Hinwendung zur poetischen Konzentration in der Prosa direkt an den vorherigen Roman Sogar Papageien überleben uns (Droschl, Graz 2010) an. Auch die auftretenden Personen sind teilweise dieselben, etwa der depressive Büchermensch Andreas, mit dem Marina nach 20 Jahren Funkstille nun wieder zusammenlebt. Hinzu kommen zahlreiche weitere, über den Erdball verteilte Personen, unter anderem der junge Moritz, ein werdender Autor, der genauso wie der gerne trinkende Leningrader Dichter Fjodor Stern zum Ko-Erzähler wird. Auch die Tonlage ist ähnlich: zugleich witzig und rührend, eine gewisse Schärfe verträgt sich dabei gut mit einer außerordentlichen Behutsamkeit im Umgang mit den Charakteren. Und im Aufstand gegen eine Geschichte als “Skalar” oder “Vektor” rückt der zwischen mehreren Erzählwelten hin- und herspringende Roman erneut verzweigte Zeiten ins Bild, die sich überlagern und aufeinander verweisen. Vielleicht sollte man also besser sagen: Martynova hat ihren ersten Roman weitergeschrieben, ein immer weiter ausufernder Familien- und Künstler-Roman mit Fortsetzungscharakter, der nicht zwischen zwei Buchdeckel passt. Man kann gespannt sein, ob sie in dieser Form weitermacht.
Martynova, Olga: Mörikes Schlüsselbein. Graz/Wien: Droschl, 2013


