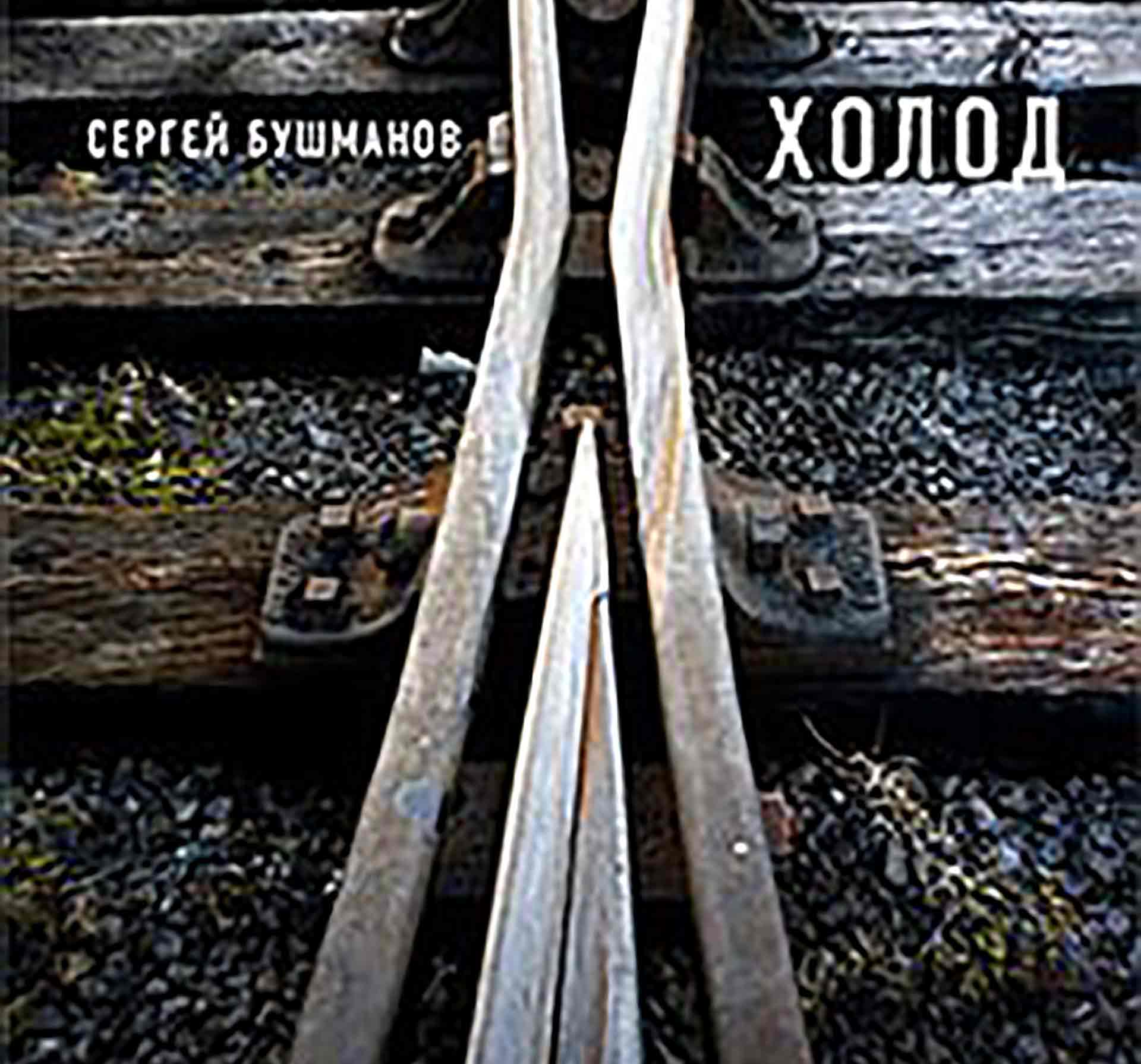
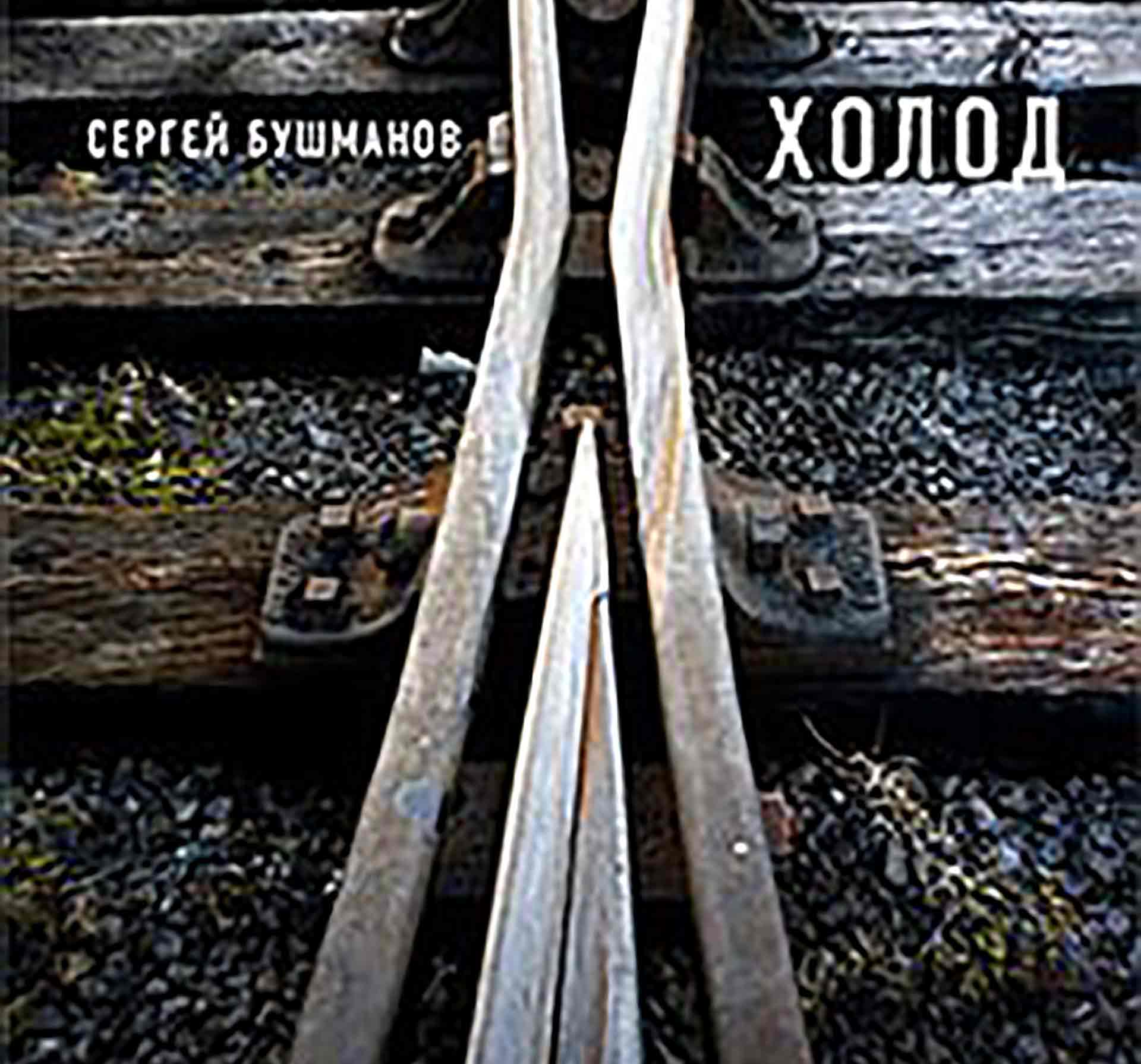
…und ewig ruft die Arktis
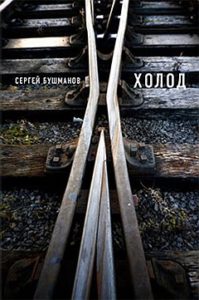
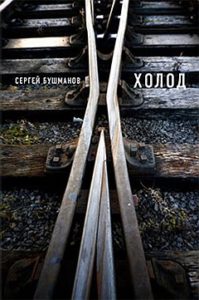


In seiner Erzählung schildert Bušmanov die Erinnerungen eines obdachlosen Jugendlichen an die Jahre vor und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die sprunghafte Rückschau entspricht dem brüchigen Lebensweg des namenlosen Ich-Erzählers und Helden: Nicht einmal achtjährig ist er auf sich gestellt und durchmisst fortan rast- und ziellos das Land. Verlust, Flucht, Einsamkeit, Angst, Gewalt und immer wieder der Kampf gegen die Kälte bestimmen seine Lebenswirklichkeit. Sie sind die treuen Begleiter auf seiner Irrfahrt durch ein Land, das wie das Reich der Schneekönigin in Kälte erstarrt ist. Doch anders als in Andersens Märchen, wo menschliche Liebe und Wärme den Bann der Kälte brechen, bleibt Bušmanovs Held auf seiner Suche nach Erlösung auf sich selbst zurückgeworfen. Der einzige Schutzschild auf dieser lebenslangen Suche ist sein naives Weltvertrauen: „Und alles wird gut!“ – die letzten Worte, die seine Mutter ihm im Traum zum Abschied zuraunt. Aus dieser Schicksalsergebenheit schöpft er die Kraft und Selbstgewissheit eines Nietzscheanischen Freigeistes, der „auf den Versuch hin lebt und sich dem Abenteuer anbietet“.


Bewegung ist das Prinzip des Lebens – und sein Prinzip des Überlebens. Nur Bewegung hilft, der natürlichen Kälte der Umgebung ebenso wie der sozialen Kälte der Gesellschaft zu trotzen. Daher scheint es nur allzu konsequent, dass seine letzte Reise – in die Arktis – zu einer „geistigen Polarfahrt“ wird, zu einer Reise zum Mittelpunkt des Selbst, bei der die körperliche Extremerfahrung hinter der geistigen Erfahrung an der Grenze zwischen Leben und Tod zurücktritt. Gewiss: Gefährlich leben, sich prometheische Ziele stecken und an ihnen „animae magnae prodigus“ zugrunde gehen, ist eine verführerische Möglichkeit, seinem Leben einen Sinn zu geben. Aber anders als Nietzsches Freigeist schreckt Bušmanovs Held dann doch vor der letzten Konsequenz des souveränen Individuums zurück. Statt der „großen Loslösung“ verlässt er sich doch lieber auf eine „höhere Macht, die den allgemeinen Verlauf der Dinge bestimmt“.


Die Erzählung Cholod beschert dem Hyperboreer-Mythos nicht nur eine Wiederkehr, sondern lässt seine Wärme- und Kältepole sogar in eins fallen. Genauer gesagt: Bušmanov verschmilzt einfach die antike Auffassung von glücklichen Menschen, die in einem warmen Land weit im Norden leben und Nietzsches Vorstellung von einem Weg zu Glück, übermenschlicher Kraft, Stählung des Willens und neuen Werten, der durch Kälte, Schnee, Eis und Einsamkeit führt. Die Suche von Bušmanovs Helden nach dem erlösenden Elysium ist gleichzeitig Flucht vor der kalten Entfremdung und Suche nach dem wärmenden Sinn des eigenen Lebens, der seit dem als traumatisch empfundenen Tod der Mutter und der Ablehnung durch seine Mitmenschen ernstlich auf dem Spiel steht. Die kindliche Erfahrung von Wärmeverlust und Kälteschock hat ihn skeptisch werden lassen gegen die vermeintliche Menschenliebe. Sie treibt ihn ständig vorwärts und weiter weg, hin in die tröstende Einsamkeit und Stille der Arktis. Der Ausstieg aus einer von „Verrat, Niedertracht und Gleichgültigkeit“ zersetzten postsowjetischen Gesellschaft ist der einzige Weg, der ihm noch offensteht, um das eigene Scheitern abzuwenden. Diese letzte Etappe seiner Sinnsuche, deren Ziel er letztendlich „im (kalten) Herzen der schneeweißen Arktis“ erkennt, gleicht in der Tat einem unerhörten Akt der Selbstüberwindung und Selbsterneuerung. Ausgerechnet in der schier endlosen und lebensfeindlichen Wüste aus Schnee und Eis, wo der Mensch nicht nur keine Spuren seiner Existenz hinterlässt, sondern in deren Unendlichkeit er sich auch zu verlieren droht, offenbart sich Bušmanovs Helden der Sinn des Lebens: Endlich „zu Hause“ fällt augenblicklich alle Kälte von ihm ab.


Dass Hyperborea und ähnliche Paradiese jedoch schneller zerronnen als gewonnen sind, dass der Freigeist auch bloß Sehnsucht und Imagination eines einsamen Philosophen war, wird am Schluss deutlich. Denn nach 120 Seiten spannender Abenteuer und philosophischer Selbsterkundungen stiftet der plötzliche Einbruch der Realität allgemeine Ernüchterung und Verwirrung. Und wenn beide überwunden sind, bleibt leise Enttäuschung als Residuum.
Bušmanov, Sergej: Cholod. Moskva 2012
Weiterführende Literatur:
Frank, Susanne: City of the Sun on Ice. The Soviet (Counter-)Discourse of the Arctic in the 1930s. In: Arctic Discourses. Newcastle upon Tyne 2010
Frank, Susanne: Tёplaja arktika. K istorii odnogo starogo literaturnogo motiva. In: Novoe literaturnoe obozrenie № 108 (2011)
Herodot von Halikarnassos: Historien. Buch IV, Kapitel 32–36 (übers. und hrsg. von Josef Feix). 7. Auflage. Düsseldorf 2006
Lethen, Helmut: Lob der Kälte. Ein Motiv der historischen Avantgarden. In: Die unvollendete Vernunft. Moderne versus Postmoderne. Frankfurt am Main 1987
McCannon, John: Red Arctic. Polar Exploration and the Myth of the North in the Soviet Union, 1929–1939. New York 1998
Nietzsche, Friedrich: Der Antichrist. In: Colli, Gorgio/Montinari, Mazzino (Hg.): Kritische Studienausgabe (Bd. 6). München 1999
Pindar: Zehnte Pythische Ode (übers. von Friedrich Hölderlin). In: Sämtliche Werke (Bd. 5). Stuttgart 1952


