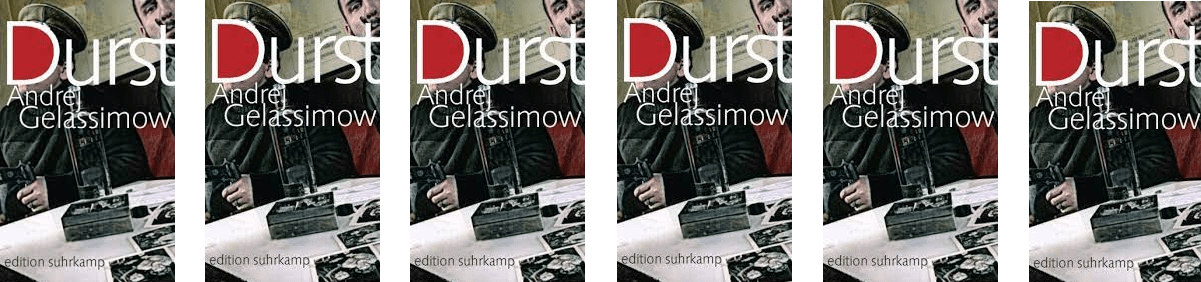
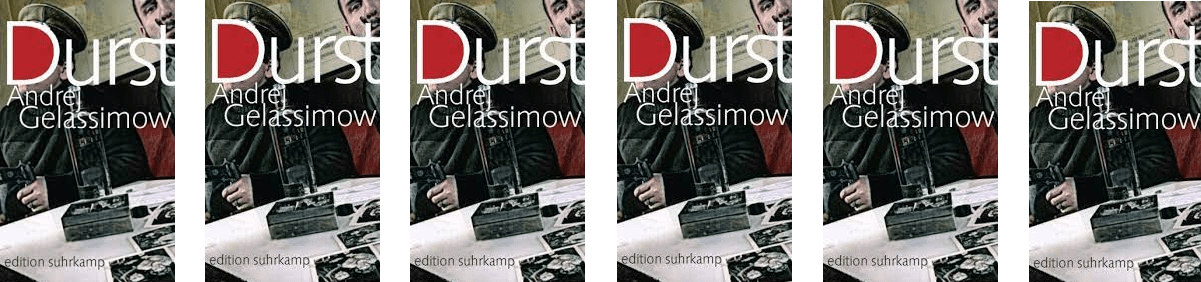
Andrej Gelasimov – ein „neuer sibirischer Salinger“
In letzter Zeit hört man hier zu Landen immer wieder Klagen über die schlechte Lage der russischen Gegenwartsprosa, oder vielmehr darüber, dass weit und breit kein neuer Stern am Himmel der aktuellen russischen Literaturlandschaft zu finden sei, dem man eine – durch den literaturwissenschaftlichen Zugriff oder durch Übersetzungen ins Deutsche geadelte – literarische Qualität von Bestand zusprechen könnte. Und tatsächlich, es ist etwas stiller geworden um die Diskussion aktueller russischer Literatur in Deutschland. Keine neue Ulickaja, kein neuer Akunin, kein neuer Pelevin, ja nicht mal ein neuer Sorokin weit und breit, geschweige denn ein Autor vom Schlage Andruchovičs, der durch sein geo-poetisches Konzept Slawisten- und Lektorenherzen gleichermaßen und erstaunlich langanhaltend höher schlagen lässt? Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass gerade die Repräsentanz einer neuen, nennen wir sie „post-postsowjetischen“ russischen Autorengeneration, in deutschen Übersetzungen zu wünschen übriglässt. Das mag zum einen daran liegen, dass russische Verlage eine für unsere Maßstäbe wenig qualitative Lektorierung der Texte durchgehen lassen und nicht wenige Texte, gerade auch jüngerer Autor_innen, bisweilen eine recht fragwürdige ideologische Ausrichtung haben. Das mag zum anderen aber vor allem auch daran liegen, dass viele Texte zu russlandspezifischen Themen transportieren, die die deutschsprachigen Leser_innen schlicht und ergreifend nicht großartig interessieren werden.
Es verwundert allerdings, dass ausgerechnet die Prosatexte von Andrej Gelasimov, bis auf eine Erzählung, in der von Galina Dursthoff herausgegebenen Erzählsammlung Russland. 21 neue Erzähler (Deutscher Taschenbuchverlag, München 2003) bisher in alle möglichen Sprachen, aber noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden und überhaupt der Autor hier bisher kaum wahrgenommen wird. Denn gerade die für Gelasimovs Texte typische Mischung von vermeintlich anspruchsloser Unterhaltung und gesellschaftspolitisch kritischer Sensibilität würde hier sicherlich auf eine größere Leser_innenschaft und auf Gefallen des Feuilletons stoßen. Seine Prosatexte sind charakterisiert durch romantische aber gänzlich unpathetische, ironisch-fatalistische Geschichten und durch eine besondere Vorliebe für situationszentrierte, episodische, nahezu filmische Erzählstrukturen mit besonderer Aufmerksamkeit für die zwischenmenschlichen Realitäten des Alltags. Gelasimovs Helden sind durchschnittliche, meist vom gesellschaftlichen Treiben zurückgezogene Menschen im besten Jugendalter, deren Geschichten und Charaktere durch einfache Stilistik, hintergründigen Humor und durch kurze, dialogische Szenen umrissen sind, ohne dass es je in Banalitäten abdriften würde. Im Gegenteil: „Bei Gelasimov ist der Humor weniger eine zweite Natur als vielmehr eine Waffe, eine Form des Widerstands, um überleben zu können“ beschrieb die Zeitschrift Le Monde des livres (2005) sehr treffend Gelasimovs Schreiben.
Bei den eher wenigen öffentlichen Auftritten gibt sich der promovierte Anglist und studierte Regisseur Gelasimov – soweit ich das aufgrund von youtube-geschalteten Interview-Mittschnitten beurteilen kann – mürrisch und leicht blasiert, ganz im Gegensatz zu einem allzeit publikumsschmeichelnden, medial überpräsenten Autor wie Evgenij Griškovec. Das macht ihn als Gesprächspartner vielleicht nicht gerade zugänglich, lenkt aber das Interesse mehr auf seine Texte als auf seine Person und das ist dann doch allemal sympathischer: Bereits nach Erscheinen seines dünnen Erzählbandes Foks Malder pochož na svin’ju (Fox Mulder sieht aus wie ein Schwein) bejubelte die russische Kritik den 1966 in Irkutsk geborenen Autor als „neuen sibirischen Salinger“. Und spätestens mit seinem 2002 erschienenen zweiten Buch Žažda (Durst) über einen jungen Mann, der entstellt aus dem Tschetschenienkrieg in den banalen Moskauer Alltag zurückkehrt, galt er als zwar umstrittener, aber aufsteigender Stern der „jüngeren“ russischen Literatur. Es folgten dann in kurzen Abständen weitere Publikationen und mit jedem Buch bewegte er sich zusehends von der Kurzform weg zu immer umfangreicheren Romanen: 2003 erschien der Roman God obmana (Jahr der Lüge) um eine Dreiecks-Liebesgeschichte aus der Perspektive eines Vertreters der neuen urbanen 1990er-Jahre-Mittelschicht, ebenfalls 2003 folgte der zwischen den 1960er und den 1990er Jahren spielende Roman Rachil’ (Rahel) über einen erfolglosen, halbjüdischen Literaturwissenschaftler und die Erinnerungen an seine drei Ex-Frauen. Einige Jahre später, 2008 erschien der mit dem “Nacional’nyj bestseller” 2009 ausgezeichnete Roman Stepnyje bogi (Steppengötter), in dem es um die in das Jahr 1945 in die russisch-transbaikalische Steppe verlagerte Freundschaft zwischen einem Teenager und einem Häftling, einem japanischen Arzt, kurz vor dem Einfall der sowjetischen Truppen in Japan und den Bombardierungen Hiroshimas und Nagasakis geht. Ende 2009, also fast noch als Neuerscheinung zu rechnen, erschien schließlich der wieder gegenwartszugewandte Roman Dom na Osernoj (Das Haus an der Osernastraße) über eine provinzielle Großfamilie, die sich in ungünstige Finanzgeschäfte verstrickt. Ungesicherten Quellen zufolge arbeitet Gelasimov derzeit bereits an einem weiteren, im äußersten Norden Russlands spielenden Roman mit dem treffenden Titel Cholod (Kälte).


