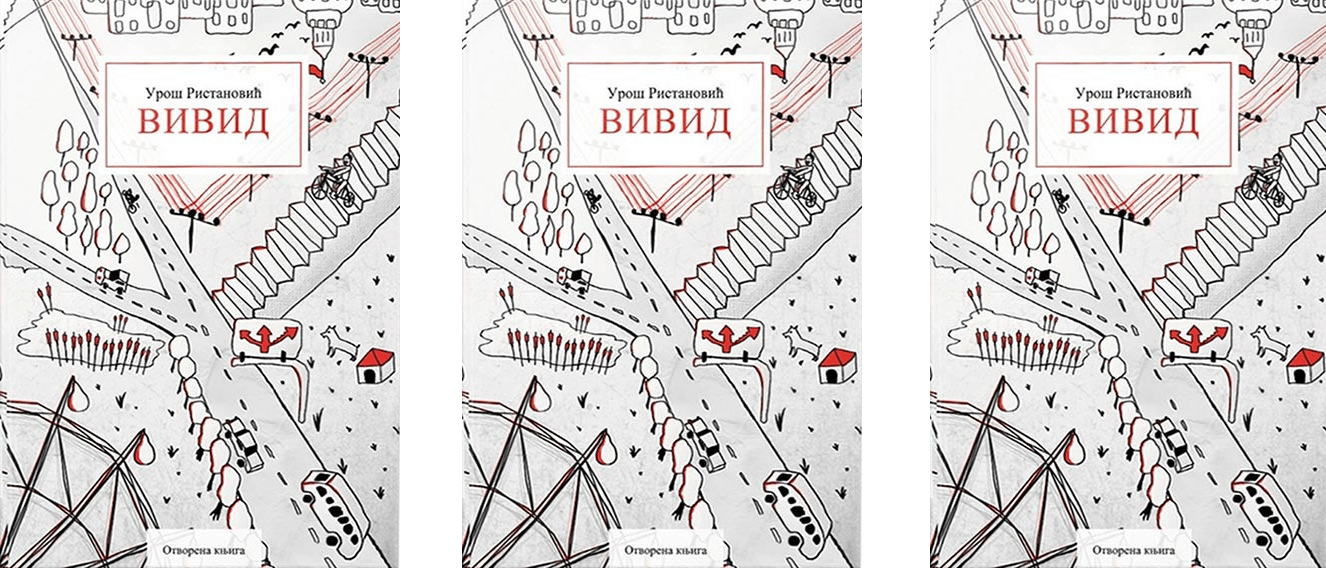
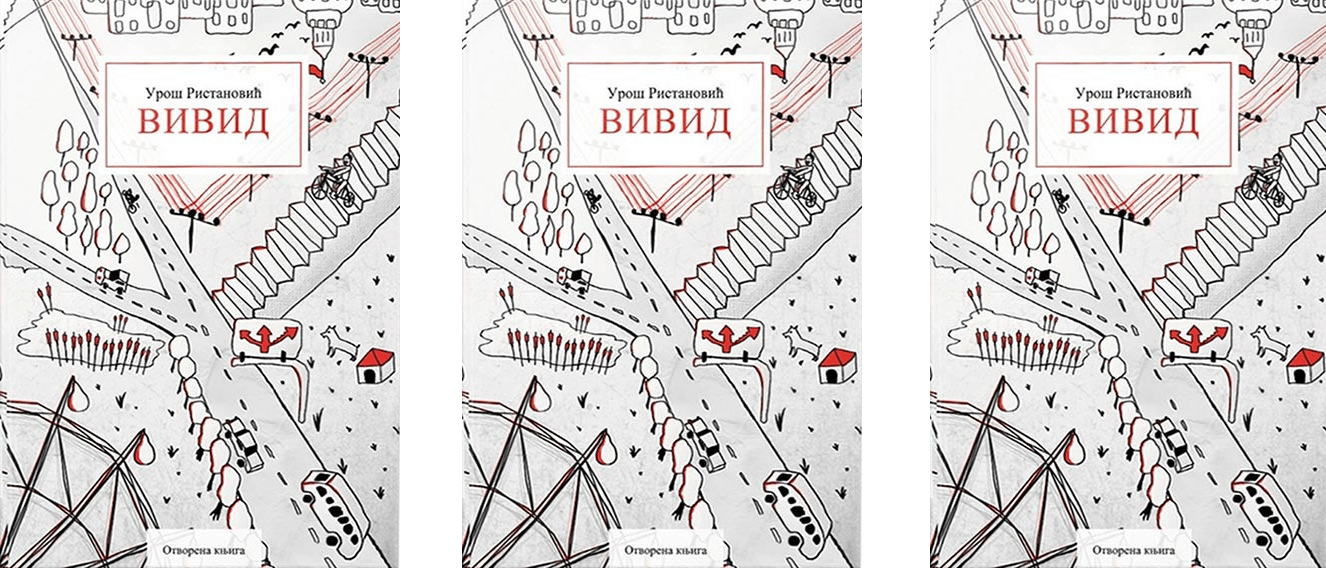
Exakte Farben, Veränderlichkeit der Form, Erinnern und Festhalten: “Vivid” von Uroš Ristanović
Verschachtelt wie ein Möbiusband erzählt Vivid von der sommerlichen Erholungsreise eines Teenagers aufs Land zu seinen Verwandten. Dieselbe Handlung entpuppt sich als psychodelische Erfahrung desselben und gewährt Einblicke in seine emotionalen Grenzgänge.
Vivid bedeutet ‚bunt‘ und ‚lebhaft‘. Das titelgebende Wort setzt sich zusammen aus vid ‚Sehen‘, ID für ‚Identität‘ sowie, damit in Zusammenhang, aus dem Pronomen vi ‚ihr‘. Eine ähnlich kaleidoskopische Lesart empfiehlt sich auch für den Text. Denn in Spektren aufgespalten wurde in diesem 2020 erschienenen Erstlingsroman des serbischen Schriftstellers Uroš Ristanović so manches.
Farbenfrohe Theorien
„Da waren alle Farben, außer Blaupurpur und Indigoblau, Orchidee, Nuancen der Aubergine, Fuchsie, Zyklamen“. Als synästhetische Chiffre einer schmerzhaften Erfahrung führt das im Buch fehlende Violett ins emotionale Zentrum des Romans bzw. des Protagonisten. Sein ‚anderer‘ Absturz hingegen erzeugt vielfältige Sinneseindrücke, ebenfalls vorwiegend sinnlich-visueller Natur. Bunte Disneyfiguren aus der Kindheit begleiten eine Nahtoderfahrung: „In Technicolor erkennen sie meine Angst und sagen, dass das ein Farbenspiel ist, die Nuancen der Einzigen, die man anbeten muss. Da sind die ersten Farben, Neongrün auf Lila, ein blauer Himmel auf Ultramarin, Türkis mit radioaktivem Grün, Purpurrot und Bordeaux“.
Man könnte Vivid mit Goethes Farbenlehre im Hinterkopf lesen, dessen eigener Einschätzung zufolge bekanntlich sein Hauptwerk, denn auch hier liegt ein Versuch vor, durch synästhetische Farbbetrachtung zwischen ontologischer und emotionaler Erfahrung zu vermitteln. Tatsächlich greift Ristanović Elemente daraus auf. So bringt er etwa die Goethe’schen Überlegungen zu entopischen (an Körper gebundenen) Farben zur Geltung, als er seine Figur das gesamte ‚weiße‘ Kapitel reglos und stumm aus dem Inneren eines Gipsquaders erleben lässt, dessen Risse beim Aufbrechen ein exaktes Kreuz nachzeichnen.
Primär orientiert sich diese gut zwei Jahrhunderte später in Angriff genommene ‚Studie‘ jedoch an zeitgemäßeren Konzepten. Auch ohne Spiegelscheibe erlauben die Farben des Lichts nunmehr äußerste Präzision bei effizienter Darstellung, indem die gängigen Muster digitaler Bildverarbeitung zum Einsatz kommen. Diese spielerisch klare Ordnung wird zugleich als archaisch begriffen, sie sei „tief in uns allen“ und der Ich-Erzähler betont gerade die subjektive Komponente seiner objektiven Angaben, wenn er uns wissen lässt, dass die Farbwerte im konkreten Fall seinen „Eindrücken direkt nach dem Schlag“ entsprechen.
Während die Makroebene des Texts sich die moderne Technik zunutze macht, stuft der Erzähler die Erfahrungswelten seines Protagonisten immer wieder zurück. Etwa das oben zitierte ‚Technicolor‘ bezeichnet nämlich ein Zweifarben-Additivverfahren aus der Anfangsphase des Farbfilms, das dem Roman um rund hundert Jahre hinterherhinkt. Kein Wunder also, dass der Held es immer wieder mit der Angst zu tun bekommt.
Ein narratologischer Krimi
Ähnlich wie das zwischen unterschiedlichen Dimensionen schwankende Prisma der Farben fluktuiert jenes der Figuren, Erzählinstanzen und Zeiteinheiten. Als der an diesem Tag etwas blasse Junge am kobaltblauen Bahnhof mit dem Zug in den Ferien an- bzw. am Morgen von seinem nächtlichen Trip zurückkommt, folgt er vertrauensselig seinem Alter Ego in eine Kreishandlung, die sich zum Psychothriller entwickelt und mit „einem Sonnenaufgang wie aus einem billigen Blockbuster“ (konkret gesprochen in Dunkelrot) abebben wird.
Was bei Ristanovićs Umgang mit Spezialeffekten anders ist, als deren jahrtausendelange Erprobung nahezulegen scheint, ist, dass sein Text gekonnt erzeugte Illusion ungeniert preisgibt. So erfährt man alles über das enge Verhältnis zwischen dem Ich-Erzähler und Gari, der übrigens einen dunklen Teint hat, beiläufig bereits bei deren erster Begegnung. Die fragwürdige Beziehung wird dennoch überzeugend aufgebaut, bis es unter Einforderung strengster Vertraulichkeit des/der Leser_in – und nun auch erst beim zweiten Anlauf – zu detaillierteren Erklärungen über die sie verbindenden Mechanismen kommt, „denn wie mir scheint, wird es langsam äußerst wichtig, dass wir miteinander reden.“
Der Glaube an Gari ist grenzenlos: „Alles war gut eingerichtet und ich habe ihm sofort vertraut.“ Nachdem die beiden am Bahnhof aufeinander gewartet haben, kommunizieren sie beinahe ohne Worte, und überhaupt interessiert den Ich-Erzähler an Gari vorerst hauptsächlich „dessen Wesen sowie die rein äußerlichen Auswirkungen“. Zunächst zum Wesen: Hier kann gesagt werden, dass Gari der Anführer ist und den Protagonisten an dessen Geburtstag, präzise in der Nacht vom sechsten auf den siebten, mitnimmt in das bunte rege Treiben eines Volksfestes mit verschiedenfarbigen Ostereiern, Schießständen, Mädchen und einem Autodrom. Rein äußerlich erfährt man weniger bzw. nur, dass Gari zur Enttäuschung seines vertrauensseligen Gastes bald spurlos verschwindet und diesen auch hier relativ lange auf sich warten lässt, ehe er, scheinbar ohne wesentliche Veränderung, zurückkehrt.
Der Protagonist selbst wirkt, seinen allgemeinen Ansichten nach zu schließen, ebenfalls vernünftig und das Vertrauen, das die Leser_innen zu ihm entwickeln mögen, wird durch Elemente des Skaz noch verstärkt. Bereits das Genre einer nicht ohne Humor erzählten, doch emotional mitreißenden Teenager-Tragödie verbindet diesen Text mit The Catcher in the Rye. À la Holden Caulfield kommen zudem wiederholte Phrasen zum Einsatz, die die Persönlichkeit des Ich-Erzählers illustrieren. Hier schüren diese jedoch keineswegs den Eindruck allgemeiner Verunsicherung; Ristanovićs jugendlicher Protagonist versucht vielmehr, präzise zu sein und bekräftigt dies mit den Phrasen „Wirklich und wahrhaftig sage ich dir“ sowie „Glaube mir“.
Umso mehr muss die Feststellung erschüttern, dass – als freilich die Geheimisse des Texts durch das erwähnte vertrauliche Gespräch längst gelüftet sind –, dieser pedantisch-wache Geist ebenfalls verschwindet, oder zumindest stark in den Hintergrund tritt, man könnte auch sagen, blasser wird. Pure Handlungsfülle überschwemmt das stark strukturierte Gebilde, der Protagonist randaliert im Autodrom und greift sogar zu Maskierung und Luftgewehr. Aus der paratextuellen Distanz der einleitenden Zusammenfassung wird im pastell-leuchtorangen Kapitel, welches den Titel Ausflug trägt, festgehalten, dass der Protagonist dem Autor, zu dessen größtem Bedauern, abhandengekommen sei, und das nur kurz nachdem er Gari bereits abgehängt hat. Vier Kapitel weiter, in etwas dunklerer pastellener Lachsfarbe, wähnen wir ihn auf Basis einer ähnlichen Information wieder im Gesichtsfeld des Autors, wobei allerdings der Aufenthaltsort dieser umtriebigen Figur nach wie vor nicht identifiziert werden kann.
Zwischen Gleichgültigkeit, Strom und Sprache
Eine vergleichbare Reise kennen wir bereits von Venička in Venedikt Erofeevs Moskva – Petuški (Die Reise nach Petuschki), doch wohin führt die hier vorliegende und was veranlasst ihren Helden zum Aufbruch? Das vom Autor selbstgezeichnete Cover bildet die Eckpunkte ab: die Fahrzeuge, das Straßennetz mit steiler Treppe und Abzweigung knapp vorbei an der Sonne, den Gipsquader, ja sogar den Hund, der plötzlich verschwindet und es – durch ‚eindeutige Beweise‘ belegt – dank seines russischen Passes bis nach Australien schafft. Noch wichtiger sind vielleicht die Stromleitungen, die den Körper des gleichgültigen und reuelosen Protagonisten mit spürbarer Elektrizität durchströmen. Dass dieser aus einem späteren Blickwinkel mit Bedauern oder auch Wehmut zurückblickt, verleiht dem Roman zugleich an manchen Stellen zumindest rhetorischen Geständnischarakter. Oben auf einem Hügel dieser Zeichnung finden sich auch die vielen erfundenen Figuren, die sich weigern, mit ihrem Urheber näher in Kontakt zu treten. Und Lila spaziert hier über eine Wiese, Hand in Hand mit der Hauptfigur, beide mit strahlendem Lächeln.
Lila ist in diesem Buch eigentlich nicht wichtig. Lila, die in Wirklichkeit anders heißt und dem Protagonisten zwei oder drei Sommer zuvor die köstlichste Milchkaramelle (so auch die Farbe dieses Kapitels) seiner Kindheit geschenkt hat. An sie denkt er auch, als er auf dem Fahrrad unvermittelt vertikal in die Bewusstlosigkeit stürzt. Ihr wird er davon erzählen, denkt er mit Blut im Mund lächelnd, als es blaugrau wird und dann schwarz. Die Farben sind meist ähnlich, doch nie exakt gleich, überlegt der Ich-Erzähler bereits zu Beginn des Buches mit Blick auf die bevorstehenden Ferien. Stetige Veränderung ist auch das, wogegen er ankämpft, wenn er sich bis zur Reizüberflutung an alles zu erinnern versucht. Dabei färbt sich das Kapitel über die tatsächlichen Zusammenhänge bedrohlich dunkelgrün wie die Uniform von Lilas Vater und noch im schwarzen Kapitel wendet der Protagonist seine letzte Kraft dafür auf, einem Spielzeugsoldaten aus rostfreiem Stahl das Bein abzuschlagen.
Nicht weniger drastisch als die flüchtigen Farben ist allerdings die Willkür der Sprache, denn an ihr erkennt der Erzähler schmerzhaft, dass auch Lila sich verändert hat: „Aus den wunderbaren Kindermündern, die einmal unsere waren, ergossen sich Worte, die ich nicht auszusprechen vermag. Ich hasste diese Worte. Ich hasste sie. Mich. In Wirklichkeit habe ich nicht gehasst, ich war wütend. Auf die Worte, diese veränderte sie, auf mich. Oder es machte mir Angst.“ Reflexion über Sprache findet sich auf ebenso vielen Ebenen wie jene über die Farben und beide erweisen sich in letzter Instanz, die man höchstens erahnen kann, als Spiegel des Unsagbaren, der Gefühle. Obwohl im Rausche des Hochgefühls alles glasklar erscheint und Gedichte sich wie von selbst fügen, verabsäumt der Erzähler ihre Niederschrift. Als er nun in einem schier endlosen Prozess versucht, seiner Erkenntnisse habhaft zu werden, muss er widerstrebend feststellen: „Die Worte waren machtlos, die Stimmen waren machtlos, die Bedeutungen waren machtlos.“ Das Einzige, was bleibt, sind folglich die Farben, und zumindest diese finden sich hier auch tatsächlich in einer absolut präzisen Form.
Manchen Leser_innen mögen die durch bewusstseinserweiternde Substanzen befeuerten Fantasien des Protagonisten mitunter allzu bunt erscheinen. Dessen ungeachtet ist Ristanovićs Roman Vivid, der auf seinen Gedichtband Sutra (2018, ‚Morgen‘) folgt, auf textreflexiver, farbsymbolischer und sprachkritischer Ebene auch eine anregende Lese-Herausforderung. In vielerlei Hinsicht komplexer, als der leichte Plauderton seines Erzählers vermuten ließe, führt er uns an die Grenzen der Sprache, des Denkens und des Texts.


