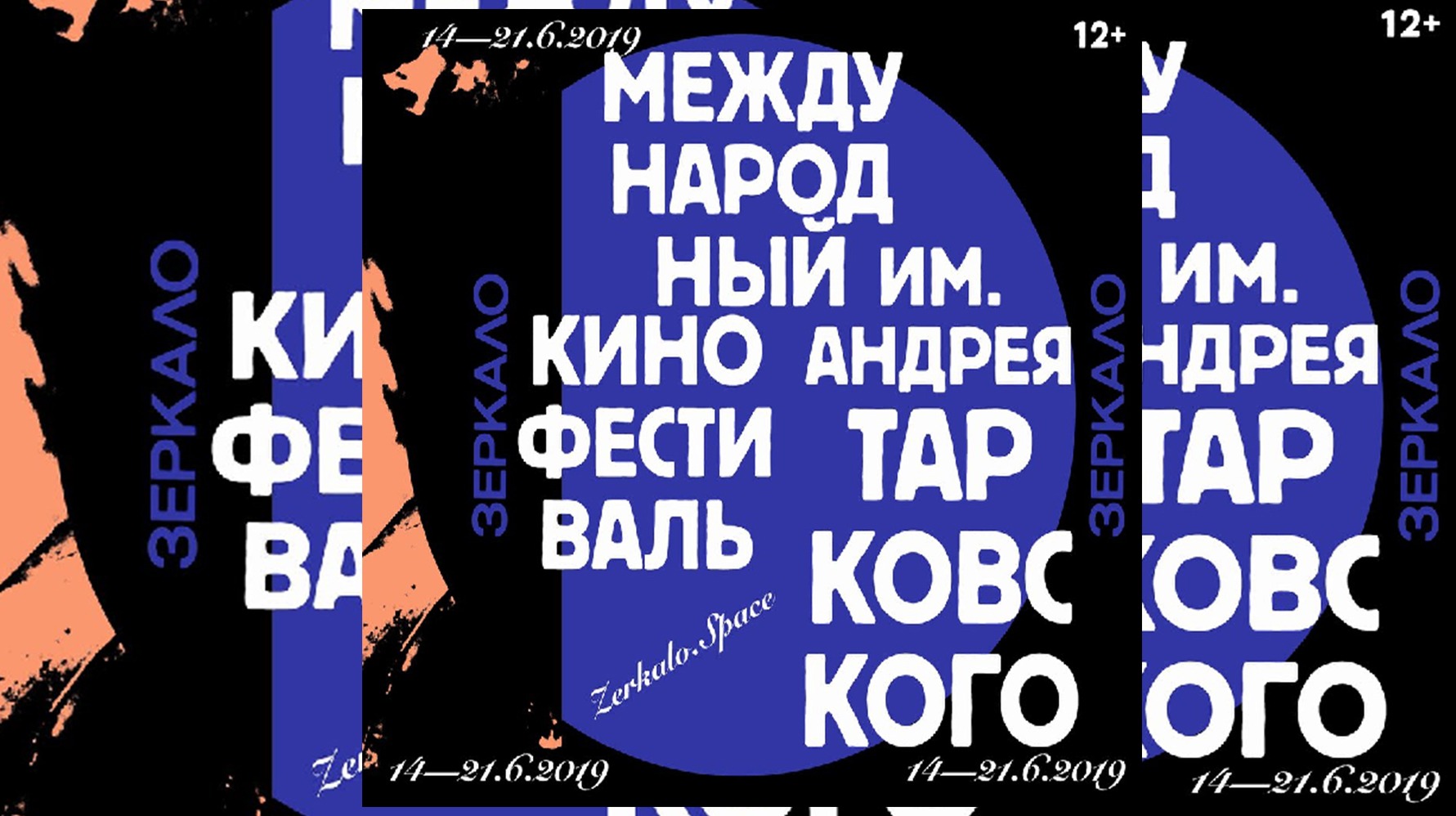
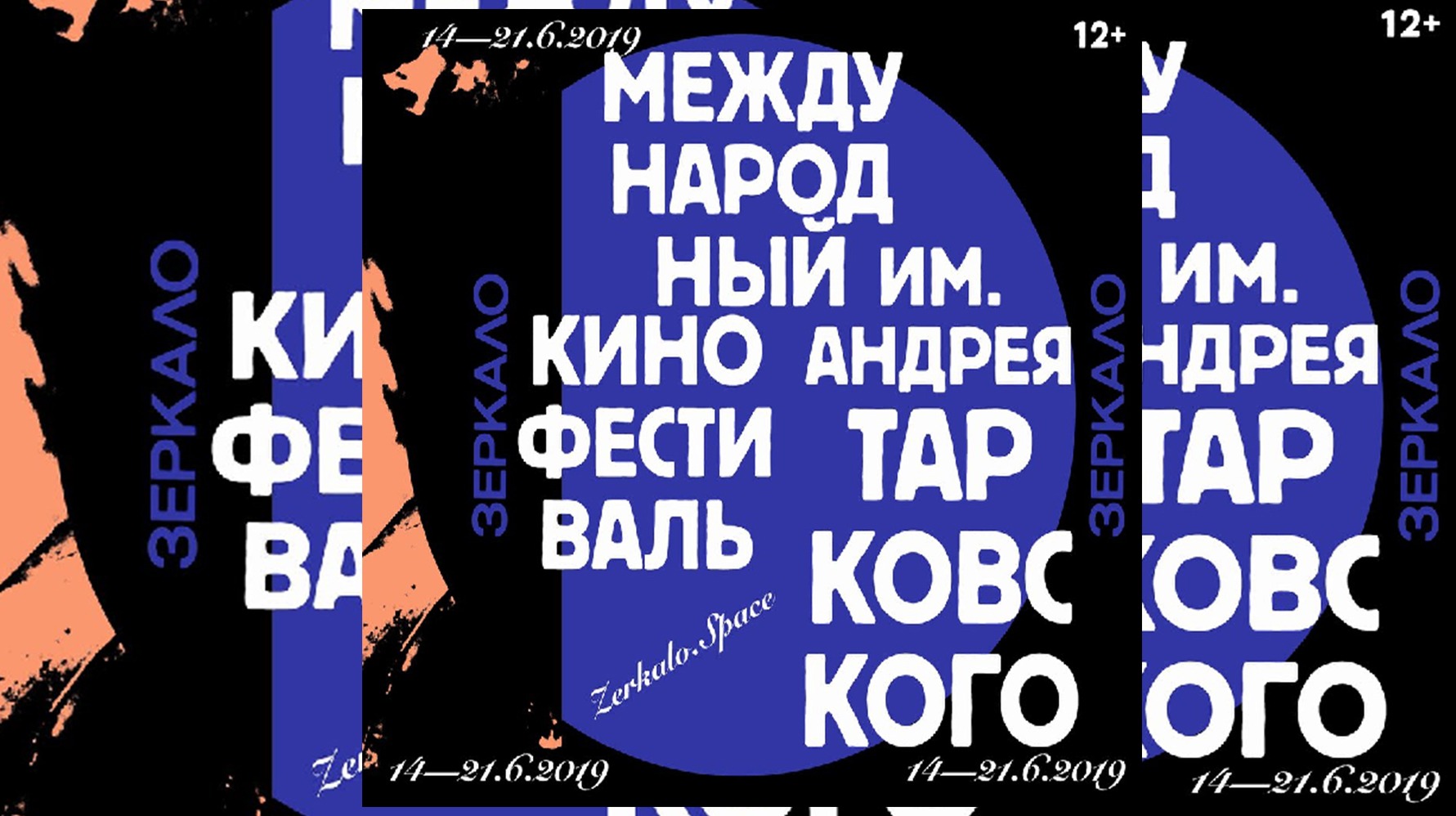
Filmfestival „Zerkalo“: Die russische Peripherie im Fokus
Wie macht man das – ein internationales Filmfestival in einer Stadt, die abseits der kulturellen Zentren Russlands, Moskau und Sankt Petersburg, liegt? Das XIII. Internationale Andrej Tarkovskij Filmfestival, das nach Tarkovskijs Film “Zerkalo” (dt. Spiegel) benannt ist und jährlich in Ivanovo stattfindet, hat im vergangenen Juni bewiesen, dass dies sehr wohl möglich ist – dank des leidenschaftlichen Einsatzes eines neu aufgestellten Festivalteams aus St. Petersburg und unter Einschluss einer engagierten lokalen Kulturszene.
Ivanovo. „Ich brenne für das russische zeitgenössische Kino“, sagt Aleksej Krymov, Jurymitglied des Kinofestivals in der auf das nationale russische Kino konzentrierten Sektion Svoi (dt. Unsere) und Betreiber einer angesagten Bar in Ivanovo, während symphonische Orchesterklänge mit E‑Gitarren-Verstärkung über den Dorfplatz von Jur’evec schallen. Hier, in einem Dorf an der Volga, gut dreihundert Kilometer von Moskau entfernt, wo Kultregisseur Andrej Tarkovskij seine Kindheit verbracht hat, feiern einige hundert Festivalgäste und Dorfbewohner_innen die Eröffnung des Filmfestivals „Zerkalo“.
In seiner Bar „Tesno“, die sich bei Nacht in den einzigen Technoclub der 400.000 Einwohner_innen-Stadt Ivanovo verwandelt, zeigt Aleksej regelmäßig – unabhängig vom Festivalgeschehen – russische Filme. Bei freiem Eintritt und ohne Lizenz, wie der Anfang Dreißigjährige selbst sagt. „Das Festival tut der Stadt gut. Das Wichtigste ist doch, dass es den Leuten gefällt“, meint er.


„Ein Festival für die Menschen, für die Stadt“
Und das sei nicht immer so gewesen. Lange Jahre hatte man das Festival weniger für die Menschen aus der Oblast′ Ivanovo, als für die Elite der russischen Kulturlandschaft organisiert: Einmal im Jahr verlagerte ein geschlossener Expert_innenkreis seine Gespräche zum zeitgenössischen Kino aus der Hauptstadt in die russische Peripherie, ohne sich dabei für ein lokales Publikum zu öffnen. Nicht in Ivanovo, sondern in der Nachbarstadt Pl’os trafen sich die privilegierten Festivalgäste – in einer Stadt, die bekannt dafür ist, dass sich hier Datschen reicher Businessleute und Verbeamteter dicht an dicht aneinanderreihen.
„Als wir das Festival vor zwei Jahren übernommen haben, lag diese Stimmung in der Luft, ein Festival für die Menschen zu machen, für die Stadt“, erzählt Festivalproduzentin Saša Achmadšina auf dem Weg in die Festival-Location in Ivanovo, das Kino „Lodz“. Wer in diesen Juni-Tagen mit Gästen aus der Region über das Festival spricht, erfährt, dass „Zerkalo“noch immer der Ruf anhaftet, ein verschlossenes und elitäres Kulturevent zu sein – eine Altlast der ersten elf Festivaleditionen.


Anar Imanov, Slawist und Ko-Drehbuchautor des im Rahmen des Festivals zweifach preisgekrönten Films End of Season („Young Film Critics Award“ und „Professional Achievement Award“), der beim internationalen Filmfestival in Rotterdam 2019 den FIPRESCI-Preis erhalten hatte, betont, dass das Filmfestival den Menschen die besondere Gelegenheit biete, ihre Stadt aus den Augen der Filmschaffenden zu betrachten – es eröffne neue Perspektiven. „Ivanovo wartet mit einem unerwarteten kulturellen, historischen Reichtum auf. Es ist eine Stadt der Mythen, die dazu einladen, wiederentdeckt und weitergedacht zu werden.“ Imanov nennt dieses Phänomen in Anlehnung an den Tarkovskij’schen Festivalnamen „Spiegeleffekt“: Ivanovo werde zu einem Ort der Imagination – eine Stadt, in der die Zuschauer Teil eines fiktiven Raums werden können. Das sei nicht überall möglich.
Ivanovo – Stadt der zwei Architekturen
Das heterogene Stadtbild Ivanovos mag beim ersten Hinsehen weniger reizvoll erscheinen, als das denkmalgeschützte, malerisch auf einer Anhöhe am rechten Volga-Ufer gelegene Pl’os: Fabrikarchitekturen aus Backstein vermischen sich mit sowjetischen Plattenbauten und neueren Interpretationen derselben. Hier und da schälen sich archaische Türme orthodoxer Kirchen aus den Hinterhöfen, während schrill-glänzende sakrale Neubauten den zentralen Plätzen der Stadt ihren Stempel aufsetzen.
Auf einem Stadtspaziergang mit einer Gruppe internationaler Festivalgäste entschlüsselt Michail Timofeev, Experte für die lokale Stadtarchitektur und Philosophieprofessor an der Staatlichen Universität von Ivanovo, diese urbane Assemblage. Zwar sei Ivanovo Teil des „Goldenen Rings“, gleichzeitig unterscheide sich die Industriestadt substanziell von den übrigen Städten der beliebten Reiseroute. Anders als das sich nordöstlich von Moskau erstreckende historische Städte-Netz – ehemals Einzugsgebiet der Nordost-Rus’ – ist Ivanovo eben nicht gespickt von altrussischen Kathedralen mit ihren charakteristischen Glockentürmen.


Zwei Architekturen verleihen der „Zerkalo“-Stadt seinen eigenwilligen Charakter, verweisen auf die beiden prägenden Erzählungen der Stadtgeschichte, die sich diskursiv wie materiell durch den Stadtraum ziehen – von Ivanovos Beinamen „Stadt der Bräute“ (russ. „Gorod nevest“) und „Stadt des ersten Sowjets“ (russ. „Gorod pervogo soveta“) überschrieben. Rote Fabrik- und Backsteinbauten und herrschaftliche neoklassizistische Stadtvillen zeugen einerseits vom vergangenen Ruhm der Stadt als Zentrum der russischen Textilindustrie. Andererseits ist der Stadtraum von eindrücklichen Avantgardearchitekturen durchsetzt: Arbeiterhäuser, Schulen und Theater, Hotels und institutionelle Einrichtungen im Stile des Konstruktivismus erinnern daran, dass Ivanovo in den Geschichtsbüchern einst als „Dritte proletarische Hauptstadt“ geführt wurde. Timofeev hebt die sogenannten „Metapher-Häuser“ als Perlen des Ivanovo-Voznesensker Konstruktivismus hervor, so etwa das Schiff- oder das Vogelhaus.


„Die junge Generation muss merken, dass sie etwas verändern kann“
„Für einige Tage stehen ausnahmsweise die armen Provinzen an der Peripherie im Zentrum des kulturellen Geschehens“, sagt Achmadšina, während die veralteten Motoren der im Stau stehenden Kleinbusse, genannt Maršrutkas, rattern und ihre Stimme zu übertönen drohen. „Es kommen Besucher aus der Region und aus anderen Städten; man hört sich gegenseitig zu, tauscht sich aus.“ Als Stanislav Voskresenskij, neuer Gouverneur der Oblast′ Ivanovo, vor zwei Jahren verkündete, das Filmfestival „Zerkalo“müsse erneuert werden – aus dem intellektuellen Treff sollte ein für alle zugängliches, egalitäres Kulturereignis werden –, fiel die Wahl auf Ivanovo als passende Spielstätte, weil es im Gegensatz zu Pl’os eben soziale Demokratie und – bei internationaler Ausrichtung – den Willen zur Interaktion mit der lokalen Kulturszene signalisierte.
„Hier in Ivanovo gibt es eine tolle Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden“, sagt Achmadšina. Ihnen sei viel daran gelegen, dass es ein urbanes Filmfestival mit anspruchsvollem Programm gebe, das dem Niveau vergleichbarer europäischer Filmfestivals entspreche. „In St. Petersburg gibt es diesen Dialog mit der Stadt praktisch nicht, dort ist alles komplizierter.“
Die Öffnung der Festival-Veranstaltungen für ein heterogenes Publikum sowie die regionale Kreativen- Förderung sind grundlegende Bausteine des Festivalreglements, seitdem das St. Petersburger Kollektiv um Konstantin Šavlovskij, Achmadšina & Сo. die Produktion übernommen hat. Damit trifft das Filmfestival einen Nerv der Zeit: Filmfestivals auf der ganzen Welt öffnen sich verstärkt für junges Publikum und potenziellen Nachwuchs aus der Branche, in diesem Jahr etwa das Filmfestival in Locarno mit einem „Base Camp“ für junge Kreative, einem Raum für Austausch und Experimente.
Staatliche Finanzierung, (noch) keine Zensur
Dass das Festival-Budget von staatlichen Geldern getragen werde – vom Kulturministerium der Russischen Föderation und von der regionalen Regierung der Oblast′ Ivanovo nämlich – werde in Deutschland natürlich nicht gerne gehört. „Faktisch entscheiden wir aber alles selbst“, sagt Achmadšina über die Kuration des Festival-Programms, welcher Andrej Plachov als Programmdirektor vorsteht. „Von den Förderern kommt nur das Geld. Gott sei Dank, noch kontrollieren sie das Festival-Programm nicht, es gibt keine Zensur.“
Wichtiger Akteur ist dabei „Russian Seasons“,ein Projekt der russischen Regierung, das Veranstaltungen fördert, welche die russische Kultur – der Gegenwart, aber auch ihre (post-)sowjetische Vergangenheit – zum Inhalt haben. „Russian Seasons“ basiert unter anderem auf der ausgezeichneten Idee, dass es junge Menschen braucht, die sich mit der russischen Kultur beschäftigen. Dieser Dialog ist wichtig“, betont Achmadšina. So konnte auch der Festivalbesuch einer Gruppe von Slawistik-Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin und Filmexpert_innen aus Berlin finanziert werden.
Anders sehen und denken lernen – abseits des Nachrichtenstroms
„Die junge Generation soll merken, dass sie wichtig ist, gesehen wird und etwas verändern kann. Wenn man Filme macht, ist das möglich – man kann seine Optik verbessern, ‚Anders Sehen‘ lernen und versuchen, den Blickwinkel zu erweitern“, sagt die Festivalproduzentin. Deshalb gibt es in Ivanovo seit vergangenem Jahr parallel zum offiziellen Festivalprogramm einen „Doku-Campus“, der sich am Lehrprogramm der Moskauer Schule für Dokumentationsfilm von Marina Razbežkina orientiert, in diesem Jahr kam noch ein „Animationsfilm-Campus“ dazu. Jugendliche aus dem Gebiet zwischen den Flüssen Volga und Oka werden im Auswahlverfahren um die Campus-Plätze bevorzugt.
Einen hohen inhaltlichen Anspruch mit der Integration der lokalen Kulturszene zu vereinen – das scheint ein Hauptziel der neuen Festivalmacher_innen zu sein. „Für Ivanovo ist ‚Zerkalo‘das einzige kulturelle Ereignis im Jahr und die einzige Möglichkeit für die Menschen, mal etwas anderes zu sehen – anders zu sehen und zu denken.“ Normalerweise lebten sie in einem Nachrichtenstrom, der vor allem Intoleranz verbreite, Propaganda gegen LGBT, so Achmadšina. „Einzusehen, dass Ivanovo auch eine Stadt sein kann, in der geduldig, umsichtig und tolerant miteinander umgegangen wird – das wäre wichtig.“
Sokurov-Schüler Balagov und Zolotuchin – international geehrt
Nach fünf intensiven Festivaltagen, die neben Filmscreenings auch kostenlose Vorträge, moderierte Gespräche mit den Filmemacher_innen und im Begleitprogramm eine Festivalakademie sowie eine internationale wissenschaftliche Konferenz zum Werk des Festival-Namensgebers Andrej Tarkovskij boten, steht fest: Zum zweiten Mal gewinnt ein Schüler Aleksandr Sokurovs, Kantemir Balagov, den „Zerkalo“-Hauptpreis. Vor zwei Jahren war bereits sein Film Tesnota (dt. Enge) ausgezeichnet worden, dessen Handlung Balagov in der Hauptstadt der Republik Kabarino-Balkarien Nal’chik im Nordkaukasus angelegt hatte, wo der Jungregisseur selbst damals auch lebte und wo er die von Sokurov geleitete Filmschule besuchtе. Ein im Grunde ähnliches Projekt zur Kulturförderung in der russischen Provinz wie auch das Festival in Ivanovo.
Sein neuer Film Dylda (dt. Bohnenstange)spielt im traumatisierten Nachkriegs-Leningrad, in den von Veteranen aufgesuchten Lazarettkorridoren. In dieser Umgebung träumen die beiden weiblichen Hauptfiguren, die vom Krieg gezeichnete Bohnenstange Ila und ihre Freundin Maša, von einem anderen Leben, einer anderen Zeit. Dylda sei weniger Kino über Leningrad im Nachkriegschaos, so fasste es eine Kritikerin in der „Novaja Gazeta“zusammen, als vielmehr eines über die Frau – mit großem Anfangsbuchstaben – als „Urquelle“ des Lebens und des Friedens („pro Ženščinu kak pervoosnovu mira (kak world, kak i peace“). Dylda hatte in Cannes in der Sektion „Un Certain Regard“ seine internationale Premiere gefeiert und war dort nicht nur mit dem Preis für die beste Regie, sondern zusätzlich mit dem FIPRESCI-Preis ausgezeichnet worden. Nun wird er als russischer Vertreter ins Rennen um den Oskar in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ geschickt.
In der „Zerkalo“-Sektion „Svoi“gewann mit Mal’čik russkij (dt. Ein russischer Junge) von Aleksandr Zolotuchin, ebenfalls ein Schüler der Sokurov-Filmakademie in Nal’cik, den Publikumspreis. Zwei Handlungslinien laufen in seinem Debütfilm parallel und werden kunstvoll in der Montage verwoben: Da ist zum einen die Geschichte eines russischen Dorfjungen, der sich im Ersten Weltkrieg freiwillig zur Front meldet, in einem Gasangriff sein Augenlicht verliert und fortan als „Lauscher“ in einer speziellen Vorrichtung die anderen Soldaten vor sich nähernden Flugzeugen warnt; zum anderen die dokumentarischen Filmaufnahmen der Probenarbeit des Tavričeskij-Orchesters im zeitgenössischen St. Petersburg. Indem auf das Kriegssujet des Jahres 1914 die orchestrale Tonspur des 3. Rachmaninov-Konzerts und seiner Tänze gelegt wird, befinden sich die Gegenwart und die große Katastrophe des Ersten Weltkriegs in direktem, akustisch-räumlichen Bezug zueinander. Im Februar im „Forum“ der Berlinale dem Publikum vorgestellt, wurde auch Zolotuchins einprägsame Skizze des Ein russischer Junge international hochgelobt und mehrfach prämiert. Die Auszeichnungen in der ‚Heimat‘, sowohl beim nationalen russischen Filmfestival „Kinotavr“ in Soči, wo Zolotuchin von der Filmkritiker-Gilde geehrt wurde, als auch in Ivanovo – vom Publikum – sind in diesem Fall sicherlich sogar mehr wert. Sie verweisen auf eine junge russische Film- und Kulturszene, die auch jenseits der Festivals in Cannes, Venedig und Berlin und jenseits der Metropolen Moskau und Sankt-Petersburg angekommen ist. In Ivanovo nämlich – bei einem Festival, das zwar für ein anderes, junges Russland steht, aber eines, das sich seiner Traditionslinien und künstlerischen Ahnherren sehr wohl bewusst ist.


