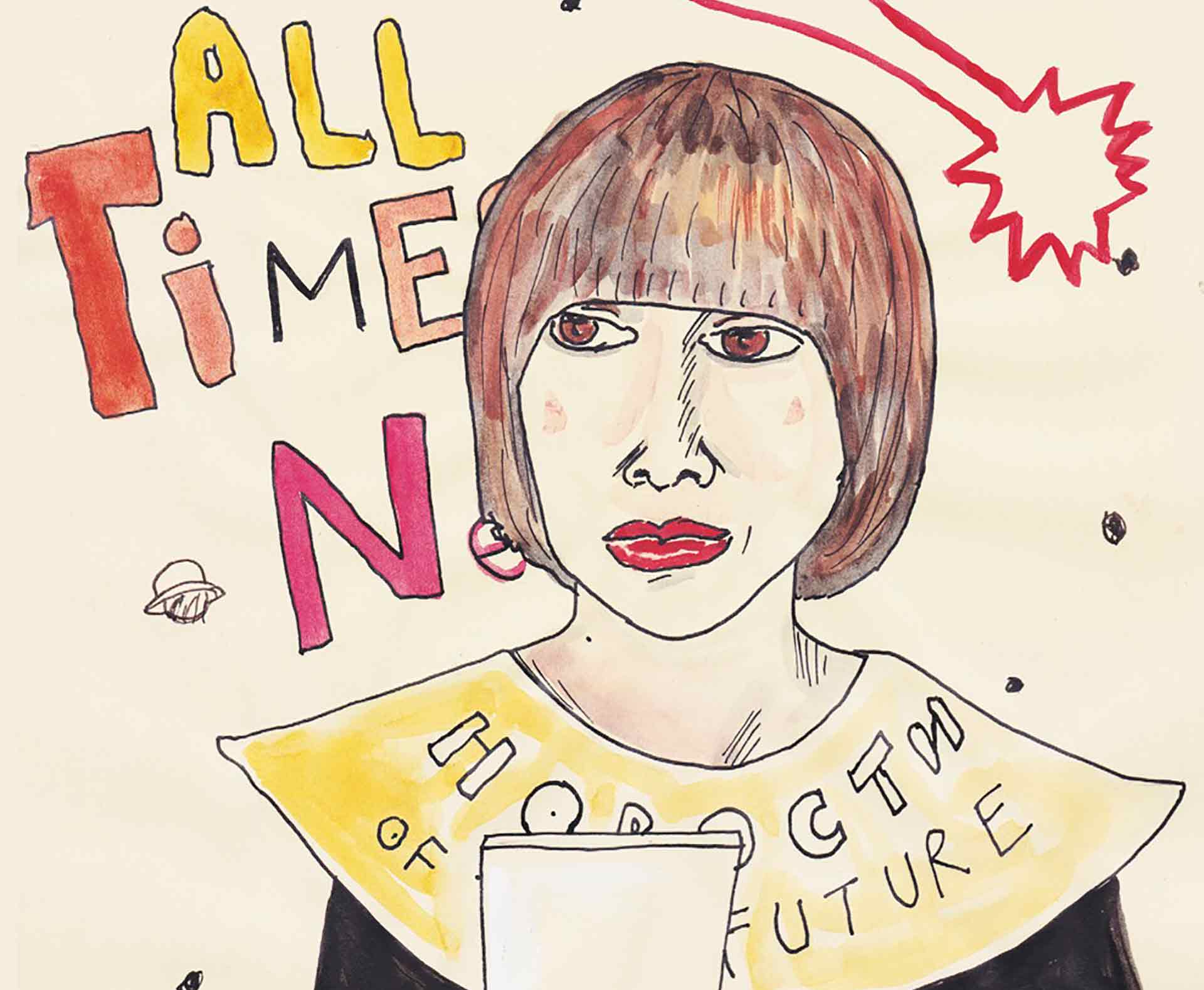
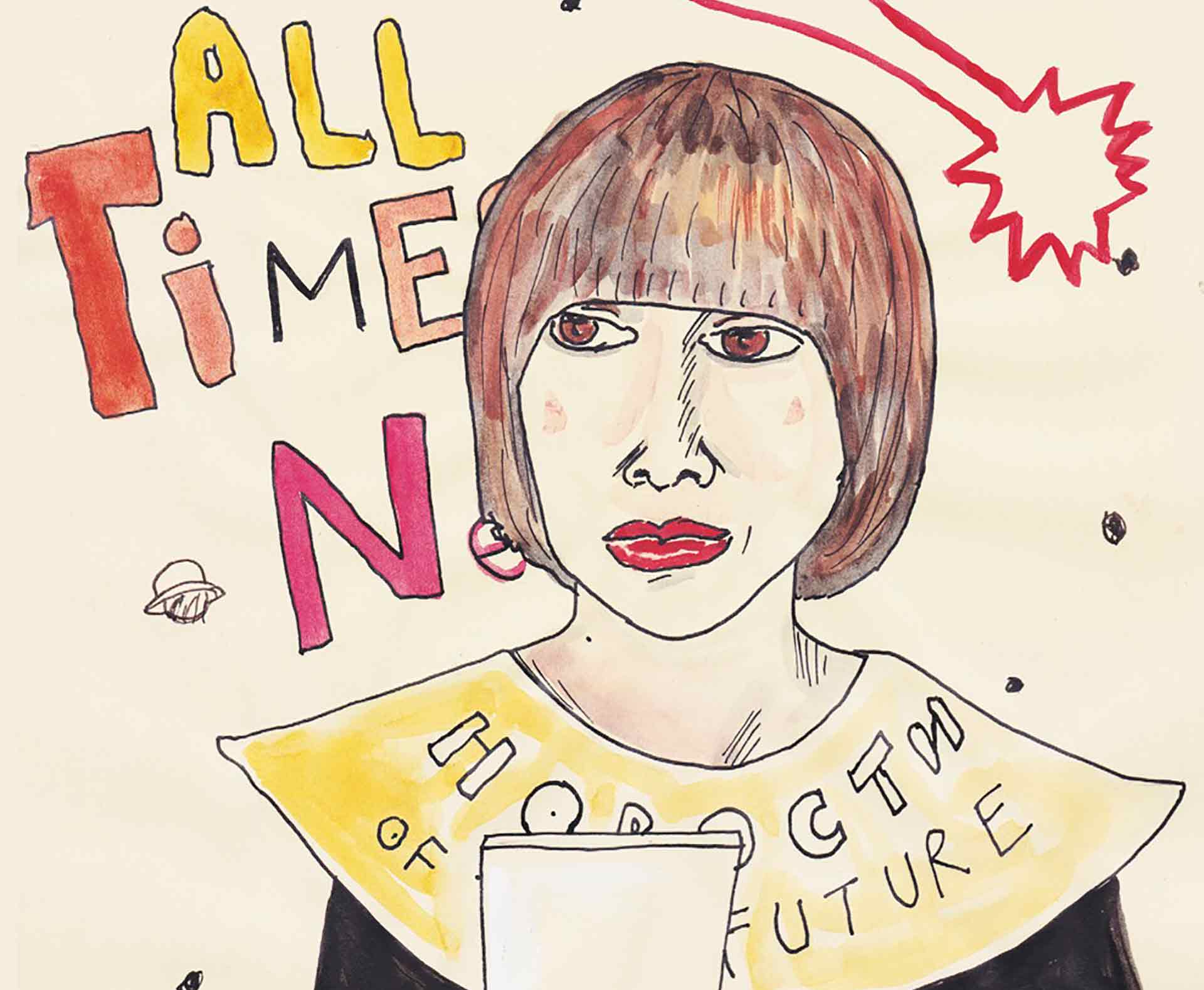
„Wo immer du auch hingehst – deine Erinnerung wirst du mitnehmen.“
Alevtina Kakhidze im Interview mit Teilnehmerinnen der Projektseminargruppe „Das Potential des Ästhetischen im Kontext von Krise und Krieg“ (Berlin, 13. Juni 2015)
Alevtina Kakhidze, eine ukrainische Künstlerin mit georgischen Wurzeln, wuchs in der russischsprachigen Donbass-Region unweit des Heimatortes von Ex-Präsident Viktor Janukovič auf. Mit siebzehn Jahren, kurz vor Auflösung der Sowjetunion, verließ sie ihr Heimatdorf, um später in Kiev an der Nationalen Akademie der Bildenden Künste und in den Niederlanden zu studieren.
In ihren meistens performativen Arbeiten, aber auch in den bildnerischen und schriftstellerischen Werken oder Installationen zeigt Kakhidze die Möglichkeiten einer aktiven Reflexion und Intervention durch Kunst. Sie setzt sich kritisch mit der postsozialistischen politischen und gesellschaftlichen Realität der Ukraine auseinander und tritt als scharfe Beobachterin neokapitalistischer Auswüchse auf.
Viel Beachtung bekamen Kakhidzes Performance im Privatjet eines ukrainischen Oligarchen, bei der sie ankündigte, die Erde aus dieser Sicht zu zeichnen, ihre auf der 7. Berlin-Biennale gezeigten 500 Zeichnungen von begehrten Luxus-Objekten, denen sie denselben Wert zuschrieb wie den tatsächlichen Objekten, oder die auf der Manifesta 2014 in Petersburg inszenierte Pressekonferenz unter dem Titel Sieg über die Elektrizität.
Alevtina Kakhidze nahm zugleich künstlerisch und politisch an den Majdanprotesten von 2013–2014 teil. Ihre aktive Beteiligung stand für sie im Zeichen einer neuen gesellschaftlichen Diskursbildung und des zivilgesellschaftlichen Kampfes gegen überkommene Deutungshoheiten. In ihren Arbeiten über den Majdan und den Krieg im Osten der Ukraine thematisiert Alevtina Kakhidze immer wieder die Wechselwirkungen von Erinnerung, Information und vielschichtigen Identitätsbildungsprozessen.


Mit der Berliner Projektseminargruppe unterhielt sich Alevtina Kakhidze nicht nur über den Majdan als Performance, sondern auch darüber, wie sich Information und Wissen als Gegenstände der Performance-Kunst eignen und wie wichtig die künstlerische Reflexion über gemeinsame Erinnerung ist.
novinki: Du warst von Anfang an und die ganze Zeit beim Majdan dabei. Wie schätzt Du den Majdan gerade aus deiner Perspektive als Künstlerin ein?
Alevtina Kakhidze: Ich würde sagen, jegliche aktive Beteiligung am Protest war hilfreich. Aber gerade künstlerisches Engagement war besonders wichtig, da der Majdan nach Innovation verlangte. Wenn es keine Innovationen in der Form gibt, kommt man auch mit neuen Inhalten nicht voran. Zum Beispiel haben Intellektuelle und KünstlerInnen bewirkt, dass es auf dem Majdan nicht nur eine Bühne für politische Reden gibt, sondern auch eine für Lesungen. Schon die offene Äußerung, dass politische Reden allein nicht ausreichen, war innovativ, die tatsächliche zweite Bühne dann umso mehr.
n.: Am Anfang war der Majdan friedlich. Hat sich die künstlerische Dimension mit der aufkommenden Gewalt verändert?
A.K.: Alle KünstlerInnen waren auf dem Majdan auch AktivistInnen, nicht immer standen künstlerische Aktivitäten im Vordergrund. Ich erinnere mich, dass ich als Aktivistin Essen dorthin gebracht habe, später auch Medikamente. Wir versuchten uns mit anderen AktivistInnen zu organisieren, fragten in die Runde, was die Leute wirklich brauchen. So haben wir zum Beispiel erfahren, dass kugelsichere Westen benötigt werden. Daraufhin setzten sich KünstlerInnen und DesignerInnen zusammen und entwarfen solche Westen – circa 35 bis 40 Stück.
n.: Die Situationisten der 1960er Jahre sahen – ganz in der Tradition der Avantgarde – Kunst bzw. Performance und Revolution als Einheit und hatten ein sehr politisches Kunstverständnis. Wie würdest Du in Bezug auf den Majdan dieses Verhältnis von Performance und Revolution beschreiben?
A.K.: Sehr viele KünstlerInnen haben den Majdan unterstützt, eigentlich alle, die ich kenne. Wenn man den Majdan und seine Darstellung in den Medien aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, wird man sehen, dass es um Bilder und Texte geht. Sobald man jedoch versucht, ein kohärentes Bild in all diesen Fragmenten der Repräsentation zu erkennen, wird es schwierig. Schließlich ist er kein (Gesamt-)Kunstwerk. Die ästhetische und die performative Dimension haben nicht nur mit der Beteiligung von KünstlerInnen zu tun. Es gab auch Kinder, die auf dem Majdan Bilder gemalt haben. Ich würde sagen, dass die KünstlerInnen in vieler Hinsicht ImpulsgeberInnen waren. Namhafte Personen haben angefangen zu malen – aber viele andere eben auch. Interessant ist der Unterschied zwischen dem nicht-staatlichen Majdan und dem staatlichen Anti-Majdan: Der „Unabhängige Platz“ war sehr kreativ und dynamisch, der Anti-Majdan aber hatte nicht dieses Potential. Da konnte keine kreative Energie entstehen, weil die Leute einfach Plakate zugeteilt bekamen.
n.: Aber wie konnten so viele unterschiedliche Arten von ästhetischer Kreativität auf dem Majdan Synergien erzeugen? Wie passt das alles überhaupt zusammen?
A.K.: Es passt zusammen, Innovation ist das Bindeglied.
Viele Leute haben protestiert, weil Janukovič dieses umstrittene Abkommen nicht unterschrieben hatte. Was das aber genau für ein Dokument war, wussten die wenigsten. Ich kam auf die Idee, einen Juristen aus dem Übersetzerbüro der Regierung einzuladen, um uns den Inhalt – über den es viele Gerüchte gab – in einer offenen Runde zu erläutern. Der Jurist brachte das zweitausendseitige (!) Dokument in einem Koffer mit und beantwortete sämtliche Fragen. Eigentlich ging es zu 95 Prozent um ökonomische Veränderungen, nur ein kleiner Teil betraf politische Umgestaltungen. Genau das haben wir thematisiert.
Das war auch Innovation – Wissen und präzise Informationen an die Leute weitergeben zu können, die an den Protesten teilnahmen und unter der unsicheren Situation litten. Sie brauchten Gewissheit. Für mich ist das auch ein künstlerischer Weg, weil es mehr ist als nur ein Papier herauszugeben. Wir könnten es als Happening bezeichnen. Das war einer meiner Beiträge zum Majdan.
Es gab auch viele andere kreative Beiträge, auf die sogar wir KünstlerInnen neidisch waren, weil sie großes Potential hatten. Konkret erinnere ich mich beispielsweise an die Frauengruppe, die den Polizisten Spiegel vorhielt, damit sie ihre eigenen verkniffenen Gesichter sehen konnten. Das war eine wundervolle Performance. Oder es gab in der Presse dieses Foto – vielleicht habt Ihr es gesehen –, das einen Musiker zeigt, der vor dem Polizeispalier Klavier spielt. Vor der Macht sieht man einen Akt der Kultur.
Der Majdan brauchte verschiedene Leute – auch um über ihn zu sprechen. Geschäftsleute kamen zum Protest, weil das Regime von Janukovič ihnen die Arbeit unnötig erschwerte. Auch Intellektuelle nahmen daran teil, aus Enttäuschung darüber, dass sie ihre Projekte unter dieser Regierung nicht umsetzen konnten. Allgemein waren viele dort – sogar die NationalistInnen – und auch die Generation der Großeltern beteiligte sich. Die Politik hat etwas versprochen und es nicht gehalten. Das war der zentrale Beweggrund, der alle zusammenbrachte.
n.: Du bist bildende Künstlerin, machst Performances, aber Du schreibst auch viele, fast immer dokumentarische, Texte. Wie ordnest Du dich zwischen den Medien ein?
A.K.: Ich bin emanzipiert, was den Umgang mit Medien anbelangt. Manchmal werde ich als Autorin bezeichnet, aber das ist nur ein Teil meines Schaffens. Ich schreibe gerne, aber ich komme eher aus der bildenden Kunst, ich zeichne auch und arbeite als Performance-Künstlerin. Das Geschriebene verwende ich für meine Performances.
n.: Wie haben sich die Ereignisse der letzten anderthalb Jahre auf deinen Stil und auf die Wahl deiner künstlerischen Medien ausgewirkt? Gab es eine Veränderung? Musstest Du nach einer neuen Sprache suchen?
A.K.: Für mich war diese Zeit dramatisch – meine Mutter ist noch immer im umkämpften Gebiet und kann diesen Ort nicht verlassen. Ich war auf dem Majdan. Seither treffe ich überall Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, vielleicht auch in einem Café wie diesem, weit weg von allem, was ich erlebt habe und durch den ständigen Kontakt mit meiner Mutter erlebe… und dann kommt man nach Hause. Das ist sehr hart. Ich habe beschlossen, nicht ironisch zu werden, sondern einfach reflektiert, und mit ein wenig Humor.
n.: Wieso ist Humor so wichtig?
A.K.: Er hält dich gesund. Und er unterscheidet uns von den Tieren, die können weder Ironie noch Humor hervorbringen. Humor lässt dich die Dinge aus der Distanz betrachten und hindert dich daran, pathetisch oder nationalistisch zu werden. Du bist dann nur noch auf eine Sache fokussiert und vergisst die anderen. Ein Text zum Beispiel sollte aus der Perspektive der einfachen Leute erzählt werden. Ich berichte, was ihnen passiert.
n.: Du kommst aus dem Donbass, bist in Ždanovka aufgewachsen und hast die gesamte Schulzeit in diesem Ort (unweit des Wohnsitzes von Janukovič) verbracht. Mit siebzehn bist Du von dort weg und hast dann zum Teil im Ausland (im holländischen Maastricht) studiert. Heute lebst Du wieder auf dem Land, aber nicht mehr in Ždanovka. Welches Verhältnis hast Du heute zu diesem Ort?
A.K.: Als ich noch in den Niederlanden studierte, tippte ich einmal während einer Internetrecherche „Ždanovka” – den Namen des Orts, wo meine Mutter nach wie vor lebt – ein. Mir wurde bewusst, dass zwanzig weitere Orte auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion genauso heißen. Ich stellte fest, dass es kaum möglich war, zwischen diesen verschiedenen „Ždanovkas“ zu unterscheiden. Aber eigentlich ist das logisch, denn Ždanovka ist offensichtlich vom kommunistischen Anführer Ždanov abgeleitet. „Ždanovka“ ist eher der Name für einen Typus von Ort, benannt nach einem angeblichen Beschützer des Volkes, der ein harter Kerl gewesen sein soll. Viele kleine Orte wurden nach ihm benannt. Heute wird in den Selbstdarstellungen dieser Orte bevorzugt geschrieben, dass „Ždanovka“ von „ždat‘“ (warten) komme.
Ebenfalls interessant ist, dass in der Gegend, in der meine Mutter lebt, Untersuchungen durchgeführt wurden, die darauf hinweisen, dass es dort ein Gasvorkommen gibt: Schiefergas, das zur Gewinnung alternativer Energie verwendet werden kann. Aber um an dieses Gas zu kommen, müsste sehr viel Geld investiert werden. Derzeit läuft eine internationale Debatte zu diesem Thema – die USA sind auch daran beteiligt. Um die nötige Infrastruktur zu schaffen, bräuchte es einen Investor. Aber leider ist im Moment nicht klar, was dort in Zukunft passieren wird. Politische Stabilität wäre eine wichtige Voraussetzung, um einen Finanz- und Investmentplan zu erstellen. Erst muss es wieder friedlich werden, muss der Krieg aufhören.
n.: Du bist russischsprachig in einem dominant russischsprachigen Gebiet aufgewachsen. Wie wichtig ist die Sprache bzw. sprachliche Zugehörigkeit in der momentanen Kriegssituation?
A.K.: Sprache ist nicht das Hauptproblem. Aufgrund meiner Herkunft werde ich oft mit Mitleid überschüttet. Aber Mitleid gegenüber Leuten, die aus Kriegsgebieten kommen, ist nicht das Richtige. Mitleid gibt vor, etwas zu wissen, wo man gar nichts weiß. Wir sollten das Wissen und die Erfahrungen der Leute im Kriegsgebiet respektieren. Eine Schwierigkeit ist auch die Informationsflut. Man müsste täglich mehrere Stunden Nachrichten schauen, um wirklich auf dem Laufenden zu sein. Und wenn ich in anderen Ländern bin, weiß ich, dass mir mit großer Wahrscheinlichkeit die Frage gestellt wird, wer denn die Schuld an diesem Konflikt habe. Ich bin Künstlerin, keine Ministerin.
n.: Du interessierst dich als Künstlerin schon seit Jahren für den Donbass, die Region deiner Herkunft. 2006 schon hast Du ein Büchlein über „Ždanovka“ veröffentlicht. Zugleich warst Du von Anfang an eine sehr international orientierte Künstlerin, die oft auf Klassiker der Moderne wie z.B. Joseph Beuys verweist. Du behandelst lokale Themen mit einer international sehr gut vermittelbaren künstlerischen Sprache. Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden? Wie hat sie sich entwickelt? Und wie hat man in deiner Heimatstadt darauf reagiert?
A.K.: In den Niederlanden kann man Bücher zu jeder kleineren Stadt finden. Über meinen Heimatort gab es nie solche Bücher – also musste ich eins machen. Ins Englische ist es übersetzt, weil die Leute an der Akademie wissen wollten, was ich mache, und natürlich kein Russisch konnten. Im Nachhinein kann ich sagen, dass das keine schlechte Strategie war. Ich nahm alle Texte, die ich zu „Ždanovka” gesammelt hatte, und vermischte sie mit meinen Kindheitserinnerungen. Zur Beschreibung eines bewachten Denkmals konnte ich mich beispielsweise daran erinnern, dass wir dort immer Blumen niedergelegt haben, wenn an der Schule eine Abschlussfeier war. Wenn man etwas liest, hat man auch immer bestimmte Assoziationen. Und wenn man einmal an einem Ort war, dann ist er auch ein Ort in deiner Erinnerung. Ich habe dieses modernistische Buch gemacht, weil ich die Dinge, die ich gefunden, und die Dinge, die ich bereits geschrieben hatte, zusammen bringen wollte. Danach habe ich das Buch der Bücherei in ‚meinem’ Ždanovka angeboten, aber sie sagten mir, dass es nicht zu den Büchern gehöre, die sie suchen. Es sei ein wenig depressiv und nicht über die Hauptstadt, deswegen wollten sie es nicht ins Regal stellen. Natürlich konnte man mir das so sagen, ich bin schließlich erwachsen und kann Absagen ertragen (lächelt), aber diese verständnislose Reaktion schmälerte doch meine Sympathie für die Leute, die dort nach wie vor arbeiten.
n.: Hast Du eine Mission als Künstlerin? Wie würdest Du die Aufgabe, die Du dir als Künstlerin stellst, beschreiben?
A.K.: Meine Arbeit berührt viele Punkte. Die wichtigsten sind Amnesie und Vorstellungskraft. Ein Mensch kann vergessen – vielleicht auch andere Menschen, die verletzt wurden. Und die Vorstellungskraft basiert auf Erinnerung. Ohne Erinnerung kann kein Bild konstruiert werden. Der Umgang mit Mündlichkeit gehört auch dazu. Es ist ein Medium, wenn man es so will. Wenn ich Mündliches aufschreibe, ist es eine Rückversicherungsstrategie – aber es ist nicht wirklich Literatur, sondern alternativer Journalismus – und ich kontrolliere die Gedächtnisfehler.
n.: Letztes Jahr hast Du – obwohl viele russlandkritische KünstlerInnen zum Boykott aufgerufen haben – an der Manifesta in St. Petersburg teilgenommen. Warum war das wichtig für dich? Welche Projekte hast du dort präsentiert?
A.K.: Ich hatte eine persönliche Intention: Ich arbeite gegen den Wissensmangel. Außerdem ist es wichtig zu begreifen, dass du, wo auch immer du hingehst, deine Erinnerung mitnehmen wirst – Erinnerung ist ein privater Ort. Darüber hinaus ist es auch nicht unbedeutend, dass die Situation, die Person und der Moment des Gesprochenen über dessen Interpretation bestimmen. Ich habe auf der Manifesta zwei Performance-Projekte präsentiert. Zusammen mit Kristina Norman – einer estnischen Künstlerin mit großem Interesse an der Ukraine, die auch einen interessanten Dokumentarfilm, About Pridnestrovje, gemacht hat – habe ich einen Film gedreht. In diesem Film übernehme ich die Rolle einer Fremdenführerin, die die Leute über den Majdan führt – auf der dvorcovaja ploščad (Platz vor dem Winterpalais) in St. Petersburg. Wir haben während der Weißen Nächte gedreht und ich bin darüber hinaus in einer Winterjacke zwischen den Menschen in T‑Shirts zu sehen, was die Situation zusätzlich verfremdet. Kristina hatte mich im April in Kiew während ihrer Recherchearbeit getroffen und mich einfach gefragt, ob ich ihr Guide sein könne. Sie hat meine Erläuterungen aufgenommen und ein Skript daraus gemacht.
Ein weiteres Projekt war die Interviewperformance Sieg über die Elektrizität, die auf dem Stück Sieg über die Sonne der russischen Futuristen V. Chlebnikov und A. Kručënych (1913) basiert. Ich habe drei fiktive Charaktere, d.h. den „Touristen“, den „Mediator“ und den „Kämpfer gegen die Elektrizität“, dafür genommen und sie mit einem Fragen- und Antwortskript versehen. Während meiner Performance konnten mir die Leute Fragen stellen – ich bin dabei allerdings meinem festen Plan gefolgt. Es gab sehr viele Fragen, auch über die Zulässigkeit von Humor… und über Odessa – das war eine schwierige Situation für mich während dieser Performance. Auf einmal gab es unter den Leuten Streit über den Vorfall in Odessa, bei dem Menschen während der Proteste in einem Haus verbrannt waren. Die russischen Medien hatten die Situation in ihrem Interesse genutzt und berichtet, dass es hauptsächlich russische Bürger gewesen seien, die dort ums Leben gekommen sind. Während der Performance wurde ich gefragt, was nun mit Odessa sei und wer dort plündere. Ich stand auf und antwortete gemäß meinem Plan, dass sie gerne mich dafür verantwortlich machen könnten und dass Odessa ein Schock für uns alle gewesen sei. Danach schaltete ich das Mikrophon um und sagte, dass es sich zuvor nicht um meine Worte gehandelt habe. Dabei ging es mir darum, den Moment zu zeigen, in dem du nichts erklären kannst, um die Unmittelbarkeit des Schocks.
n.: Die beiden Manifesta-Projekte haben ganz deutliche Bezüge zu Russland und zur russischen Kunst: Indem Du den Platz vor dem Winterpalais in St. Petersburg als Majdan imaginierst, überträgst Du die Vision der neuen Revolution auf den Schauplatz der Revolution, mit der das sowjetische 20. Jahrhundert begonnen hat. Und in der Interviewperformance mit den drei fiktiven Figuren verstehst Du den „Kämpfer gegen Elektrizität“ – mit dem Du dich eigentlich identifizierst – als Kontrafaktur des Dramas Sieg über die Sonne.
Kann man generell sagen, dass die Auseinandersetzung mit der russischen Kunst und Kultur für dein Schaffen sehr wichtig ist?
A.K.: Es ist wichtig sich damit zu beschäftigen. Wie zu sowjetischen Zeiten. Wenn gesagt wird, dass der Majdan mit seinem selbstgestalteten Weihnachtsbaum die größte Angst für Russland darstellt, heißt das, dass wir mit der Performance die Angst direkt in die „Mitte“ des Landes gebracht haben, an einen historisch enorm bedeutsamen Ort, nämlich jenen, wo die Revolutionen von 1917 stattfanden. 1905 war hier auch der Blutsonntag, nur um ein weiteres historisches Ereignis zu nennen. Für die russischen Revolutionen waren Plätze als Orte der Ereignisse von enormer Bedeutung. Aber kann man sich den Majdan auf dem Platz direkt vor der Eremitage vorstellen? Wir konnten es. Das war auch, denke ich, der Hauptgrund, warum der Direktor der Eremitage, Michail Petrovskij, so wütend darüber war. Die Reaktionen waren heftig. Petrovskij, der bisher nie ein Wort zu einem Kunstwerk der Manifesta verloren hatte, gab einen Kommentar ab. Er sagte, dass die Menschen heutzutage wüssten, dass öffentliche Plätze verwundbar sind und sich leicht in Müllhalden verwandeln können. Hinterher wurde über unsere Performance gesagt, dass irgendeine Frau AUF UNSEREN PLÄTZEN herumlaufe und wie in intellektuellem Wahn spreche. Natürlich hatte Petrovskij das Recht, das zu sagen – es ist seine Interpretation. Uns ging es in erster Linie darum zu demonstrieren, dass auch wir unsere Sicht der Dinge haben und unseren Diskurs. Es war wie ein Kampf, also war es für uns vor Ort sehr wichtig, sofort zu reagieren. Kristina beispielsweise wurde daraufhin von COLTA.RU, einem alternativen Online-Kultur-Magazin, interviewt und konnte so ihren eigenen Standpunkt darstellen. Aber es geht auch um Humor. In meiner Interview-Performance bin ich immer wieder den Fragen ausgewichen und habe im Prinzip geantwortet, wie es alle wichtigen Leute tun. So habe ich in meinen Antworten einfach die Sätze wichtiger russischer, interner Helden nachgesprochen. Das berührt die russischen ZuhörerInnen, TeilnehmerInnen in ganz unmittelbarer Weise.
n.: Auf der einen Seite scheint der Majdan – wenn man ihn wie Du als Performance betrachtet – die Vollendung der Avantgarde-Tradition darzustellen, insofern es hier wirklich gelungen ist, die Kunst ins Leben und damit zugleich an ihre absoluten Anfänge – zum Ritual und, im Fall der Dichtung, zur Wortmagie – zurückzuführen. Auf der anderen Seite kann man einige wichtige Unterschiede zur Avantgarde feststellen: Zum einen ist der Majdan weit entfernt von der der Avantgarde eigenen radikalen Zukunftsorientierung und ihrem Utopismus. Und zum anderen wurde im Gegensatz zum durchaus gewaltbereiten Kunstverständnis der Avantgarde die Kunst auf dem Majdan gerade als Instrument gegen Gewalt verstanden. Wie siehst Du das?
A.K.: Wir können in Bezug auf den Majdan durchaus von einer Archaisierung der Kunst sprechen, einer Performance, die Kunst wieder in ein Ritual verwandelt, das jeder durchführen kann – also eine Kunst, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Wichtig am Majdan ist aber auch, dass die Intellektuellen, insbesondere die WissenschaftlerInnen, den Majdan in die Nähe der Französischen Revolution rücken. Das war eine bourgeoise, nationale Revolution – keine sozialistische, wie die Ereignisse im Februar oder Oktober 1917 in Russland – das ist sehr wichtig. Revolutionen sind sehr verschieden und es wäre sehr interessant herauszufinden, welche Art von Revolution der Majdan wirklich war. Der Terminus Weltrevolution kommt allen UkrainerInnen, die ich getroffen habe, sehr leicht über die Lippen. Es scheint Konsens zu sein, dass es eine Revolution war, die sich von den russischen Revolutionen unterscheidet. Es gibt bereits Bücher zu diesem Thema, was wirklich toll ist. Ich kann leider die genauen Zusammenhänge nicht wirklich präzise wiedergeben. Aber z.B. das Buchprojekt der Politikwissenschaftlerin Olga Onuch (Univ. Manchester) findet schon Erklärungen. Da geht es im weitesten Sinne um unsere erste Revolution, nicht nur um den Majdan. Konkret wird ein Bezug zur Französischen Revolution in der Verbindung zwischen Protest und Sozialer Revolution hergestellt.
n.: Und was sind deine neuen Projekte? Du hast uns von den täglichen Telefonaten mit deiner Mutter, die in der Kriegszone lebt, erzählt. Derzeit dokumentierst du sie in einem Blog. Willst Du daraus ein Buch machen?
A.K.: Ja. Ich engagiere mich derzeit auch im Projekt der Life Library Donbass und möchte darüber auch ein ‚Lokalnarrativ’ schreiben. Es ist nun schon acht Jahre her, seitdem ich das letzte Mal über Ždanovka geschrieben habe. Alle meine aktuellen Texte resultieren aus den Fragen, die ich meiner Mutter stelle. Sie hat eine besondere Art Weisheit, die selbst meine FreundInnen fasziniert. Wenn ich sie frage, wer die Schüsse abgibt, sagt sie lediglich, dass ich solche Fragen nicht stellen solle. Da ich nicht mit ihr zusammen im Keller sitze, könne ich ja nachsehen gehen. Durch solche unmittelbar aus Erfahrungen abgeleiteten Einsichten verwandelt sich meine Mutter für mich in eine sehr starke Person. In allen meinen aktuellen Texten geht es um die einfachen Leute, die in dieser lebensbedrohlichen Situation leben. Die meisten Leute imaginieren ein Narrativ, an das sie gerne glauben würden. Also erzählt mir meine Mutter, dass die Kaninchen nach den ersten Gefechten – tatsächlich! – an gebrochenem Herzen gestorben sind und die Hunde nichts fraßen, weil sie Angst hatten. In manchen Texten wird man die Haltung meiner Mutter wiederfinden, aber es geht nicht um ihre politische Position. Ich schreibe über Elektrizität, Wasser oder die Rente – und die Frage, ob es sie dort gibt oder nicht. Und alle diese Informationen stehen in einem Spannungsverhältnis zu den journalistischen Berichten, die oftmals etwas auslassen, weil die Journalisten zu sehr in Eile sind, um die Erzählungen der einfachen Leute anzuhören, und zu den Mythen, die täglich in den Medien konstruiert werden.
n.: Vielen Dank für das Interview, Alevtina!
Teilnehmerinnen: Christina Schwigon, Christina Kühn, Maja Zuchewicz, Lisa Vogt, Sophie Podhayets
Übersetzung aus dem Russischen und Englischen: Christina Schwigon
Redaktion: Susanne Frank
Weiterführende Lektüre:
http://www.alevtinakakhidze.com/


