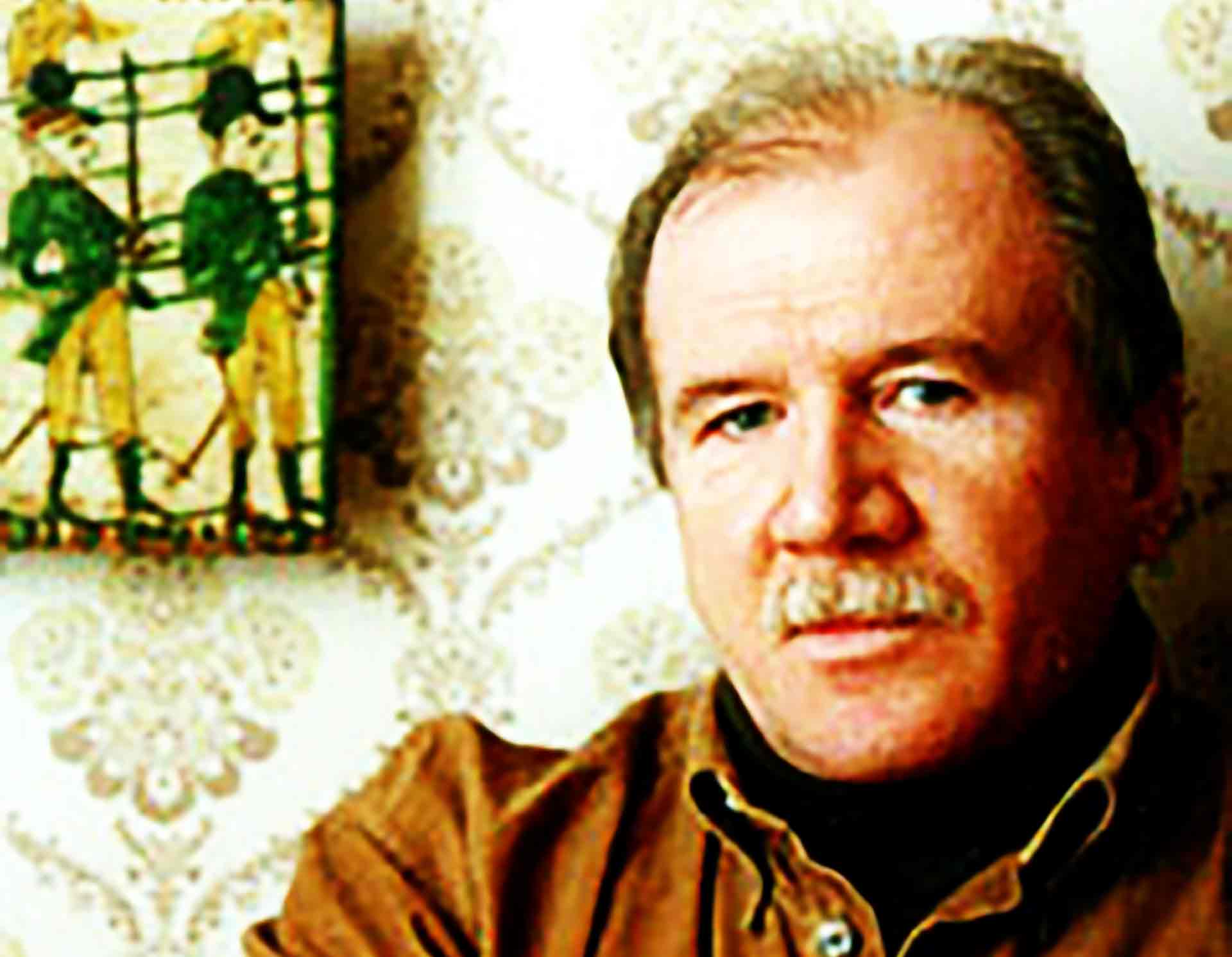
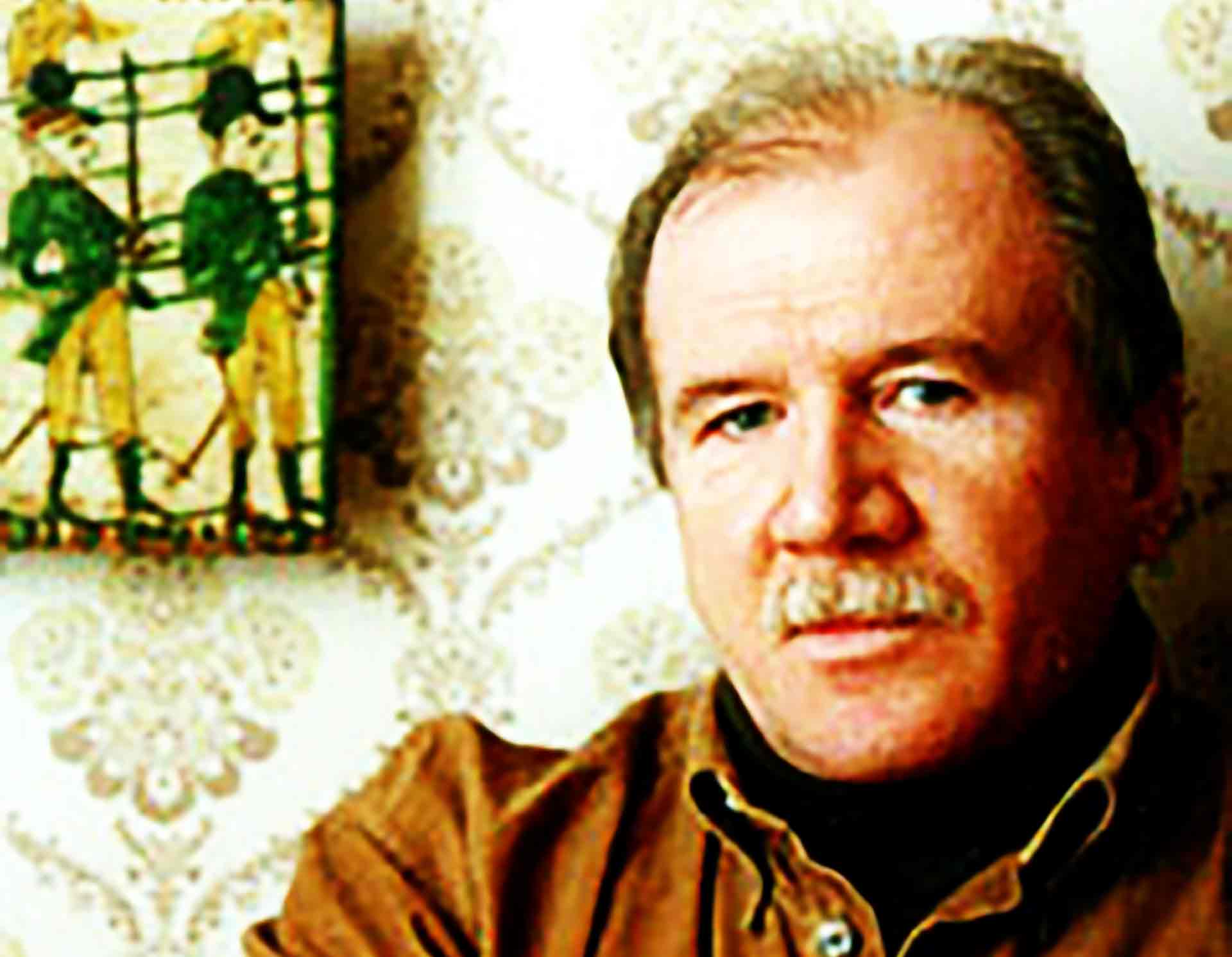
Das wilde Fleisch der Sprache
Igor’ Klechs dokumentarisch-ästhetischer Radikalismus


novinki: Sie sind ein Autor mit einer ‚gemischten Herkunft‘, einem abwechslungsreichen Leben und einem Werk, das in keine literarische Schublade zu passen scheint. In welche würden Sie sich selbst stecken, um sich grob einzuordnen?
Igor’ Klech: Eine solche Richtung gibt es noch nicht, aber es wird sie möglicherweise geben. Kurz gesagt: Das ist Prosa, die Kunst der Prosa – so, wie sie Mandel’štam in der Vierten Prosa (Četvёrtaja proza) verstanden hat. Es gibt eine Kunst des Geschichtenerzählens, die Belletristik. Nachdem die klassische Literatur ihre Aufgabe erfüllt hat, indem sie eine erschöpfende Anzahl menschlicher Typen und typischer Kollisionen geschaffen hat, kommt es der Belletristik nun zu, dies alles auf eine zeitgenössische Art „umzukleiden“, und das Limit ihrer Wünsche ist es, als Vorlage für ein Drehbuch zu dienen. Das ist die „Trostliteratur“. Die „Literatur des Urteils“ (Dostoevskij, Kafka, Brodskij u. a.) ist aus meiner Sicht zu totalitär – Machtliebe, auch noch pervertiert, hasse ich, obwohl ich Kafka über alles liebe. Auch sollte eine Literatur der Suche existieren: nicht als eine Methode, eine Geschichte zu erzählen, sondern als ein Verfahren, sozusagen den Gedanken aufzulösen – selbst von der Lebensohnmacht aufzuwachen und andere aufzuwecken. Daher interessieren mich am meisten nicht vorhandene symbolische Genres, von denen man das Ungewisse erwarten kann.
n.: Sie haben erwähnt, dass Sie im „Westen“ gerne als „Galizinist“ gelesen werden. Ihr 2009 erschienener Essayband, Migrationen (Migracii), bedient zum Teil diese Erwartung. Was genau heißt es eigentlich, „Galizinist“ zu sein? Welche Rolle spielt das galizische Thema – für Sie persönlich und für Ihr Schreiben?
K.: Hm, wahrscheinlich ist es für westliche Übersetzer, Herausgeber und Leser bequemer, mich und meine Essays so wahrzunehmen. Wie Gender, Nationalität, Sprache werden auch die Orte, wo der meiste und beste Teil des Lebens verlaufen ist, zu deinem Los (einem machtlosen), welches du im besten Fall als Schicksal (muskulöses) anzunehmen in der Lage bist, so dass es dann zum Thema (künstlerischen) werden kann.
Ich habe mich immer als niemanden sonst außer als Russen angesehen, aber ich hatte Glück, dass meine durchs Land umherirrenden Eltern Ende der 1950er Jahre in der Westukraine sesshaft wurden und in mir die ukrainischen, polnischen, litauischen Vorfahren zum Leben und zur Sprache geweckt wurden, diese ewig zerstrittene Sippe. Die mitteleuropäische Sphäre, die urbane und die dörfliche, die naturgegebene und die historische, hat es mir erlaubt, in den Geschmack der süßen Gifte des österreichisch-habsburgischen Imperiums zu kommen, was mich hellhörig, aber unempfindlich ihnen gegenüber gemacht hat – ich habe eine Injektion und Impfung der eigenen Sorte erhalten. Viel später habe ich verstanden, dass sich hier die Mühlsteine der germanischen und slawischen Welten drehen, und dies meist tödlich, aber des teuren Preises wert.
Was Galizien angeht, so ist es ein Einzelfall, dass eine ganze Region nach den Gesetzen eines Dorfes organisiert ist und sich verzweifelt gegen die Globalisierung wehrt – im wertfreien Sinn. Das verdammte Moskau geistert immer noch jede Nacht in meinen Träumen, obwohl ich hier schon das sechzehnte Jahr überlebe.
n.: Wie sind Sie darauf gekommen, ihren Beruf als Glasmaler bzw. ‑restaurator für die unsichere Existenz eines Schriftstellers aufzugeben?
K.: Der Beruf des Glasmalers war eine Notlösung: Unter den Bedingungen des Sozialismus war das eine Möglichkeit so zu leben, als ob es ihn nicht geben würde. Geschrieben habe ich seit der Schulzeit, habe russische Literatur an der L’viver Universität studiert, aber nachdem ich mich überzeugt hatte, dass man dem Diktat der verhassten Ideologie nur entgehen kann, wenn man sich auf den sozialen Bodensatz begibt, traf ich eine Entscheidung: „Wenn ich nicht das machen darf, was ich möchte, dann werde ich wenigstens nicht das tun, was ich nicht möchte.“ Zum Beispiel die Vorträge Brežnevs mitzuschreiben und Schüler zu vertölpeln. Jemand wurde Hausmeister und jemand Schornsteinfeger. Ich hatte das Glück, dass sich im geschichtsträchtigen L’viv für mich die Arbeit als Glasrestaurator gefunden hat. So ergab sich die Gelegenheit, auf eigenes Risiko unabhängig in der Underground-Künstlerszene mit meiner eigenen Angst zu leben. Ich bin diesem Beruf dankbar, aber ich bin da ein Handwerker geblieben, wie es viele gibt.
Mich gänzlich als Schriftsteller verwirklichen konnte ich erst, als ich mich von der Glasmalerei und L’viv verabschiedete und umgezogen bin – wie mit dem Kopf in ein Eisloch. Allein das Gefühl der erfüllten Bestimmung – das Glück der verspäteten Realisierung und eine Arbeit nach Neigung bis zur Abnutzung – entlohnt alle Nachteile und Schwierigkeiten der eigenen Situation. Es ist eine Sünde sich zu beklagen, wenn du in den Augen vieler als geschickt und fast als ein Glückspilz giltst.
n.: Es hat Konjunktur, L’viv als ein oder auch DAS Zentrum des ukrainischen Undergrounds zu sehen. Einige bekannte westukrainische Autoren beziehen sich auf das vorsowjetische L’viv, wenn sie in ihrer eigenen Biografie das Oppositionelle betonen – welches Verhältnis haben Sie dazu?
K.: Es gibt die ukrainische Kultur und die Kultur der Ukraine, und das ist nicht dasselbe, was man aber in L’viv nicht verstehen möchte: Odessa und Charkiv sind keine weniger bedeutsamen kulturellen und künstlerischen Zentren der Ukraine. Aber es gibt die Schönheit der Oppositionen, und die Bipolarität schmückt die Kulturen vieler Länder: Wie Moskau und Petersburg in Russland, Warschau und Krakau in Polen, so schaffen auch Kyïv und L’viv in der Ukraine eine besondere Polarisierung der Potentiale, entsprechend fließt Strom, es entstehen Entladungen, die Funken sprühen. Die künstlerischen Traditionen des Undergrounds waren in L’viv immer stark, aber nicht in der Literatur, und schon lange nicht in der zeitgenössischen ukrainischen. Durch L’viv, die Hauptstadt der Region, sind einfach die Ukrainer der gesamten Westukraine gefahren oder haben diese Stadt mit Pietät behandelt.
L’viv selbst ist in literarischer Hinsicht längst unfruchtbar wie ein Durchgangslager: Lyšeha ist aus Tysmienyca nach Kyïv, Rjabčuk ist eben dorthin, Andruchovyč ist aus Ivano-Frankivs’k nach Berlin, Izdryk ist zurück nach Kaluš, Čubaj – in die Welt der Toten. Im Übrigen bin ich in allen anderen Beziehungen außer der literarischen damit einverstanden. Obwohl ich es vorziehen würde, dass L’viv als das Tor der Ukraine in die große Welt dienen würde, statt den zweifelhaften Titel der Hauptstadt der Marginalisierten zu tragen.
Und glauben Sie nicht der hartnäckigen Idealisierung des österreichisch-ungarischen Imperiums und des Vorkriegspolens, wo ukrainische Galizier Leute der letzten Sorte waren (erinnern Sie sich zumindest an die Geschichte des Oberst Redl und die Emigration ganzer Dörfer von hier über den Ozean. Zu 10% ist das Identitätssuche und zu 90% – den Moskowitern den Vogel zeigen. Ich könnte meine Behauptung argumentativ untermauern und illustrieren, möchte allerdings nicht auf das Verständnisniveau der drückenden Mehrheit der Opponenten absteigen. Wenn jedes Argument gelegen kommt, ist eine Diskussion nicht möglich. Ein ernstes Gespräch ist unausweichlich, aber man muss abwarten.
n.: Wie gehen Sie damit um, dass man Ihnen eine „imperiale“ Perspektive unterstellt und man Sie leicht – von verschiedenen Lesergruppen aus – als unbequem wahrnehmen kann?
K.: Die Antwort ist einfach und ohne Koketterie: Ich bin Nonkonformist und keine Formen des Gruppenbewusstseins sind für mich richtungsweisend. Wenn man dir etwas andichtet, ist es zwar unangenehm, aber wie Čechov seinem älteren Bruder geschrieben hat: Rechtfertige dich nie, selbst wenn die Zeitungen drucken, du seist ein Geldfälscher. Was Russland angeht – heute es kein Imperium, sondern ein Großes Land und PROJEKT, was anzuerkennen einigen Einwohnern kleiner und unselbstständiger Länder unmöglich oder für sie beleidigend ist. Und für die reichen und starken Länder ist es bequem, ihre Unzufriedenheit für eigene Interessen zu nutzen. Leider hat sich hier seit 1000 Jahren nichts Wesentliches geändert. Derzeit wütet die ukrainisch-russische Polemik um sich. Um Obsessionen und halbgebildete Angriffe loszuwerden, musste ich das vor ein paar Jahren in Moskau erschienene Buch Westliche Ränder des russischen Imperiums (Zapadnye okrainy Rossijskoj imperii) kaufen, eine gemeinsame Arbeit professioneller Historiker – seitdem hat das Herzspannen nachgelassen. Das Buch ist weder pro- noch antirussisch, sondern wissenschaftlich, mit Verweisen auf Quellen, mit begründeten Fakten und Kommentaren, ausgewogen wie eine wertfreie Expertise der analytischen Abteilung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten irgendeines 19. Jahrhunderts. Was für ein Glück, dass nicht alle verrückt geworden sind.
Übrigens, die Zukunft der Ukraine entscheidet sich heute auf der Ebene des Kampfes zweier Konzeptionen. Ist es ein Land, wo Berge, Meere, Wälder, Steppen, große Flüsse, natürliche Ressourcen, ökonomisches und demografisches Potential, ethnische, sprachliche und kulturelle Vielfalt (Ukrainer und Galizier, Russen und Russischsprachige, Juden, Krimtataren, Huzulen, Russinen u.a.) und mehrere Konfessionen (Orthodoxe, Katholiken, Moslems) existieren – klar, was ich meine? Oder siegt das Paradigma „ein Volk, eine Sprache, ein Glaube, eine Partei, ein Führer“ (in seiner weichen Variante, dem Polen Piłsudskij ähnlich), also eine archaische Konzeption eines mono-ethnischen, homogenen Staats, aufgesammelt auf dem Müllhaufen der Geschichte?
n.: Zahlreiche Texte, die sich mit L’viv beschäftigen, sind Gedichte. Von Ihnen ist mir keines bekannt, auch sonst keine Lyrik. Wie kommt es, dass sie ausschließlich Prosaist sind?
K.: Es gibt vier Genres, in denen ich nicht arbeite. Mit einzelnen Ausnahmen sind es Gedichte, Publizistik, der Roman (da ich ihn für abgestorben, epigonenhaft, für geschickt verpackte Ware halte, mit dessen Produktion einander überholende Belletristen beschäftigt sind) sowie das Drama (die oberflächlichen Wellenbewegungen menschlicher Beziehungen interessieren mich wenig, obwohl es Ausnahmen gibt). Aus allem anderen – aus der Prosakunst, der Essayistik und dokumentarischen Genres schaffe ich diesen oder jenen „Cocktail“. Ich will niemandem etwas erzählen, sondern selbst etwas erfahren. Und wenn es für mich interessant wird, dann wird es für meinen Leser nicht uninteressant.
n.: Wenn wir schon bei der gestalterischen Ebene angekommen sind: Es fällt einerseits die hohe metaphorische Dichte auf, die Ihre Prosa poetisch macht, und andererseits der ständig durchschimmernde oder bewusst signalisierte Bezug zu Ihrer Biografie und zur Zeitgeschichte. Haben Sie dabei ein bestimmtes Ziel?
K.: Der stilistische Prozess des Alterns kann wie ein allmählicher Verzicht auf den Gebrauch der Metapher zugunsten der Metonymie beschrieben werden. Wenn Metaphern in meinen Texten immer noch anzutreffen sind, so heißt das, dass ich noch nicht gänzlich alt geworden bin. Andererseits haben mich rohe Dokumente und dokumentarische Genres schon seit dem Studentenalter bewegt. Seit ich dreißig geworden bin, konnte ich einfach nichts mehr lesen, was in realistischen Konventionen geschrieben war (wenn es kein klassisches, per definitionem mythologisches Werk ist), ebenso die meisten meiner Bekannten (was viele nicht gerne zugeben). Ich schätze nur das wilde Fleisch der Sprache und von dem Ausgedachten nur den Fieberwahn, die Halluzinationen, nur echtes Blut und Schweiß, keines von der Leinwand. Schon lange ist kein Extremismus mehr dabei – nur ästhetischer Radikalismus. Ich liebe anspruchsvolle populärwissenschaftliche Literatur und übe mich selbst mit riesigem Vergnügen in diesem Genre, um mich zu erholen und Geld zu verdienen, obwohl der Hedonismus einem Prosaiker nicht gut bekommt. Ein Ziel? Die Bestimmung erfüllen, ein anderes gibt es nicht. Mit Prozenten all das zurückgeben, was ich vom Freudenbecher des Lebens erhalten habe, die ganze Wehmut bei mir behaltend.
n.: Hin und wieder schreiben Kritiker, dass man bei Ihnen „barocke Prosa“ vorfände – man könnte es als eine an Verzierungen reiche, schwer lesbare Kost verstehen. Oder hat es etwas mit einer textuellen Suche nach rhetorischen Vorbildern wie Nikolaj Gogol’ und Bruno Schulz zu tun? Ihre Geister spuken an verschiedenen Stellen in ihrem Oeuvre. Welchen Platz nehmen sie in ihrem jüngsten Buch ein?
K.: Es gab auch mal den Barock bei mir, ich habe mich oft verändert und nicht (nur?) wenige Räder erfunden. Moskau – das ist nicht nur eine „kulturelle Repatriation“, sondern auch eine Art „Arbeit“, unser „inneres Amerika“, und ein gigantischer „Destillator, um einen allrussischen Selbstgebrannten zu 40%igem Alkoholgehalt zu bringen“ (verzeihen Sie die Autozitate). Der Schicksalswechsel nach vierzig Jahren hat mir unglaublich viel gegeben. Aber leider bin ich erst zur Literatur als Kunst gekommen, als sie ihr Totenmahl gefeiert hat. Heute ist das nur Produktion.
Das Buch, über das Sie sprechen, erscheint, so Gott will, in diesem Jahr in kleiner Auflage, finanziert durch ein Stipendium, und wird irgendwann von irgendjemandem gelesen. Mein Land benötigt es noch nicht. Es besteht aus einem halben Hundert Essays über bedeutende Bücher und ihre Autoren: von Cäsar (Autor des besten Buches über den Krieg) und Plutarch (Erfinder des biografischen Genres), über Montaigne (Erfinder des essayistischen Genres), Pascal, Rousseau, Adam Smith, Darwin, Napoleon und Nietzsche, Poe, Puškin, Gogol’, Tolstoj, Platonov mit Nabokov und Schulz bis zu einigen zeitgenössischen Autoren. In diesem Buch beute ich den „biografischen Zugang“ zur Literatur aus: Der Schlüssel zum Text liegt im Autor, der Schlüssel zum Autor – im Text.
All diese Texte habe ich übrigens zweifach verkauft, und einige auch dreifach – als Vorworte zu sehr teuren Büchern in einer Auflage von 100 Exemplaren für die „neuen Russen“ und fast umsonst einigen Zeitungen mit einer Auflage von einigen Tausend Exemplaren und dicken Literaturzeitschriften. „Die unsichtbare Hand des Markts“ fühle ich heute auf dem eigenen Hals – danke dir, Adam Smith.
n.: Ein anderes sehr junges Buch, das Sie ihr opus magnum nennen, sind die Chroniken des Jahres 1999 (Chroniki 1999 goda). Eine pessimistische und zynische Abrechnung mit der postsowjetischen ukrainischen und russischen Situation, der immer ein wenig fehlt, um rund zu laufen…
K.: Verzeihen Sie den Truismus, aber nur Tote haben keine Probleme. Aus meiner Sicht ist es im Gegenteil ein optimistisches Werk darüber, wie schwer ein gesamtes großes Land gesund wird, Abstand vom Todesrand gewinnt. Meine bescheidene und fast anonyme (wie bei Proust) biografische Erzählung (eines untypischen Rastignac) schreibt sich, wie mir scheint, ideal in dieses Sujet ein. Anfangs sollte es eine Erzählung über den Tod meiner Mutter sein, und es gab eine Möglichkeit, sie in der Schweiz zu schreiben, aber ich habe die Ausführung der Idee auf viele Jahre verlegt – und es war richtig. Unbewusst habe ich gespürt, dass die Geschichte nicht beendet ist, so lange mein Vater lebt. Später habe ich verstanden, dass in diesem unglückseligen Jahr meine Mutter nicht anders konnte als zu sterben. Es wurde ein Kulminationsjahr (in Erwartung des „Milleniums“) und ein Wendejahr vom „Steine schmeißen“ zu ihrem „Aufsammeln“. Ein Jahr der zwei Kriege – in Serbien und auf dem Kaukasus, der Explosion von Wohnhäusern in Moskau, der Abdankung des „Zaren Boris“ und der Ankunft Putins, der Abreise meiner Tochter nach Israel und meiner Fahrt mit der Transsib, des Todes meiner Mutter – alles hat sich miteinander verwebt. Als ich endlich angefangen habe, die „Chroniken“ zu schreiben, starb Jelzin, danach mein Vater – und so weiter, eine Todesparade, von klein bis groß und von oben bis unten: Eine andere Truppe spielt schon ein anderes Stück. Vielleicht liege ich falsch, aber darüber habe ich geschrieben. Die Vielzahl der fast namenlosen Protagonisten auf einer Fläche von den Karpaten bis nach Vladivostok und eine epische Beziehung zum Zeitverlauf erlauben mir, auf Grund der Unwiederbringlichkeit des Verlorenen mein Opus für etwas wie ein Epos zu halten. Es ist einfach so, dass lang zu schreiben mir wie eine Gier des Schriftstellers erscheint, und kurz zu schreiben wie Großzügigkeit. Der letzte Satz des Buches lautet: „Weil das Leben kein Ort für Urlaub ist.“ Ist das Pessimismus oder Optimismus? Außerdem ist das lang erwartete Buch mit Illustrationen erschienen, wovon ich immer geträumt habe – dass Federzeichnungen vor jedem Kapitel stehen, wie in Abenteuerbüchern für Kinder! Der Traum ist erfüllt. Die ausgezeichnete Moskauer Malerin Tanja Nazarenko hat das Manuskript eine Nacht über durchgelesen, zwei Tage lang gezeichnet und zwei Monate später ist das Buch erschienen. Ich hatte schon mal Erzählungen und Bücher mit mehr Inspiration, aber es gab bisher kein wichtigeres. Wenn ich mich irre, heißt es, dass ich an meiner Zeit komplett vorbei lebe – aber ich bereue nichts, denn ich habe mehr getan, als ich konnte.


