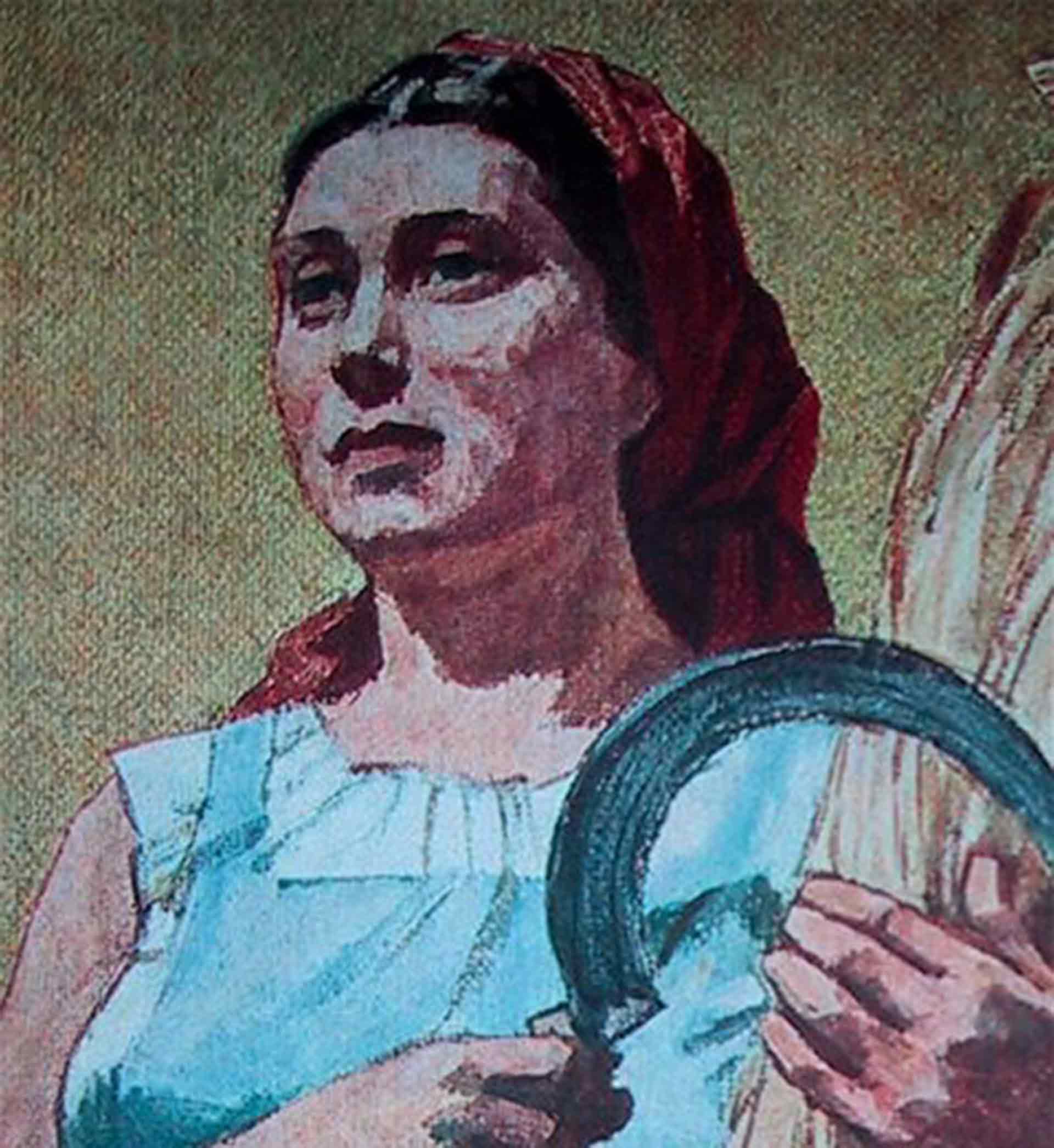
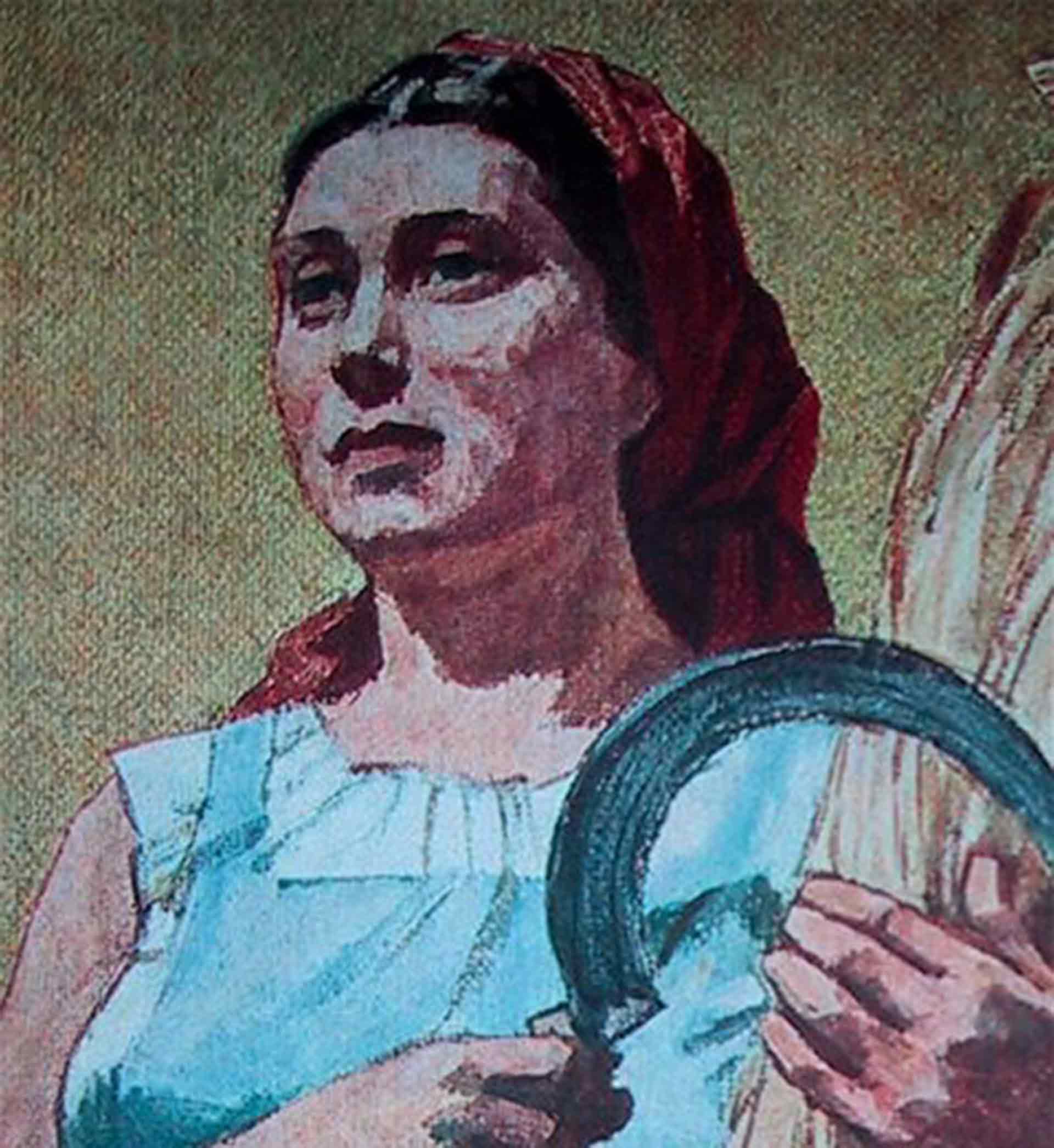
„Sie konnten mich nicht dazu zwingen, sie zu hassen“
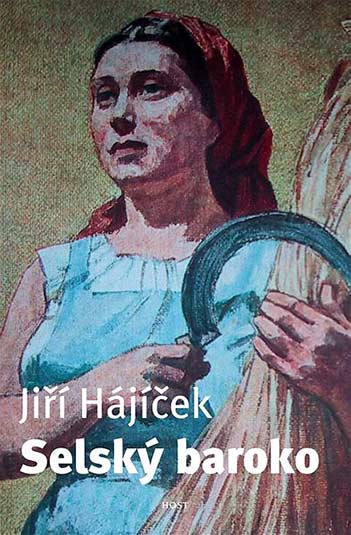
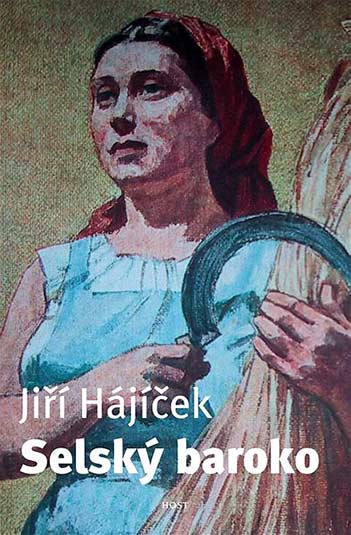
Wartete man in den 1990er Jahren nicht nur in Tschechien vergeblich auf den ‚großen Roman’, der die gesellschaftlichen Verwerfungen der kommunistischen Epoche und sein belastendes Erbe in den Ländern Ostmitteleuropas reflektierte, so hat das Warten seit einigen Jahren in der tschechischen Literatur ein Ende mit Romanen wie Jáchym Topols Kloktat dehet (Zirkuszone), Květa Legatovás Želary (Die Leute von Želary), Radka Denemarkovás Peníze od Hitlera (Geld von Hitler) oder Anna Zonovás Za trest a za odměnu (Zur Strafe und zur Belohnung). Dabei handelt es sich bezeichnender Weise nicht um den ‚einen großen Roman’, der nun alles erklärt, vielmehr zeigt sich in den Romanen der Facettenreichtum kritischer Rückschau in kleinen Geschichten, die an die Gegenwart rückgebunden sind. So auch in der Rekonstruktion der Vergangenheit im Roman Bauernbarock von Jiří Hájíček, der 2006 mit dem tschechischen Literaturpreis Magnesia Litera als beste Prosa ausgezeichnet wurde. Der Autor, geb. 1967 in České Budějovice (Budweis), debütierte 1997 mit der Erzählsammlung Snídaně na refýži (Frühstück auf der Verkehrsinsel); es folgten weitere Prosabände. Hájíček gehört der mittleren Autorengeneration an wie Jáchym Topol, Emil Hakl, Jan Balabán oder Miloš Urban. Der Titel seines Romans bezieht sich einmal auf den architektonischen Stil von Bauernhäusern, die in zahlreichen Dörfern Südböhmens zwischen 1840–1880 gebaut worden sind – am bekanntesten ist das Dorf Holašovice, das für sein Architektur-Ensemble des Bauernbarocks 1998 in das Weltkulturerbeverzeichnis der UNESCO aufgenommen wurde; zum anderen verweist der Titel auf die Lokalität der Handlung, die während zweier ungewöhnlich heißer Sommermonate in Südböhmen spielt.


Der Archivar Pavel Straňanský lebt davon, genealogische Nachforschungen in Archiven anzustellen. Zumeist arbeitet er im Archiv des Städtchens Třeboň, fährt aber auch häufig ins ‚Terrain’, besucht südböhmische Dörfer, um vor Ort zu recherchieren. Einer seiner Klienten beauftragt ihn, Ereignisse in der Gemeinde Tomašice in den 1950er Jahren – während der Zeit der Zwangskollektivierung der tschechoslowakischen Landwirtschaft – zu untersuchen. Pavel ist sich von Beginn an darüber im Klaren, dass die Ergebnisse seiner Nachforschungen als kompromittierendes Material im anstehenden Kommunalwahlkampf verwendet werden sollen. Gesucht wird nach einer schriftlichen Anzeige gegen zwei Großbauern und einen Sägewerksbesitzer vom Beginn der 1950er Jahre, die als Vorwand für die folgenden Repressionen, Gefängnisstrafen und Enteignungen genutzt wurde. Die Verfasserin der Anzeige aus den 1950ern ist die Mutter des jetzigen Favoriten im Kommunalwahlkampf einer südböhmischen Kreisstadt. Man spürt als Leser, dass sich diese Konstellation auch auf höherer politischer Ebene und im größeren Kontext problemlos nachvollziehen ließe.
In Bauernbarock geht es aber nicht so sehr um das Heute (und schon gar nicht um Kommunalpolitik), sondern darum, wie ein halbes Jahrhundert zurückliegende Ereignisse heute erinnert werden, ob man sich überhaupt an sie erinnern will oder ob bereits der berühmt-berüchtigte Schlussstrich gezogen wurde. Dabei sind die Spuren des vorsozialistischen bäuerlichen Südböhmens noch überall anzutreffen und spürbar. Im Laufe der Untersuchung des Archivars treten hinter den Ereignissen die Akteure der Kollektivierung aus den Dokumenten und Dorfchroniken immer deutlicher hervor, zum Teil handelt es sich um noch lebende Menschen. Die historische Rekonstruktion beginnt Anfang der 1950er Jahre mit der Dorfschönheit Rozalie Zandlová, die allen Burschen in Tomašice, auch den Söhnen der reichen Bauern, die Köpfe verdreht. Da sie aber aus ärmlichen Verhältnissen stammt, heiratet sie keiner der reichen Bauernsöhne. Sie wird schwanger, bringt einen Sohn zur Welt, bleibt allein, rächt sich durch die erwähnte schriftliche Anzeige, die dann als Vorwand für Repressionen gegen die Bauern und deren Familien dient. Schließlich verlässt sie mit ihrem Sohn die Gemeinde. Die Zerstörung der bäuerlichen Strukturen in den folgenden Jahren und Jahrzehnten deutet sich im Schicksal einzelner Familienangehöriger der Bauernfamilien in Tomašice und der umliegenden Gemeinden an.
Diese Geschichte erschließt sich ganz allmählich aus den detektivischen Ermittlungen des Archivars. Dabei werden die ‚Indizien’ sparsam und gekonnt platziert, die einzelnen, nicht allzu umfangreichen Kapitel sind chronologisch und wie Filmsequenzen aneinander gereiht. Dadurch bleibt die Handlung dynamisch – bis zum überraschenden Ende. Die oftmals lyrische und etwas fatalistische Stimmung eines heißen südböhmischen Sommers wird durch kontrastreiche Lokalitäten erzeugt: flimmernde Felder und scheinbar glühende Luft, halbdunkle Archive mit dem leicht schimmligen Geruch von Staub und alten Büchern, Friedhöfe, halbverfallene Bauernhäuser neben von Städtern (Pragern) aufgekauften und renovierten Anwesen. Es sind sparsame sprachliche Mittel, die hier eine ansteckende atmosphärische Dichte erzeugen.
Der Held, der auf die Vierzig zugeht, Pavel Straňanský, ist im gewissen Sinn ein typisch tschechischer Held, etwas kauzig und doch liebenswert, er hat Liebes- und Beziehungsprobleme, kaum Geld, fährt einen alten Škoda, trinkt manchmal zu viel Bier und ist unglaublich tolerant. An dieser Toleranz wird auch das Problem der Verantwortung und des nationales Gedächtnisses veranschaulicht. Wie tolerant darf man, soll man gegenüber den Verbrechen der eigenen Geschichte sein, wie mit Tätern und Opfern umgehen? Die Haltung von Pavel verdeutlicht seine sich zweimal wiederholende Äußerung: „Ich habe mich stets bemüht, allen zu verzeihen, aber mir wird nie etwas verziehen.“ Diese Art Toleranz kulminiert quasi in der wiederholt zitierten Aussage eines der verfolgten und enteigneten Bauern, eines ‚Kulaken’: „Sie konnten mich nicht dazu zwingen, sie zu hassen“.
Einen Kontrapunkt bildet die Haltung der Heldin Daniela, einer Pragerin, Anfang/Mitte dreißig, die in Südböhmen ebenfalls ihre Familiengeschichte recherchiert. Pavel und Daniela nähern sich an, ohne dass sie sich wirklich nahe kommen. Der Flirt und die nicht zustande kommende Sommeraffäre ist jedoch mehr als bloße romaneske Beigabe. Der nicht zustande kommende ‚Roman‘ ist symptomatisch, und Danielas Haltung wird gegen Ende des Romans zum offenen Gegenpol zu Pavels Toleranz, womit der Text auch spielerisch die von ihm erzeugte Illusion von ‚schwarz-weiß’, ‚gut-böse’, ‚wahr-falsch’ offen legt: Überraschend stellt sich heraus, dass sie die Enkelin eines der verfolgten und inhaftierten Bauern ist. Sie ist frustriert von der Art, wie der tschechische Staat und Teile der Gesellschaft in den 1990er Jahren mit dem totalitären Erbe der Kollektivierung, der Zerstörung der dörflichen Strukturen umgingen respektive noch immer umgehen. Sie ist also keineswegs zufällig in Südböhmen, sondern sie rächt sich an Rozalie Zandlová – doch mehr soll hier nicht verraten werden…
Das Romanthema über den Umgang mit der Vergangenheit, über das historische Gedächtnis mit seinen Implikationen – der Verantwortung, dem Verzeihen und der Reue –, spiegelt sich eindrucksvoll und facettenreich in den Protagonisten des Romans, in einstigen kleinen Geschichten, die noch immer da sind, auch wenn sie verdrängt und vergessen scheinen. Die tschechische Gesellschaft ist krank vor vergangenen Geschichten. Hájíčeks Roman gelingt es, die ‚Krankheit’, die Frage nach der Verantwortung vor und dem Umgang mit den Geschichten – gar nicht so sehr mit der großen Geschichte – spürbar zu machen. Dabei hält sich der Autor respektive sein fiktiver Erzähler weise mit Wertung zurück.
Jiří Hájíček: Selský baroko (Bauernbarock).Verlag Host. Brno 2005.


