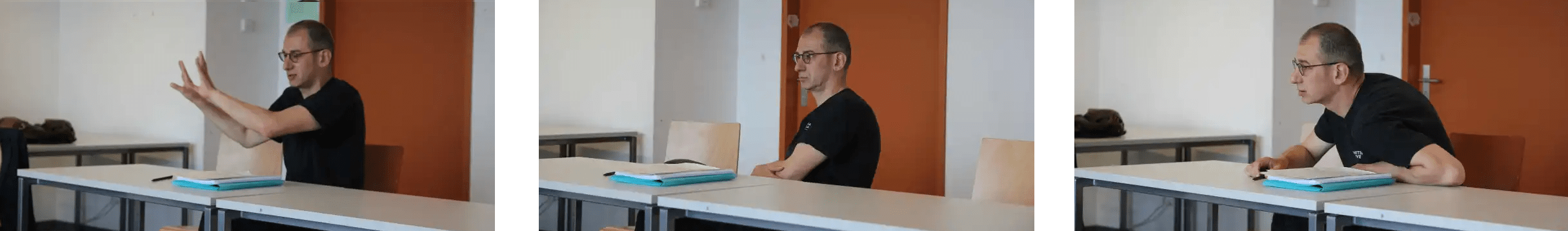
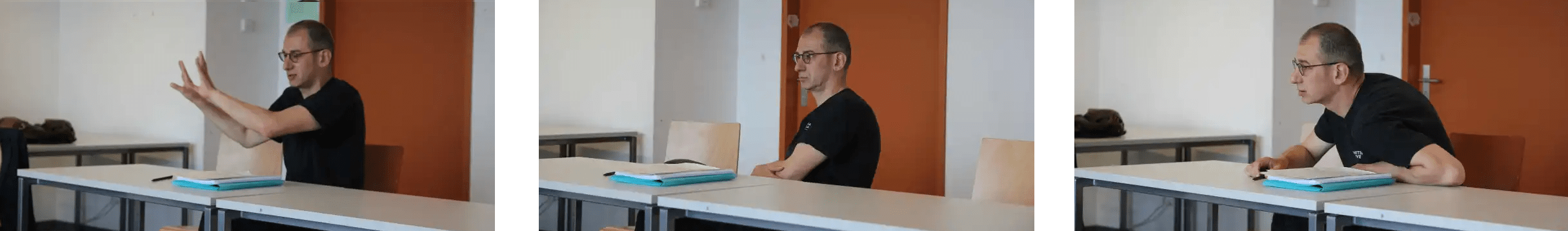
Must poetry be national? – ein Vortragsprotokoll der anderen Art
Eugene Ostashevsky war zu Gast an der Humboldt-Universität. Im Seminar vertonte, diskutierte und illustrierte der Dozent und Dichter die Frage: „Must poetry be national?“ Katharina Schwab und Felicitas Claus haben sich die wichtigsten Antworten in Erinnerung gerufen und sich zu ihren Eindrücken ausgetauscht. Ein Vortragsprotokoll der anderen Art.
Felicitas: Hallo Katharina! Fein, Skype funktioniert schon mal.
Katharina: Super.
Felicitas: Gut, dann fangen wir an… Eugene Ostashevsky. Sein Vortrag in unserem Seminar ist ja jetzt schon eine Woche her, weißt du überhaupt noch, um was es ging? Oder besser: Wusstest Du vorher schon etwas über Ostashevsky?
Katharina: Ich glaube, dass ich den Namen schon einmal gehört hatte, wirklich zuordnen konnte ich ihn jedoch nicht. Kanntest Du ihn denn schon vorher?
Felicitas: Ja, aber ich habe ihn in einem anderen Zusammenhang kennen gelernt: Er wurde im Deutschlandfunk zur Ukrainekrise interviewt. Als ich mich auf den Vortrag vorbereitet habe, habe ich seinen Namen dann im Künstlerprogramm des DAAD gefunden.
Katharina: Wie war denn dein Eindruck von seinem Vortrag über Lyrik? Ist dir etwas besonders aufgefallen?
Felicitas: Ich hatte eine ähnliche Frage an dich. Ich wollte wissen, ob sein Vortrag deiner Meinung nach dem Titel „Must poetry be national“ gerecht wurde…
Es gab schon ein oder zwei Sachen, die außergewöhnlich waren. Z.B. dass sich Ostashevsky – als Künstler mit US-amerikanisch-russischen Wurzeln – so stark von der sogenannten internationalen Lyrik distanziert hat.
Felicitas: Den Titel „Must poetry be national“ hätte ich vor seinem Vortrag für mich auch ganz anders beantwortet: Ich habe den Standardreflex erwartet, also in etwa: Nein, Lyrik muss nicht national sein. Das Gegenteil war der Fall. Stattdessen erklärte Ostashevsky, dass Gedichte durch ihren Autor immer Nationen repräsentieren. Und hat damit gerungen, dass er selbst Teil davon ist.
Katharina: Also ich muss gestehen, dass mir der Titel seiner Vorlesung gar nicht so präsent war. Beziehungsweise bin ich gar nicht am Titel „hängengeblieben“.
Felicitas: Okay? Was ist dir aufgefallen?
Katharina: Vielmehr habe ich seinen Vortrag als eine Art Einführung in das verstanden, womit er sich beschäftigt – nämlich Fremder und zugleich Nichtfremder in einem Land und einer Sprache zu sein. Mein Interesse hat er am Anfang geweckt, indem er – fast schon forsch – von uns erwartet hat, zu sagen, wie wir die von ihm vorher ausgesuchten Gedichte verstehen. Er forderte uns regelrecht auf, die Gedichte zu interpretieren, keine Scheu davor zu haben und die Dinge beim Namen zu nennen. Ich finde doch, dass das eine sehr typisch US-amerikanische Art und Weise ist zu lehren. Zumindest kenne ich das so aus einigen US-amerikanischen Vorlesungen im Internet.
Katharina: In meiner bisherigen akademischen Ausbildung habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Dozenten davor warnen, zu schnell zu interpretieren. Zunächst sollte man sich mit dem Aufbau, der Syntax etc. beschäftigen. Das wollte Ostashevsky viel weniger, es ging gleich ans „Eingemachte“.
Felicitas: Jein. Auch Ostashewsky war ja der formale Aufbau der Gedichte wichtig. Dass all die Gedichte auf Englisch geschrieben wurden beispielsweise, obwohl die Schreiber aus den unterschiedlichsten Ländern stammen. Dass sie alle recht kurz sind, keinen Reim hatten usw.
Katharina: Es war Ostashevsky aber nicht so wichtig wie die Bedeutung der Wörter. Nimm das Gedicht von Zbigniew Herbert, da betonte Ostashevsky die Bedeutung des Wortes „pebble“ und weniger die auffällige Wiederholung des Wortes oder den Aufbau des Gedichtes. Und bei Najwan Darwishs „A refugee from Crete“ diskutierten wir die Bedeutung des Wortes „Crete“, wie es Verwirrung stiftet, besonders weil der Poet Araber ist. Oder auch das erste Gedicht von Bei Dao, „A local accent“. Er fragte, was es bedeutet vor dem Spiegel zu stehen und sich mit ihm zu unterhalten, was es inhaltlich bedeutet. Direkte Interpretation und Deutung waren gefordert!
Felicitas: Könnte man sagen, dass er diesen Schwerpunkt gesetzt hat, um zu betonen, dass sich alle Gedichte um den Komplex Exil-Einsamkeit-Sprache drehten? Dass sie keine Geschichte erzählen? Sich also inhaltlich gleichen?
Katharina: Ich war nicht immer d´accord mit ihm. Das ist auch ein Problem seiner Herangehensweise. Manche Gedichte könnten ja – je nach Interpretation – auch anders gelesen werden als durch die „Exilbrille“. Was meinst du? Siehst du in allen Gedichten immer dasselbe Thema durchscheinen?
Felicitas: Warte, ich schau kurz nochmal drauf…
Katharina: Aber lass uns noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Er meinte, wenn ich mich richtig entsinne, dass er es schwierig findet, auf Poetryfestivals aufzutreten, weil sie ihm eine bestimmte Rolle vorgeben, meist die des „russischen Juden“. Und das Publikum erwarte dieses „authentische Auftreten“ auch von ihm. Dabei würde er lieber frei von solchen „Vorurteilen“ auftreten, frei von Werten, besonders frei von der Opferrolle.
Felicitas: Also, zuerst noch eine kurze Bemerkung zu deiner vorherigen Frage und den Gedichten, die Ostashevsky uns zum Lesen mitgebracht hat. Zumindest bei Du Fu, Bei Dao und Najwan Darwish sehe ich den Exilbezug gegeben. „I brood on the uselessness of letters“, „news has been cut off“, „I speak chinese to the mirror“ usw.
Deshalb finde ich auch deinen Übergang zu den Poetryfestivals umso interessanter, denn das war der Kernpunkt seines Vortrags. Es verbindet Ostashevskys Gedichtauswahl für die Vorlesung mit seiner eigenen Poesie. Also zumindest für mich war das der Kern.
Katharina: Gut, das würde ich nicht sagen, aber es war auf jeden Fall elementar.
Felicitas: Darüber lässt sich streiten. Dennoch: Konkret hat er sich ja auf Poetryfestivals bezogen, die sich als Überthema „Menschenrechte“ verpassen, ähnlich wie bei einer Mottoparty. Dann hat er sich gefragt, wie er dort hineinpasst – wo sich doch dort alle nur zum „Gesehen-werden“ aufhalten.
Und erinnerst du dich an Ostashevskys Behauptung über Paul Celan? Dass er angeblich von 99 % der Leser nur zur Kenntnis genommen wird, weil er mit dem Holocaust verbunden war?
Katharina: Ja, ich erinner‘ mich dunkel.
Felicitas: Sehr amüsant fand ich auch, wie er etwas überspitzt beschrieben hat, dass die „offenen westlichen Menschen“ – also wir – auf einem Poetryfestival von ihm selbst (Ostashevsky) anstandslos zu der Lesung einer afrikanischen Frau weiterwandern, um sich dann von ihr etwas über „ihre“ Kultur, Herkunft und Leiden erzählen zu lassen…
Was bedeutet, dass man als Dichter immer etwas repräsentiert – „Must poetry be national“, da ist es wieder, das Thema unseres Vortrags.
Katharina: Aber andererseits: Auch ein Dichter lebt in seiner Zeit. Und in der passiert etwas. Etwas Schlimmes, Tragisches oder Schönes. Und wenn ein Dichter darüber schreibt, dann ist es doch gerechtfertigt, ihn in diesem Kontext zu lesen.
Felicitas: Ja, aber wenn ich Ostashevsky richtig verstanden habe, ist genau das seine Kritik an dieser Art der Lyrik oder dem „Geschäft“ mit der Lyrik: Dass internationale Lyrik das eben nicht ausdrückt. Dass sie v.a. Gefühle beschreibt und den gesellschaftlichen Hintergrund vernachlässigt. Der „Kontext“ muss durch den Leser quasi dazuinterpretiert werden. Und: Der verbleibende Inhalt ähnelt sich bei den Exildichtern stark.
Ich finde ja, dass die Überspitzung zu Paul Celan nicht in die Reihe passt. Auf jeden Fall nicht, was seine Gedichte anbelangt! Ob er bei den Rezipienten Recht hat, kann ich nicht beurteilen.
Trotzdem hat Ostashevsky deutlich gemacht, wer zu internationalen Festivals eingeladen wird: Nämlich diejenigen, die auf Englisch schreiben, modern, ohne Reim, kurz usw. (siehe der Anfang unseres kleinen Gesprächs). Es werden eben nicht jene Dichter eingeladen, die im klassischen Chinesisch schreiben. Oder?
Katharina: Ja da hast du recht. Der letzte Punkt, den wir ansprechen könnten, wäre der Aspekt der Sprache.
Felicitas: Ja. Aber ich finde, genau da schwächelte der Vortrag bzw. hatten wir zu wenig Zeit, um zu diskutieren. Sehr ausführlich hat Ostashevsky die Abgrenzung seiner Lyrik von internationaler Lyrik erklärt, hat erklärt, was er genau NICHT möchte. Aber dann ist er nur kurz darauf eingegangen, wie seine eigene Poesie beschaffen ist. Trotzdem fand ich die Lesung aus seinem neuesten Werk toll. Erst hat er langsam gelesen, fast getragen, dann hat er sich immer mehr in den Rap seiner Dichtung hineingesteigert, das hat mir gut gefallen.
Katharina: Hmm… das hatte jetzt nur marginal mit Sprache zu tun und berührt eher die Vortragsweise. Aber zu seiner Poesie passt es.
Felicitas: Trotzdem hat er diesen Aspekt wenig ausgeführt. Nur einiges hat er erwähnt: Die grammatischen Inkorrektheiten, die er im Englischen einbaut und die nur für englische Muttersprachler erkennbar sind. Alles gemischt mit russischen Versatzstücken oder mathematischen Formeln…
Katharina: Er ist ja mindestens zweier Sprachen mächtig: des Englischen, weil es die Sprache ist, in der er sozialisiert und aufgewachsen ist und des Russischen, weil er es mit seiner Familie gesprochen und nie verlernt hat. Dass er einen distanzierten Blick auf Sprache hat, hat er ganz treffend mit der Gleichung beschrieben: one language – identifying words with things // several languages – words are things. Es macht verständlich, wie er Sprachen fühlt und hört.
Felicitas: Vielleicht ist für ihn deshalb auch der linguistische Zugang zu Sprache nicht so wichtig. Viel eher thematisiert er Sprache direkt: Wie in dem Dialog zwischen Pirat und Papagei, den er uns zum Schluss vorgelesen hat:
Pirate: Your native language is perrot!
Perrot: I forgot perrot and learned your language.
Pirate: There will always be a difference between you and your words …
Katharina: Ja, genau! Seine kleine Performance am Ende war wirklich cool.


