

Ein Tornado aus Wałbrzych
Joanna Bator eröffnet den Figuren in Wolkenfern die Welt außerhalb Polens
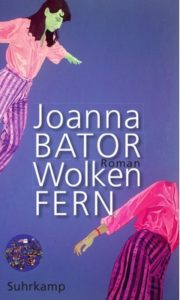
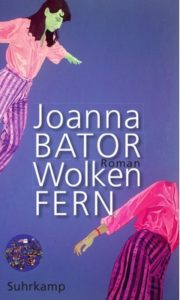
Joanna Bator legt mit Wolkenfern (Chmurdalia) ihren zweiten Roman vor, in dem sie an die Erzählung aus ihrem Erstling Sandberg (Piaskowa Góra) anknüpft. Die 46-Jährige konzentriert sich seit 2011 ausschließlich auf ihre schriftstellerische Tätigkeit, die sie 2002 mit der autofiktionalen Erzählung Kobieta (Frau) begonnen hatte. Die mittlerweile niedergelegte Beschäftigung in den Geisteswissenschaften schimmert aber noch durch, und so kann der geneigte Leser Anleihen feministischer und postkolonialer Kritik oder Entwürfe eines postmodernen Lebens in ihrem Roman ausmachen. Bator ist jedoch zugute zu halten, dass sie diesen Hintergrund der Erzählung nicht im Sinne einer Belehrung oder Demonstration ihres Wissens überstülpt, sondern spielerisch und kreativ mit den Konzepten umgeht. Man ist ihr dankbar dafür, dass man während der Lektüre kein Lexikon der Dekonstruktion neben sich liegen haben muss. Esther Kinsky bringt den angeregten Erzählfluss in Wolkenfern leichtfüßig ins Deutsche und schafft es, die Soziolekte der Figuren anzudeuten, ohne sie ins Extrem zu verzerren.
Wolkenfern ist eine Art Generationengeschichte, die den Bogen der Erzählung bis vor den Zweiten Weltkrieg spannt. Wie Olga Tokarczuk trägt Bator die Schichten der Vergangenheit ab und lackiert die Funde mit ihrer Erzählkunst neu. Auch sie bedient sich eines magischen Realismus, denkt Realität und Mythos zusammen. Es ist allerdings weniger die Magie eines bestimmten Ortes als das Netz von persönlichem Austausch und odysseischer Bewegung, das der Erzählung Struktur gibt. Nach der Elterngeneration in Sandberg widmet sich Wolkenfern der Tochter Dominika, die die poröse Klammer um das Geschehen bildet. Es kann aber keine Rede von einem konventionellen Familienepos sein. Schon allein deshalb, weil die „Familie“ aus lauter Bruchstücken besteht, Findelkindern, Angeheirateten, Hinzugedichteten, Nachbarn, Geistern oder den Teetanten, diesen zwei Schwestern, denen man die Verwandtschaft nicht ganz abkauft, die so ganz ohne Mann auskommen und doch ein Kind aufziehen. Aber für solche Lebensweisen gibt es im Kamieńsk der 1930er Jahre keine Bezeichnung, und so nennt man die angeblichen Schwestern einfach Teetanten und akzeptiert sie als solche. Immer wieder tauchen Menschen auf, die sich nicht so ganz in das in Polen stark verankerte und von vielen Figuren explizit gepflegte traditionelle Verständnis der Geschlechterrollen einfügen lassen. Dominikas Mutter, Jadzia Chmura, etwa findet im „Homodingsbums“ Jeremiasz Mucha, ihrem ehemaligen Nachbarn, einen willkommenen Gesprächspartner, und plötzlich ist es nicht mehr wichtig, dass dieser nicht als Witwentröster in Frage kommt. Auch Dominika selbst, die alle neuen Bekannten an irgendjemanden erinnert und so, wie der ebenfalls durch die Welt reisende Nachttopf Napoleons, ein leeres Gefäß darstellt, das jeder nach Belieben füllen kann – auch Dominika erweckt bei ihrem Angetrauten, einem homosexuellen amerikanischen Konditor, schon mal das Gefühl, dass sie der lange herbeigesehnte „süßmäulige Junge“ sein könnte. Trotz dieser zeitweiligen Verwischungen zwischen den Geschlechtern spielen doch die weiblichen Figuren in diesem Roman die erste Geige, womit Bator wiederum eine ähnliche Erzählperspektive vorgibt wie in Sandberg.
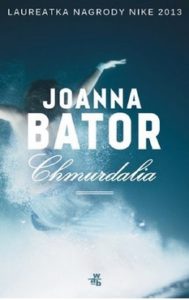
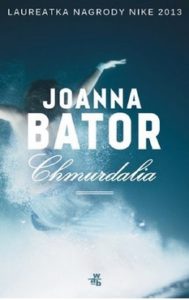
Obwohl die Welt von Wolkenfern tief in der Realität verwurzelt ist und die Widrigkeiten des Lebens kaum beschönigt, wird die ganze Erzählung von einem Hauch von Magie beschwingt. Vielleicht ist es der unbestimmte Glaube an Wolkenfern, der es ermöglicht, dass eine Gruppe polnischer Ausflügler in ihrem Auto unbeschadet an einen Hügel von Wałbrzych gespült wird, als die Flut aus einem geborstenen Staudamm sie mitreißt. Oder dass die ertrunkenen Teetanten nicht etwa auf den Grund des Flusses sinken, sondern als Nixen die Fantasie des Dorfsäufers beflügeln. Doch die Magie bewirkt nicht nur Erfreuliches. Dem jüdischen Fotografen Ludek Borowic aus Kamieńsk enthüllt sie Prophezeiungen des Todes, wenn die abgelichteten Personen unerklärlicherweise verschwommen, wie von Nebel umhüllt auf dem Abzug erscheinen. Am Vorabend des Holocaust erfüllt ihn dies mit einer grausamen Ahnung.
Doch Fotografien sind nicht nur Vorboten des Todes. Dominika zerlegt mit ihrer Fotokamera New York, London oder die griechische Insel Karpathos in Einzelteile, und während sie ihre Mitmenschen und ihre Umgebung fragmentarisch festhält, entdeckt sie im Fotografieren ihre Berufung. Alte Aufnahmen wiederum dienen den Protagonisten dazu, in die Vergangenheit einzudringen, Erinnerungen wach werden zu lassen. Ganz zentral sind Bilder als Ausgangspunkt einer Geschichte. Und so ist dieser Roman auch eine Geschichte vom Erzählen, vom Ausgraben, Nachforschen, vom Wieder- und Weitergeben, vom Ausschmücken oder frei Erfinden. Jeder erzählt seine – manchmal auch eine fremde – Geschichte nach Gutdünken, und über diese Erzählfäden und ‑netze bildet sich ein weltumspannender Teppich von Beziehungen, Querverbindungen, Sehnsüchten und nie ganz spurlosem Verschwinden. Die Figuren, allen voran die Kristallisationsfigur Grażynka, an deren Haut Neid und Begehren wie Blasen zerplatzen, bewegen sich unumgänglich in diesem Spannungsfeld, das einem das Gefühl gibt, nie ganz einsam zu sein, und das von unzähligen Erinnerungen getragen wird. Grażynka, die sich einer dauerhaften Festlegung sanft, aber bestimmt entzieht, bildet eine Art Nährboden dieses Geflechts. „Keine Erzählungen kommen aus ihrem Mund, nur ein besänftigender Strom von Worten, die wie Musik sind, doch man kann nicht behaupten, dass sie von nichts redet, es ist vielmehr, als könnte sie die Worte finden, die das Leben selbst zum Ausdruck bringen.“
Inzwischen ist ein weiteres Werk Bators erschienen, Ciemno, prawie noc (Dunkel, fast Nacht), das 2013 den bedeutendsten polnischen Literaturpreis Nike gewann. Wiederum geht es darin um Bators Heimatstadt Wałbrzych, doch im Mittelpunkt steht nicht mehr die Familie Chmura, sondern eine Reporterin, die den mysteriösen Vorgängen um eine Reihe verschwundener Kinder in der Stadt auf den Grund gehen will. Man kann dem deutschsprachigen Publikum nur wünschen, dass Esther Kinsky bereits an der Übersetzung arbeitet.
Bator, Joanna: Chmurdalia. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2010.
Bator, Joanna: Wolkenfern. Aus dem Polnischen von Esther Kinsky. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2013.
Weitere im Text erwähnte Werke Bators:
Bator, Joanna: Kobieta. Warszawa: Wydawnictwo Twój Styl, 2002.
Bator, Joanna: Piaskowa Góra. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2009.
Bator, Joanna: Sandberg. Aus dem Polnischen von Esther Kinsky. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2011.
Bator, Joanna: Ciemno, prawie noc. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2012.


