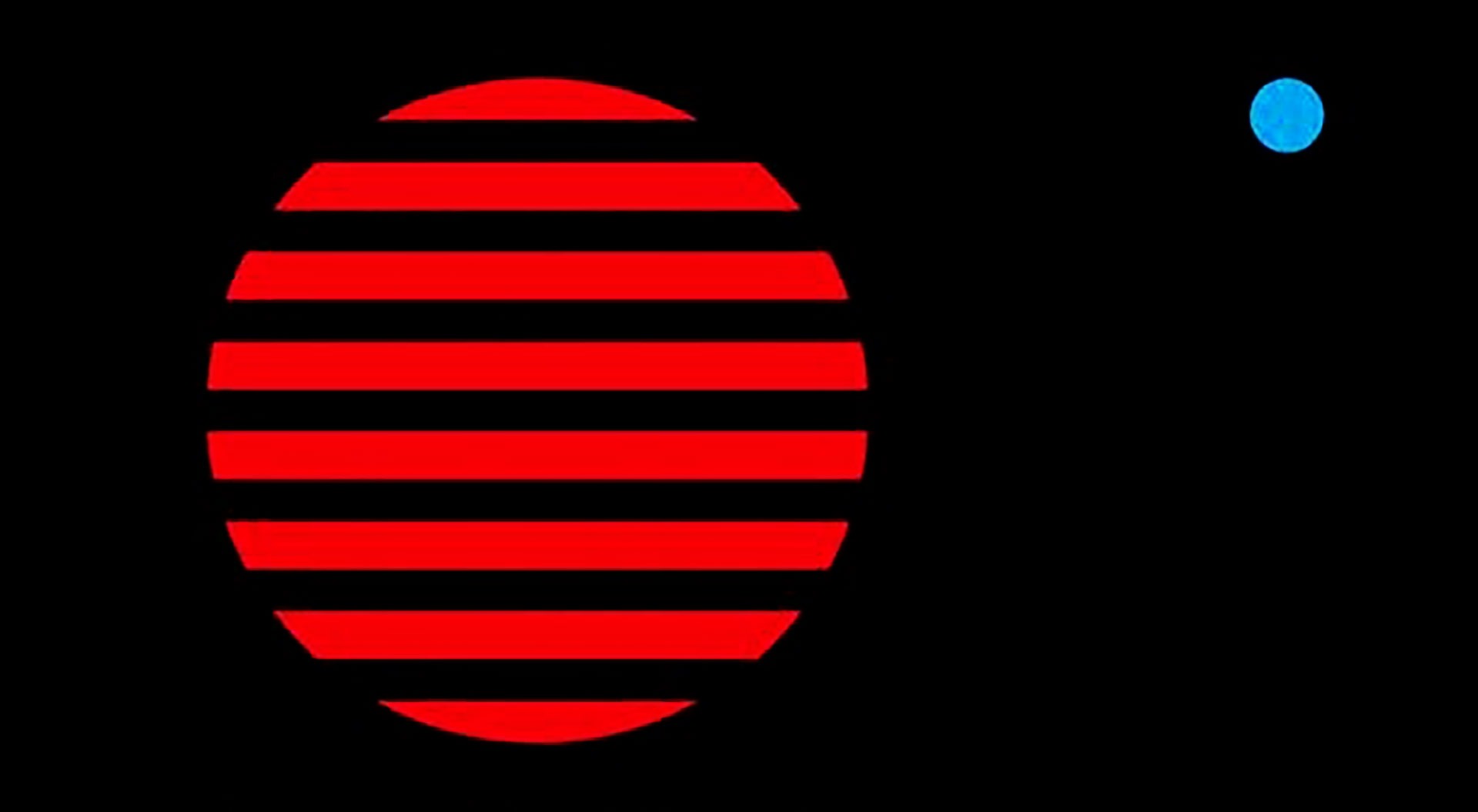
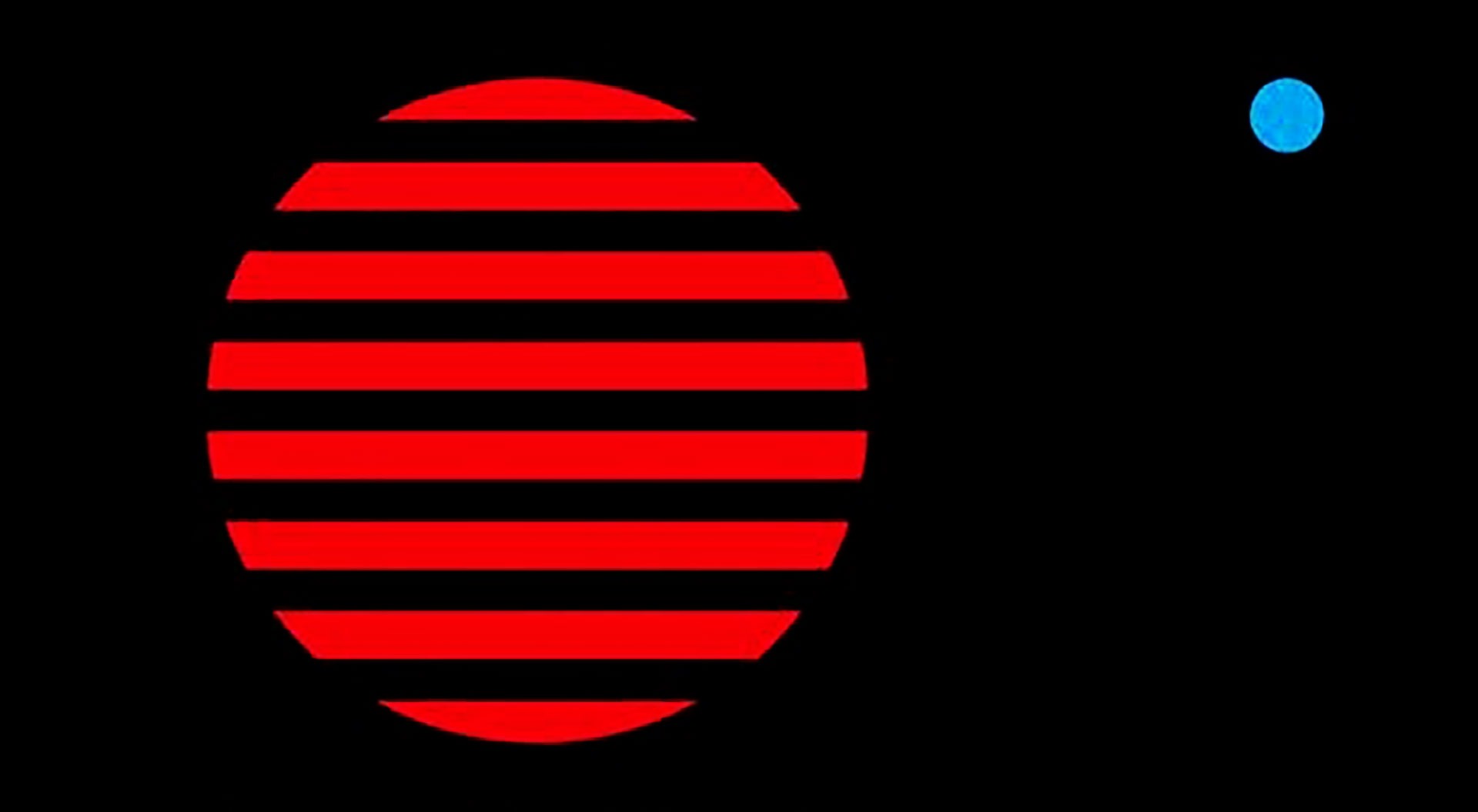
Von Müll und Menschen
Im Film Trash on Mars (dt. Müll auf dem Mars) finanziert ein dicklich tschechischer Unternehmer eine absurde Expedition ins Weltall, um seine Liebhaberin zu heiraten. Bei der Wahl des Reiseziels hatte er „Mars“ verstanden, während sie eigentlich von „Marseilles“ sprach. Doch das hält die beiden nicht auf: Sie begeben sich auf die Reise, und mit ihnen ein buntes und abenteuerliches ‚Forscher_innenteam‘. Am Ende wird es aber für das Grüppchen weder um Forschung noch um Teamfähigkeit gehen.
Benjamin Tuček verlegt die Handlung seines Films in eine unbestimmte Zukunft, in der bereits mehr oder weniger gescheiterte Versuche, Menschen auf dem Mars anzusiedeln, stattgefunden haben. Die Protagonist_innen sind die zweite Welle, die Nachfolger_innen, die gebrochenen ‚Söhne‘ der ehemaligen Genies. Sie gehören alle zur selben Generation, stellen sich aber als sehr unterschiedlich heraus und verfolgen verschiedene Ziele. Die Figuren sind zugleich stereotypische Prototypen: Sie reichen von Wendy, einer dynamischen Yogalehrerin, über eine fragwürdige Psychologin und einen jungen Leader mit einem überwältigenden Ödipuskomplex, bis zu einem ambitiösen Geek; jede_r stellt ein Stück Menschheit dar.


Trash on Mars ist keine lineare Geschichte im klassischen Sinne, sondern funktioniert vielmehr als Abfolge von Episoden. Der Film wirkt durch einen allwissenden Begleitkommentar im Hintergrund, der eine Distanz zur Handlung herstellt, wie eine Untersuchung zum Thema „Menschsein“. Die Zuschauer_innen werden gedrängt, kritisch auf die Figuren – diese grotesken und zugespitzten Widerspiegelungen ihrer selbst – zu blicken. Trotz ihres groben und einseitigen Stereotypencharakters ermöglichen die Figuren eine humoristische Reflexion zu ernsten Themen wie Umweltschutz, Kolonialismus oder das Verhältnis zwischen Realität und Fiktion. Daher geht es in dem Film deutlich mehr um die heutige Zeit als um die Darstellung einer hypothetischen Zukunft. Benjamin Tuček schafft es, unangenehme Debatten mit Spott und Vergnügen zu verbinden, wodurch aus seinem Low-Budget-Film eine mustergültige Komödie wird.
Bei ihrer Ankunft auf dem Mars erlebt die Gruppe eine Überraschung: Die Mars-Station, einst große Realisierung der ‚Pioniere‘ und Erbe der Väter, sieht jetzt wie eine verfallende Aluminiumbruchbude aus: „This is mars. No oxygen. No life. Beautiful world“. Noch deutlich verwunderter sind die Figuren darüber, dass die Station seit Jahren von einem schwarzen Androiden im Motorradoutfit mit Cowboyhut namens Bot bewohnt und instand gehalten wird. Dieser wird zum unterkühlten Beobachter der Helden, ihrer kleinen Dramen und Hysterien – zum schwarzen Ritter mit makellosem Blick, zum naiven Zeugen des menschlichen Wahnsinns.
Der Film schrumpft die Figuren auf Mittelmaß. Ihre Beziehungen und Dialoge betonen im Verlauf des Filmes immer stärker die kleinen Schwächen und die allgemeine Hilflosigkeit. Zudem inszeniert Tuček die Story in Form einer außerirdischen Reality-Show nach Vorbild von Big Brother und anderen. Das Zimmer der Psychologin wirkt zum Beispiel wie ein Beichtstuhl, in dem vor der Kamera Feedbacks zu eigenen Erfahrungen gegeben werden. Die Figuren sind meistens in der engen Station eingesperrt, in der sie schlafen, essen, Sport machen, debattieren, intrigieren, flirten, miteinander Sex haben. Doch die Wände sind dünn, und der Roboter Bot treibt sich herum.
Bei Exkursionen in die sterile Marsaußenwelt sind die kleinen Menschen nicht weniger kindisch als sonst. Sie rennen, spielen, rollen auf den Hügeln in der endlosen roten Landschaft herum und erinnern uns an manch hirnlose Lebewesen, mit direktem Verweis auf die ersten Star Wars Filme.
Die größte Besonderheit dieses Films ist sein Drehort: Die Geschichte wurde in den USA in einem Simulator der NASA innerhalb weniger Wochen verfilmt, angeblich als erster Film, der diese Möglichkeit hatte. Alles musste sorgfältig geplant werden, um die strengen Fristen einzuhalten und das Beste aus dem kleinen Budget zu machen. Die Musik zu den Bildern wurde erst später komponiert. Mit David Lynch und der amerikanischen Westernlandschaft als Inspiration vor Augen wurde dem Film, wie der Regisseur es ausdrückt, ein eigenes musikalisches Genre geschenkt: der „Space-Country“.


Als ständiger Begleiter aus dem Off hört man den Kommentar des Roboters, der sich als eine sympathische Version von Marvin, dem pessimistischen Roboter in Douglas Adams Roman Per Anhalter durch die Galaxis, auffassen lässt. Den gesamten Film hindurch deklamiert er eine poetische pseudo-philosophische Rede, angereichert mit kolonialistischen Metaphern. So tauchen unter anderem amerikanische Indianer_innen und die Geschichte ihrer Vernichtung auf. Auch die Nebeneffekte von Massentourismus und Neokolonialismus werden immer wieder angesprochen.
Die Expeditionsteilnehmer_innen müssen Englisch sprechen, obwohl alle Tschech_innen sind. „Speak english!“ wiederholt der Leader ständig. Der Roboter reiht „Punchlines“ über Leben und Liebe aneinander. Zwischen Sätzen wie “when people speak of love, they mean food or sex“ und „[l]ove is a biochemical process“ gibt es auf den ersten Blick kaum Platz für Romantik. Jedoch geht es in diesem Film sicherlich nicht nur um ein „Menschsein“, das von Grausamkeit, Habgier und Verantwortungslosigkeit geprägt ist, sondern auch um eines, dass das Streben der Menschen nach Idealismus, Naivität und Hoffnung thematisiert.
Der Müll verweist im Film explizit auf die ökologische Krise und das Eingreifen des Menschen in die Natur. Schon zu Beginn erklärt man dem tschechischen Milliardär, dass die Gruppe ihren Müll wieder zur Erde mitnehmen muss. Eine Idee, die den geschäftstüchtigen Herrn anfixt, nämlich aus der hygienischen Notwendigkeit Geld zu machen! Jedoch wird sein Vorhaben im Laufe der Handlung nahezu nicht mehr thematisiert, woraus man schließen kann, dass es nur bei Andeutungen bleiben soll.
In Trash on Mars gibt es unter dem blauen Neon deutliche „trash“-Situationen und ‑Worte. Leicht zynisch fragt man sich immer wieder, was oder wer ist eigentlich der ‚Müll‘? Etwa die Menschen selbst, diese kleinen Zweibeiner, die sich so weit weg wagen von ihrem sicheren Zuhause? Viele Fragen, die der Film bewusst offenlässt. Die irretierendste von ihnen lautet: Befinden sich die Protagonist_innen wirklich auf dem Mars? Man weiß es eigentlich nicht. Auch die Figuren sind sich darüber nicht einig. Wendy, die Yogalehrerin, bezweifelt, dass sie sich auf dem Mars befinden; sie ist davon überzeugt, sich in einer durchweg inszenierten Geschichte in Griechenland zu befinden. Liegt sie wirklich so falsch?
Das Ende des Films bleibt genauso poetisch wie enigmatisch: Pure Fantasie, Absurdität oder doch harte Realität? Der Roboter macht dem Fragen ein scheinbares Ende: „I spoke to the great dog about this. He didn’t answer.“ So wird auch die Erwartung der Zuschauenden auf Antwort nicht erfüllt. Was bleibt, ist eine breit gezeichnete Skizze von Fragen und Ängsten der Menschheit im Jahr 2019. Doch selbst diesen Herausforderungen, so zeigt der Film, kann durchaus mit einem Lächeln begegnet werden.
Tuček, Benjamin: Trash on Mars (Müll auf dem Mars). Tschechische Republik, 2018, 85 Min.


