

Weltenbummler und echte Bummler. Das 11. Internationale Literaturfestival Berlin.Ein Rückblick
Vom 7. bis zum 17. September ging in diesem Jahr bereits zum 11. Mal das Internationale Literaturfestival über die Bühne. Über die Bühnen des Festivals gingen oder besser schlenderten erneut vor allem jene Autoren, die auf ihren Buchdeckeln gern als „Wanderer zwischen den Welten“ umschrieben werden. Am liebsten sieht man offenbar auf einem solchen Festival Weltenbummler. Und weil Weltenbummler durch ihre ungeheure Mobilität problemlos auch bei Literaturfestivals vorbeibummeln können, sollte statt von „Wanderern zwischen den Welten“ wohl eher von „Wanderern zwischen den Literaturfestivals“ die Rede sein. Allzu viele Veranstaltungen des diesjährigen Festivals ließen sich vor allem in einer Rubrik erfassen: „Literaturen der Welt.“ Was im Anblick der kosmopolitischen Geste bleibt, ist die Ahnung, dass die Buntscheckigkeit der Kulturen manchmal nur die Homogenisierungseffekte des Kapitals kaschiert.


Natürlich durfte auf einem solchen Festival mit globaler Bedeutung auch Raoul Schrott nicht fehlen.Schrott ist ein Weltenbummler in homerischer Tradition. Er hat stets einen Rucksack voll kleiner Mitbringsel dabei. In dem Logbuch Die fünfte Welt hat er bereits das leicht zynische Unternehmen verfolgt, die seines Erachtens letzte weiße Stelle des Planeten zu beschreiben. Für sein neuestes Projekts über die Entstehung des Kosmos, des Lebens und des Menschen habe er die ersten zehn Milliarden Jahre schon hinter sich, so Schrott, die richtig schwierigen vier Milliarden Jahre aber noch vor der Brust. Im Gegensatz dazu verschwindend geringe vier Jahre hat er für dieses Großprojekt eingeplant. Es geht zunächst um die Undarstellbarkeit des Anfangs, des Big Bangs, dann um die Entstehung der ersten Lebewesen, schließlich um den unzurechnungsfähigen Fisch, der sich an Land gewagt hat. Schrott spricht über den Zusammenhang zwischen Metaphorik und Metaphysik und die Wichtigkeit der Neurologie für das Verständnis der Poesie. Die Versöhnung von Wissenschaft und Poesie ist Schrotts Sisyphos-Projekt. „Die Poesie gibt die Strukturen unseres Denkens wieder“, sagt er. Das komplizierte Wissen der unterschiedlichen Fachdisziplinen will er zusammentragen und sinnlich-poetisch erfahr- und vorstellbar machen. Erhellend sind für ihn darum nicht nur die großen wissenschaftlichen Debatten, sondern auch kleine periphere Informationen: wie jene, dass die Neandertaler wie Kinder vor dem Stimmbruch sprachen. Er liest aus seinem Notizbuch Die erste Erde über den ältesten Stein der Welt, den in der Hand zu halten er sich bemüht hat, auf der Suche nach dem „Realen im Irrealen der Zeit.“ Am Ende soll das Ganze ein Epos werden. Vorerst gibt Schrott einen ziemlich ehrlichen, entblößten, angesichts der Mammutaufgabe fast hilflosen Einblick in seine Werkstatt.
Die Liste der Weltenwanderer des Literaturfestivals ließe sich endlos fortsetzen: Der in der Schweiz lebende Michail Šiškin mit Venushaar, seinem großen und prämierten Roman über Migration und Exil, war einer der russischen Vertreter. Oder Nam Le – vietnamesisch-australischer Herkunft und der neue Star der amerikanischen Literaturszene. Da er seinen Erzählband Das Boot vorstellte, müsste Nam Le demnach eigentlich „Segler zwischen Welten“ genannt werden. Er präsentierte seine kleinen, intensiven Sprachkunstwerke über Flüchtlinge aus aller Welt und in alle Welt. Ein junger Autor, der an einem soliden, ehrlichen Gespräch über die Reize und Tücken des Schreibens sichtlich interessiert war. Fiktion, so sagte er prägnant und unheimlich zugleich, könne im Gegensatz zu Dokumentarliteratur auch verfemten Affekten und Ressentiments wie „Rassismus oder Homophobie die Würde des Ausdrucks“ verleihen. Gefragt wird er dann natürlich, woher er, der so viel reist und reisen muss, um an seinen Geschichten zu arbeiten, diese unerhörte „Wanderlust“ hernehme. Schwere Frage. Wahrscheinlich ahnte die englische Moderatorin nicht, dass es sich bei Wanderlust um ein deutsches Wort mit romantischer Tradition handelt, das dem Festival nun endgültig den Anstrich des Alpenvereins verlieh.
Bei aller gewollten Welthaftigkeit kann man dem Literaturfestival sicherlich nicht vorwerfen, es habe sich in einer exotisch-seichten Schmökerwelt gebadet. Schon Ulrich Schreiber hat in Anwesenheit von Liao Yiwu beim Eröffnungsvortrag immerhin den chinesischen Botschafter adressiert, und zwar klipp und klar mit den Worten: „So nicht.“ So stand auch in der Eröffnungsrede durch Tahar Ben Jelloun Reportageliteratur im Fokus. Als osteuropäische Grande Dame der Reportageliteratur war Svetlana Aleksijevič zu Gast. Generell aber konnte man sich schwer des Eindrucks erwehren, dass solche Festivals – wie der Buchmarkt überhaupt – dem Tagesgeschehen allzu sehr hinterher hecheln. Die diesjährige Ereignisfülle schien eine wirkliche Herausforderung: Schuldenkrise, Fukushima, Arabischer Frühling. Das ilb erinnerte durchaus daran, dass die Literatur oft in Kriegstagen voll und ganz zur Reportage „verkommt“, man denke an die sowjetischen Schriftstellerbrigaden des 2. Weltkriegs. Die Weltliteratur und die „Literaturen der Welt“ auf dem ilb portraitierten eine Besorgnis erregende Welt im ökologischen, ökonomischen und politischen Ausnahmezustand.


Ein sowohl dokumentarliterarisches wie weltliterarisches Highlight war dann aber die Anwesenheit von Liao Yiwu. Dieser frühere chinesische Provinzlyriker war nämlich seit seinem Gedicht „Massaker“ und den gleichnamigen Vorgängen auf dem Tian’namen-Platz in Peking 1989 erst im Gefängnis und wurde dann systematisch mundtot gemacht. Im Untergrund sammelte er seine Geschichten, die zuerst Interviews waren und schließlich autobiographische Form angenommen haben. Nach zahlreichen vergeblichen Ausreiseversuchen ist Liao Yiwu nun schließlich in Berlin gestrandet. Und das ist er tatsächlich: kein Weltenbummler, sondern ein Gestrandeter. Zusammen mit Tienchi Martin-Liao, Autorin, Übersetzerin und Vorsitzende des PEN-Zentrums in Taipeh, ruft er uns die Unabhängigkeit der Demokratie und der Menschenrechte vom Kapitalismus in Erinnerung, und auch, wie die Dichter und Denker der Bundesregierung das nennen: „Wandel durch Handel.“ Die kapitalistische Öffnung sei nämlich die ideale Regierungstechnik zur Depolitisierung der Bevölkerung, nicht einmal Patriotismus sei in China möglich aufgrund der Geschäftigkeit. Anders an dieser Veranstaltung ist auch, dass die Zuschauer nicht nur als Konsumenten angesprochen werden. Im Gegenteil: Der chinesische Wohlstand, so sagt uns Tienchi Martin-Liao, verdanke sich unwürdigen Arbeitsbedingungen, Hungerlöhnen, Zwangsarbeit in den Gefängnissen, welche wir Europäer durch das Kaufen chinesischer Produkte förderten.


In Liao Yiwu sitzt plötzlich einer auf dem Podium, der glüht und der zu reden nicht mehr aufhören kann. Natürlich hat er Botschaften, aber entscheidend ist: Er hat etwas zu sagen. Endlich einer, der einfach nur erzählen will, und zwar mit dem Rededrang, der an eine manische Erkrankung erinnert, der aber auch einfach nur der Manie zu verdanken sein könnte, die es für Literatur braucht. Deshalb ist Liao Yiwu richtig auf einem Literaturfestival. Und so fängt er immer und immer wieder an: „Und dann wollte ich auch noch erzählen über…“: über die „Laogai“ etwa, das bereits in den dreißiger Jahren von den stalinistischen Gulags abgekupferte Gefängnissystem und die dort stattfindende, drei Jahre in Anspruch nehmende „Umerziehung durch Arbeit“, die „Neuprogrammierung des Gehirns“, oder über Organhandel und das blühende Transplantationsgeschäft und vor allem über die neuen chinesischen Handschellen, die vielleicht das einzige deutsche oder amerikanische Importprodukt sind, dem er in China begegnet ist. Die Handschellen, meint er, müssten aus Deutschland kommen, denn früher, in den chinesischen Handschellen, habe man sich noch einigermaßen frei bewegen können. Anders die neuen: jedes Mal, wenn man die Hände bewegt, werden sie noch enger. „In den chinesischen Handschellen fühle ich mich wohler.“ Und nun fallen plötzlich auch jene Sätze, die eigentlich nie fallen dürften, die niemand hören will und an denen deutlich wird, dass Liao Yiwu noch nicht allzu lange auf europäischen Literaturfestivals zu Gast ist. Vielleicht ist ihm auch egal, ob er die übliche Rede durchkreuzt. Er sagt: „Die Juden hatten wenigstens noch eine Identität, als sie in die Gaskammer gingen, sind sie immerhin zusammen gegangen und haben gesungen. Wir Chinesen nicht. Wir sind Hunde. Wir zerfleischen uns noch selbst.“ Sätze, die gerade in ihrer historischen Unwahrheit, in ihrer Taktlosigkeit davon zeugen, dass jemand etwas loswerden will. Liao Yiwu redet so schnell, leidenschaftlich und atemlos, dass sich die Dolmetscherin im Kopfhörer ständig verschluckt.
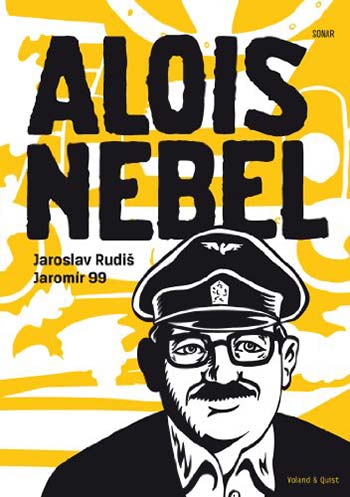
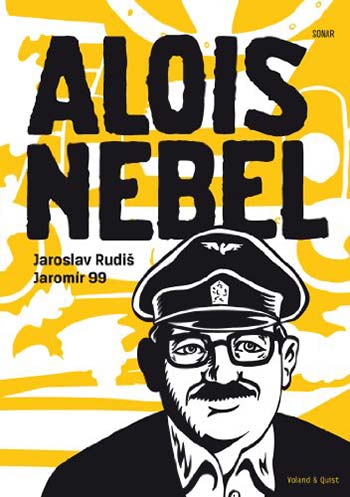
Der Aufbau des Romans ist denkbar einfach: Fleischman erzählt seine Geschichte. Darin kommen neben Jegr noch einige Frauen vor, in die sich Fleischman stets verliebt, unter anderem seine Therapeutin, für die er all das aufschreibt, und eine hübsche Wettermoderatorin, die vom Wetter aber nichts versteht und der er regelmäßig Briefe schickt, wenn sie einen Fehler macht. Rudiš erklärt uns, Tschechien sei ein Tal, darin gebe es wieder ein Tal, das sei Böhmen, und darin ein weiteres Tal, das sei Liberec, der „Pisspott Europas“. Ein Tal, in dem es nicht nur die ganze Zeit regnet, sondern in dem auch die Leute „regnerisch“ wären. Er zitiert einen böhmischen Witz: Wenn der Berg zu sehen ist, regnet es bald. Wenn er nicht zu sehen ist, regnet es schon.
Der Deutsch sprechende Rudiš hat eine verträumte Erzählerfigur geschaffen, ist aber zugleich ein historisch denkender Autor mit archäologischer Präzision. Er sagt über seine Figuren, „sie haben alle einen Knall“, und sucht die Art von Humor, die – wie er sich ausdrückt – „von dem ganzen Scheiß befreit“ ist. Grandhotel ist ein melancholischer, ein einsamer und zugleich ein heiterer Roman. Rudiš selbst nennt ihn ein „sentimentales Buch“. Sympathisch ist an dieser Form von Sentimentalität vor allem die beharrliche Provinzialität seiner Figuren. Er kenne tatsächlich viele Tschechen, die es wie Fleischman einfach nicht über Herz brächten, die Grenzen ihrer kleinen Stadt auch nur einmal zu überschreiten. Liberec ist ein Ort, erklärt uns Rudiš, den man „nicht so leicht verlassen kann“. Fleischman weiß: „Will man sich einen Traum erfüllen, muss man allein sein, damit der Traum einem nicht geklaut werden kann.“ Grandhotel ist ein Lehrstück kultivierter Oblomowerei. Und ein Buch, das dem Genre des Heimatromans näher steht, als dem Terror der „Weltliteratur“. Das macht Rudiš so sympathisch und deshalb fällt er heraus und sticht hervor aus den grandiosen Exoten des Literaturfestivals 2011: Er verkörpert nicht den Autorentypus des Weltenbummlers, er ist nur ein Bummler. Durch diese Unterbietung hat er in meinen Augen den inoffiziellen Wanderpokal gewonnen.


