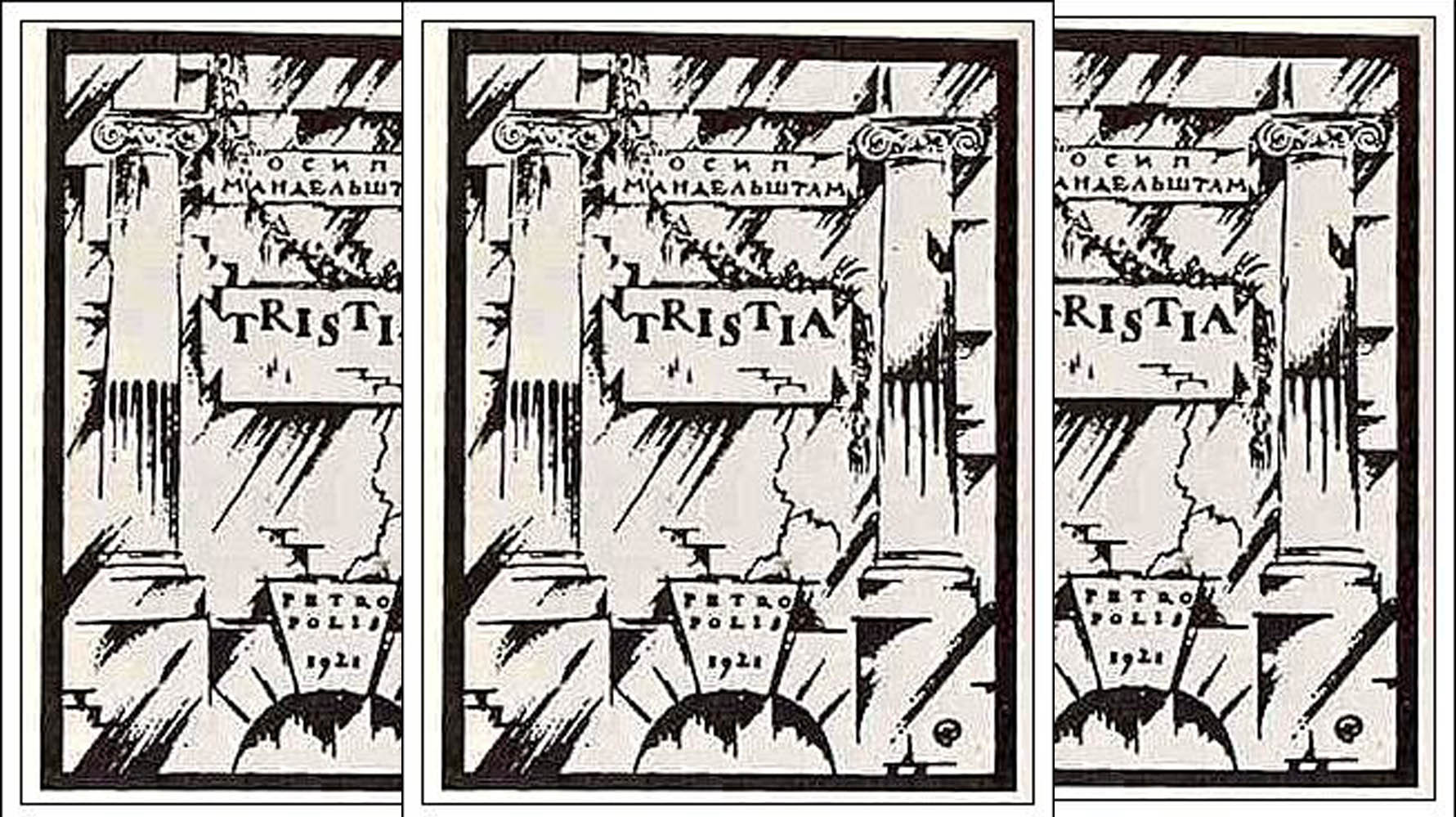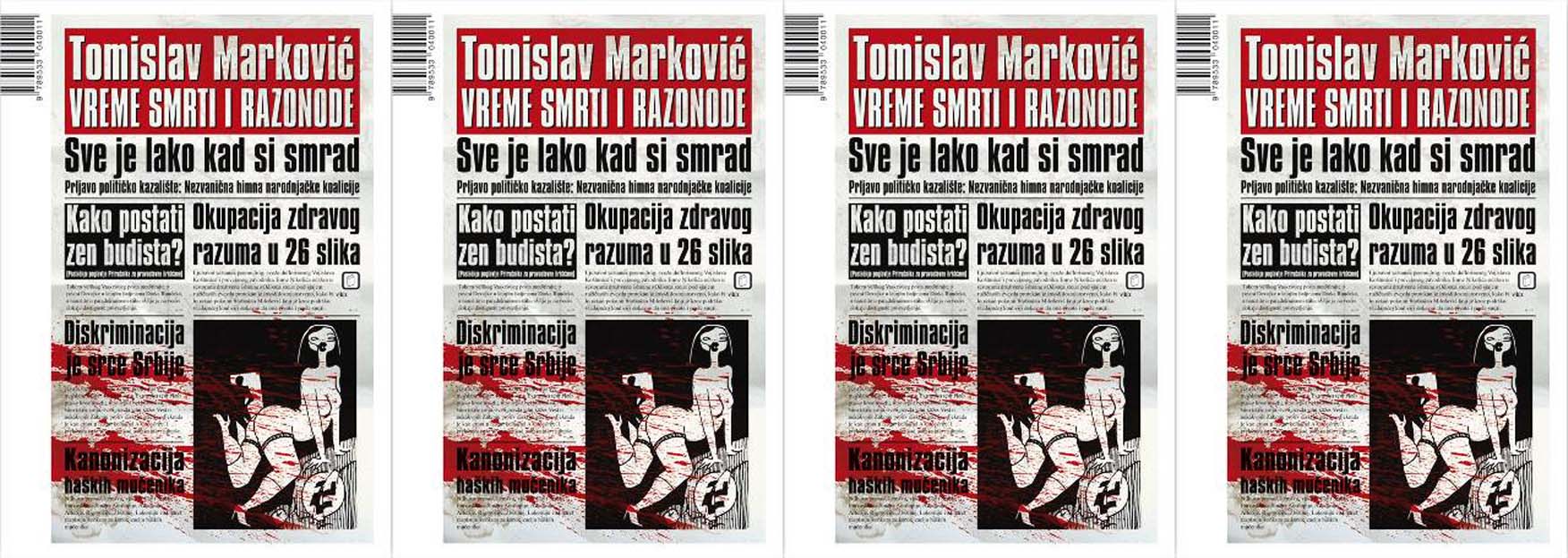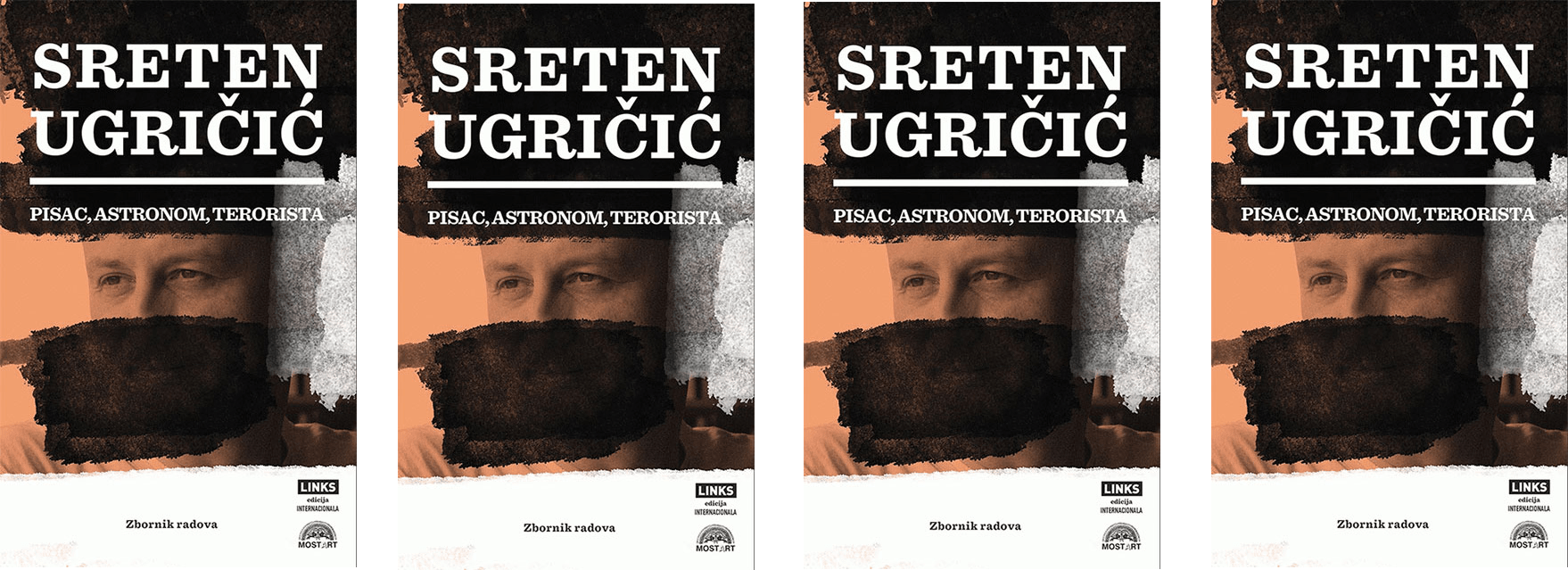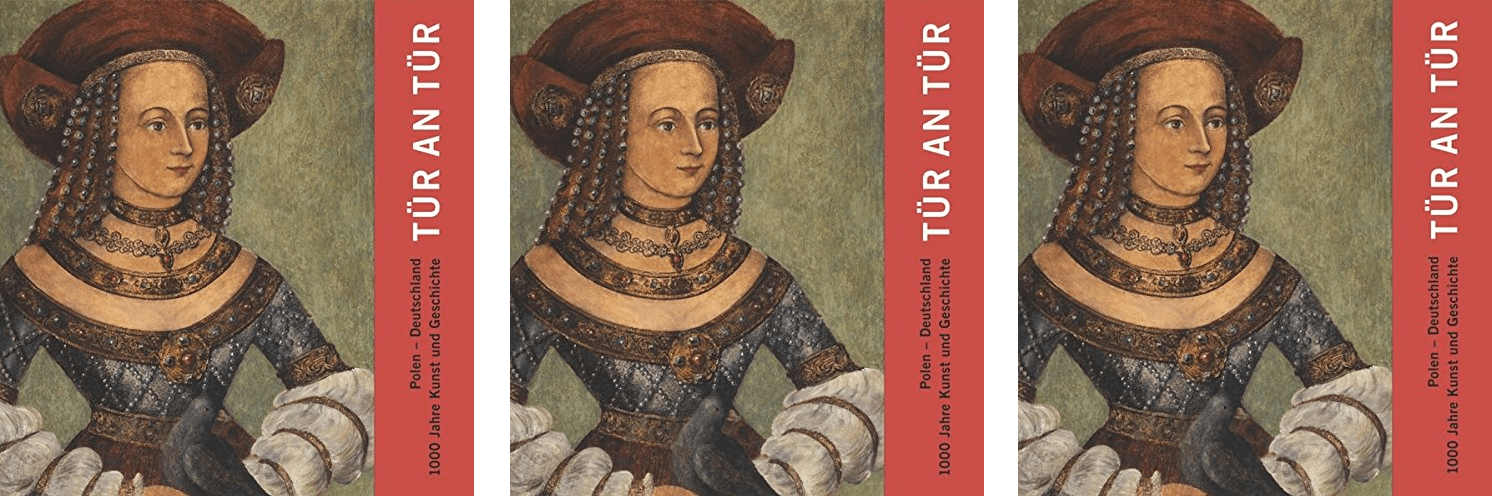Einblicke in das 26. FilmFestival für osteuropäisches Kino in Cottbus
Im Rahmen des studentischen novinki-Projekts „Filmkritisches Schreiben“ haben Studierende der Universität Potsdam im November 2016 das 26. FilmFestival für osteuropäisches Kino in Cottbus besucht. Ein Bericht über das Event sowie mehrere Filmbesprechungen geben Einblicke in das Programm der letzten Ausgabe des Festivals.
Tristia – Taistra. Von Ovid über Mandel’štam zu Marcel Beyer.
Die Himmel sind leer, die Vögel längst fortgezogen. Die Auguren schließen die brennenden Augen, Wimpernhaar, stechend (Osip Mandelʼštam). Sie sind müde von der verflogenen Zukunft, die sie geschaut haben. Vielleicht sind sie auch müde, weil die Bilder seit jeher eigentümlich sich gleichen, wie jene von Verbannung und Verlust, wie sie mit Ovid und später Osip Mandelʼštam aufziehen, zuletzt in Graphit nachgezeichnet von Marcel Beyer.
Die Erfinder der „erfundenen Dichter“ fahren mit ihrem Autor in dessen Heimat
In einer "free style" Reportage berichten Studierende, die gemeinsam mit Jurij Andruchovyč das Lyrikfestival "Meridian Czernowitz" in der Ukraine besucht haben, von ihren Eindrücken und Begegnungen mit einem Land, das nicht wenige bis dahin nur aus den Nachrichten kannten. Jurij Andruchovyč hat in Berlin mit seinem Auftrag, im Seminar eigene DichterInnen zu „erfinden“, Eindruck hinterlassen und ukrainische Literatur und Kultur lebendig erfahrbar gemacht.
„Das Bollwerk der Kunst”. Im Kampf um die Zukunft, nicht um Europa.
Ende 2013 kippten in Kyiv die Demonstrationen gegen die Regierung in blutige Proteste um. Seit Wochen stehen auf zentralen Plätzen ukrainischer Grossstädte Zeltlager der Protestierenden. Trotz militärischer Gewalt und winterlichem Frost entwickeln sie sich zu Orten der Kunstproduktion und ,brennen’ Kulturschaffenden aus allen Teilen der Ukraine unter der Tastatur.
Nationalismus ist die Luft, die wir atmen
Vladimir Arsenijević, Schriftsteller und Publizist aus Belgrad, ist einer der wenigen, der den jüngsten Eklat im serbischen Literaturbetrieb – die heftigen (Über-)Reaktionen auf ein Gedicht Tomislav Markovićs – überhaupt öffentlich zur Sprache bringt. novinki übersetzt aus diesem Anlass Arsenijevićs Kommentar und sein Gespräch mit Tomislav Marković, in denen sie über die Rolle der Dichtung und über den ‚Patriotismus’ in Serbien nachdenken.
Es gimpelt
Der Kinderbuchverlag Gimpel erobert mit hochwertigen Büchern den deutschen Kinderbuchmarkt und zeigt, was dieser von Polen lernen kann.
Eine Rose für die Stadt. Joanna Rajkowskas Berliner Kunstprojekte
Im Frühjahr und Sommer 2012 gab es in Berlin vier verschiedene Projekte der polnischen Künstlerin Joanna Rajkowska zu sehen, u.a. auf der 7. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst. Małgorzata Maria Bach ist ihnen für novinki nachgegangen.
„Ich muss nicht immer so übermenschlich konsequent sein“
Tadeusz Różewicz könnte ein absurdes Stück schreiben über den unbeholfenen Umgang der Stadt Breslau mit dem bekanntesten und mittlerweile ältesten ihrer Dichter. Da schneit vor zwei Jahren der Stadtpräsident, Pan Dutkiewicz, in des Dichters Wohnküche herein: „was hielten Sie eigentlich von einem Różewicz-Jahr?“ Natürlich zaudert da Różewicz, dessen Medienscheu beinahe sprichwörtlich in Polen ist – und man beginnt das Feilschen.
Serbiens Jagd auf Schriftsteller: der Fall Sreten Ugričić
Im Jahr 2021 ist der von Svetlana Gavrilović und Saša Ilić herausgegebene Sammelband "Sreten Ugričić: pisac, astronom, terorista" im Verlag "Most Art Jugoslavija" erschienen. Neben Aufsätzen, die dem literarischen und essayistischen Werk von Sreten Ugričić gewidmet sind, stellt der Sammelband einen Versuch dar, auf die politischen Prozesse und den ideologischen Hintergrund einzugehen, die im Januar 2012 zur Entlassung des Direktors der Nationalbibliothek Serbiens führten, zu einem Ereignis, das seinen Nachhall
Kunst und Gedächtnistheater – die polnisch-deutsche Ausstellung „Tür an Tür”
Dieser Beitrag über die Ausstellung „Tür an Tür. Polen – Deutschland. 1000 Jahre Kunst und Geschichte“ aus dem Jahr 2011 ruft uns die damalige öffentliche Debatte um die Entfernung von Artur Żmijewskis umstrittenen Videokunstwerk „Berek“ in Erinnerung. Aber unabhängig vom Anlass hat der Blick des Beitrags auf die ‚Inszenierungsregeln‘ und ‚Bühnenanweisungen‘ des deutschen Holocaustsdiskurses auch zehn Jahre später wenig an Relevanz verloren.